ISSN 1725-2407
doi:10.3000/17252407.C_2009.302.deu
Amtsblatt
der Europäischen Union
C 302
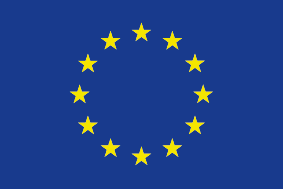
Ausgabe in deutscher Sprache
Mitteilungen und Bekanntmachungen
52. Jahrgang
12. Dezember 2009
|
ISSN 1725-2407 doi:10.3000/17252407.C_2009.302.deu |
||
|
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302 |
|
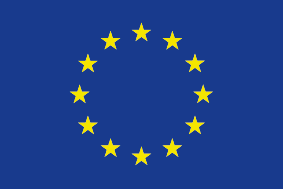
|
||
|
Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
52. Jahrgang |
|
Informationsnummer |
Inhalt |
Seite |
|
|
II Mitteilungen |
|
|
|
MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
|
|
|
Kommission |
|
|
2009/C 302/01 |
Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) ( 1 ) |
|
|
2009/C 302/02 |
Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften |
|
|
|
V Bekanntmachungen |
|
|
|
VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK |
|
|
|
Kommission |
|
|
2009/C 302/11 |
Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses (Sache COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) — Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall ( 1 ) |
|
|
|
||
|
2009/C 302/12 |
||
|
|
|
|
|
(1) Text von Bedeutung für den EWR |
|
DE |
|
II Mitteilungen
MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
Kommission
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/1 |
Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss
(Sache COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)
(Text von Bedeutung für den EWR)
2009/C 302/01
Am 4. Dezember 2009 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates entschieden, keine Einwände gegen den obengenannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden beiden EU-Websites veröffentlicht:
|
— |
Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden, |
|
— |
der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Hier kann diese Entscheidung anhand der Celex-Nummer 32009M5684 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht. |
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/2 |
Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften
2009/C 302/02
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1) werden die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften (2) wie folgt geändert:
Seite 94
Absatz „2208 30 32 und 2208 30 38‚malt‘-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von“ wird ersetzt durch:
|
„2208 30 30 |
‚single malt‘-Whisky |
|
|
‚Single Malt Scotch‘ Whisky ist ein alkoholhaltiges Getränk, das in klassischen Brennblasen (Pot Still) in einer einzelnen Brennerei durch Destillieren aus einer vergorenen Maische aus ausschließlich gemälzter Gerste hergestellt wird.“ |
Absatz „2208 30 52 und 2208 30 58‚blended‘-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von“ wird ersetzt durch:
|
„2208 30 41 und 2208 30 49 |
‚blended malt‘-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von |
|
|
‚Blended Malt Scotch‘ Whisky wird durch Mischen (‚blending‘) von zwei oder mehr ‚Malt Scotch‘ Whiskies hergestellt, die in verschiedenen Brennereien destilliert/gewonnen wurden. |
|
2208 30 61 und 2208 30 69 |
‚single grain‘-Whisky und ‚blended grain‘ -Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von |
|
|
‚Single Grain Scotch‘ Whisky ist ein anderes alkoholhaltiges Getränk als ‚Single Malt Scotch‘ Whisky oder ‚Blended Malt Scotch‘ Whisky und wird in einer einzelnen Brennerei durch Destillieren aus einer vergorenen Maische aus gemälzter Gerste auch aus ganzen Körnern anderer Getreidearten (vor allem Weizen oder Mais) hergestellt. Blended Grain Scotch Whisky wird durch Mischen (‚blending‘) von zwei oder mehr ‚Grain Scotch‘ Whiskies hergestellt, die in verschiedenen Brennereien destilliert/gewonnen wurden.“ |
Seite 95
Absatz „2208 30 72 und 2208 30 78 andere, in Behältnissen mit einem Inhalt von“ wird ersetzt durch:
|
„2208 30 71 und 2208 30 79 |
Anderer ‚blended‘-Whisky, in Behältnissen mit einem Inhalt von |
|
|
Anderer ‚Blended Scotch‘ Whisky wird durch Mischen (‚blending‘) eines oder mehrerer ‚Single Malt Scotch‘ Whiskies mit einem oder mehreren ‚Single Grain Scotch‘ Whiskies hergestellt.“ |
(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1.
(2) ABl. C 133 vom 30.5.2008, S. 1.
IV Informationen
INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
Rat
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/3 |
Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 26. November 2009 zur Entwicklung der Rolle der Bildung in einem leistungsfähigen Wissensdreieck
2009/C 302/03
Der Rat und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten -
|
|
UNTER HINWEIS AUF
|
|
|
IN DEM BEWUSSTSEIN,
|
SIND DER AUFFASSUNG, DASS DIE WEITERE INTEGRATION VON BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION INNERHALB EINES LEISTUNGSFÄHIGEN WISSENSDREIECKS
das Innovationsvermögen Europas und die Entwicklung einer kreativen und wissensintensiven Wirtschaft und Gesellschaft stärken würde, indem
|
— |
die Wissensbasis an Hochschulen (1) und in Forschungszentren deutlich verbessert und ständig weiterentwickelt würde und so in der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt rasch in innovative Produkte, Dienstleistungen, Konzepte und Methoden umgesetzt werden könnte; |
|
— |
eine kreative, innovative und unternehmerische Denkweise unter Schülern, Auszubildenden, Studenten, Lehrern und Forschern gefördert würde, die die schrittweise Herausbildung einer höheren unternehmerischen Kultur durch allgemeine und berufliche Bildung in Verbindung mit einem dynamischeren europäischen Arbeitsmarkt und einer höheren Arbeitskraftqualifikation unterstützen würde; |
zu deutlichen Fortschritten beitragen würde in Bezug auf
|
— |
die Verwirklichung des Ziels der Initiative „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigung“ zur Verbesserung der Beschäftigungschancen der EU-Bürger auf einem sich wandelnden Arbeitsmarkt; |
|
— |
das Modernisierungsprogramm für die Hochschulen (2). |
SEHEN FÜR DEN BILDUNGSSEKTOR DIE FOLGENDEN BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN:
|
— |
die Notwendigkeit einer Überbrückung der kulturellen Kluft zwischen Bildung — im Sinne von Lehre, Lernen und Vermittlung soziokultureller Werte — sowie Forschung und Innovation im kommerziellen Bereich; |
|
— |
die Notwendigkeit einer in stärkerem Maße innovativen und unternehmerischen Kultur im Hochschulbereich; |
|
— |
die Notwendigkeit einer Verbesserung von Kommunikation und Mobilität zwischen Forschung und Lehre einerseits und Unternehmen und Wirtschaft andererseits und einer Förderung der Mobilität und des Ideenaustauschs zwischen den verschiedenen akademischen Bereichen und Forschungsdisziplinen; |
|
— |
die Notwendigkeit einer weiteren Reform der Leitungs- und Finanzstrukturen der Hochschulen, um diesen mehr Autonomie und Verantwortlichkeit zu verleihen, damit stärker diversifizierte Einnahmen und eine effektivere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ermöglicht und die Hochschulen dafür ausgerüstet werden, in globalem Maßstab am Wissensdreieck teilzuhaben; |
SIND DER AUFFASSUNG, DASS DEN STRATEGIEN ZUR BEWÄLTIGUNG DIESER BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN DIE FOLGENDEN ALLGEMEINEN PRINZIPIEN ZUGRUNDE LIEGEN SOLLTEN:
|
— |
Das Konzept des Wissensdreiecks bezieht sich auf das Erfordernis, die Wirkung von Investitionen in die drei Tätigkeitsformen — Bildung, Forschung und Innovation — durch ein systemisches und kontinuierliches Zusammenwirken zu erhöhen; |
|
— |
eine umfassende Integration des Wissensdreiecks erfordert stärker abgestimmte Entscheidungsprozesse und Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene; |
|
— |
damit die Bildung ihrer Rolle im Wissensdreieck gerecht werden kann, müssen sich die Ziele und Ergebnisse von Forschung und Innovation in der Bildung widerspiegeln, so dass die Lehre und das Lernen auf einer soliden Forschungsgrundlage beruhen und das Umfeld für die Lehre und das Lernen durch eine stärkere Einbindung von kreativem Denken sowie innovativen Einstellungen und Vorgehensweisen weiterentwickelt und verbessert werden kann; |
|
— |
die traditionelle akademische Kultur an den Hochschulen muss durch das Bewusstsein ergänzt werden, dass ihr auch eine Schlüsselrolle dabei zukommt, Arbeitskräfte mit höheren Kompetenzen, mehr Unternehmergeist und größerer Flexibilität hervorzubringen, die in den kommenden Jahren die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand sowie für eine höhere Lebensqualität bilden werden. Wissenschaftler und Dozenten sollten durch ihre Fortbildung besser in der Lage sein, in die Organisationen, für die sie arbeiten, eine Innovationskultur hineinzutragen; |
|
— |
das Wissensdreieck muss auch Berücksichtigung finden, wenn auf nationaler, regionaler und institutioneller Ebene Strategien für das lebenslange Lernen entwickelt werden, so dass die Hochschulen stärker an der Verbesserung der für die wissensbasierte Gesellschaft wichtigen Qualifikationen beteiligt werden und der Wert früherer Lern- und Arbeitserfahrungen durch die Aufnahmeregeln in ausreichendem Maße anerkannt wird; |
|
— |
neue Ideen und Innovationen entstehen aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kenntnisarten und durch die von Neugier getriebene Suche nach neuem Wissen. Daher ist es entscheidend, anzuerkennen, dass neben Wissenschaft und Technologie einer hochwertigen sozial- und geisteswissenschaftlichen Bildung und Forschung bei der Innovation eine wichtige Rolle zukommt; |
|
— |
die Vielfalt der europäischen Hochschul- und Forschungssysteme sollte im Hinblick auf die Entwicklung verschiedener Konzepte für ein leistungsfähiges Wissensdreieck als positiver Faktor betrachtet werden; |
LEGEN DIE FOLGENDEN SIEBEN VORRANGIGEN HANDLUNGSSCHWERPUNKTE FEST:
1. Erhöhung der Kohärenz zwischen den Strategien in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation
Es besteht auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten Bedarf an kohärenteren Entscheidungsprozessen, unter voller Integration der drei Komponenten des Wissensdreiecks. Die Strategien in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation sollten sich gegenseitig verstärken, um die Entwicklung eines leistungsfähigen Wissensdreiecks zu gewährleisten und den Übergang zu einer wirklich wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft zu beschleunigen. Im Rahmen der bestehenden Berichtsprozesse bei der offenen Koordinierungsmethode sollte die Kommission dem Rat über die Maßnahmen Bericht erstatten, die in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation eingeleitet wurden, um die Integration des Wissensdreiecks zu unterstützen. Dabei sollten Hindernisse benannt und Empfehlungen für die weitere Entwicklung gegeben werden.
2. Beschleunigung der pädagogischen Reformen
Die Mitgliedstaaten sollten die Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ermutigen, dafür zu sorgen, dass die Lehrpläne sowie die Lehr- und Prüfungsmethoden auf sämtlichen Bildungsebenen — einschließlich der Promotion — Kreativität, Innovation und Unternehmergeist beinhalten und fördern. Eine Möglichkeit wäre, die Lehrpläne gegebenenfalls in kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, der Industrie und anderen Akteuren auszuarbeiten.
3. Partnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen und anderen relevanten Akteuren
Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten zügig den Aufforderungen zum Handeln nachkommen, die in den Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 12. Mai 2009 über den Ausbau der Partnerschaften zwischen Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung und den Sozialpartnern, insbesondere den Arbeitgebern, im Rahmen des lebenslangen Lernens enthalten sind. Bei der Entwicklung engerer Verbindungen zwischen den Hochschulen und denjenigen, für die sie ausbilden und forschen, sollte besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Anreizen für die Mobilität des Personals zwischen Hochschulen und Unternehmen gerichtet werden, darunter auch auf Programme für den Personalaustausch. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen sollte als Bestandteil der Bildungs-, Forschungs- und Innovationsstrategien der Hochschulen ausgebaut werden.
4. Maßnahmen zur Entwicklung einer Innovationskultur an den Hochschulen
Die Mitgliedstaaten sollten die Hochschulen ermutigen, ihre Anstrengungen zur Entwicklung einer Innovationskultur zu beschleunigen, u.a. durch dynamischere und stärker interaktive Lernumgebungen und Anreize für Mitarbeiter, sich an Projekten mit einer innovativen Dimension zu beteiligen. Es könnten Finanzierungsvereinbarungen und Anreizstrukturen auf institutioneller Ebene entwickelt werden, um einen Wandel der Hochschulkultur dahin gehend zu fördern, dass die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft als ein für die Laufbahnentwicklung wichtiger Faktor angesehen wird. Die entscheidende Rolle der Leiter der Hochschulen bei der Unterstützung der effektiven Entwicklung einer „Innovationskultur“ sollte anerkannt werden.
5. Schaffung von Anreizen für Hochschulen, übertragbares Wissen hervorzubringen
Die Mitgliedstaaten sollten prüfen, ob für die Hochschulen genügend Anreize bestehen, Wissen hervorzubringen, das zur Entwicklung von innovativen Gütern und Dienstleistungen in die Gesamtwirtschaft übertragen werden kann. Falls Rechtsvorschriften, Leitungsstrukturen oder Finanzvorschriften diese Einrichtungen daran hindern, Nutzen aus der Entwicklung und dem Transfer von solchem Wissen zu ziehen, sollten sich die Mitgliedstaaten bemühen, den Handlungsrahmen für ihre Einrichtungen anzupassen, so dass derartige Hindernisse beseitigt werden und den Hochschulen ausreichende Autonomie gewährt wird. Die Hochschulen sollten spezielle Strategien für die Generierung, die Weiterentwicklung und den Transfer von Wissen erarbeiten.
6. Neue Konzepte für die Qualitätsbewertung
Besonders im Bereich der Hochschulbildung sollten die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung von „Wissensdreieck-Kriterien“ zur Bewertung der Qualität ihrer Einrichtungen zusammenarbeiten, die darauf ausgerichtet sein sollten, wie erfolgreich Forschung und Innovation in die Lehre und die zentralen Bildungsfunktionen integriert wurden und wie erfolgreich die Einrichtungen bei der Schaffung von Lernumgebungen sind, die Kreativität und unternehmerische Ansätze begünstigen, um Wissen nutzbar zu machen und die Studenten auf ihr künftiges gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben vorzubereiten.
7. Entwicklung des EIT als Zukunftsmodell
Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) — die erste Initiative auf EU-Ebene, die auf ein kohärentes Zusammenwirken aller Akteure des Wissensdreiecks abstellt — sollte im Hinblick auf die Integration aller drei Seiten des Dreiecks zu einem Beispiel für die gute Praxis für die Mitgliedstaaten, die Hochschul- und Forschungseinrichtungen und die Wirtschaft entwickelt werden.
Die künftigen Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) als wichtigste operative Einheiten des EIT sollten in der Lage sein, neue Wege aufzuzeigen, wie wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen (z. B. nachhaltige Energie sowie Abschwächung der Folgen der Klimaänderung und Anpassungsmaßnahmen) durch ganzheitliche und multidisziplinäre Konzepte sowie durch neue Leitungs- und Finanzierungsmodelle zur Anregung von Innovationen auf höchstem Niveau bewältigt werden können. Das EIT sollte diese Modelle verbreiten, die dazu anregen sollten, auf verschiedenen Ebenen und grenzüberschreitend weitere gemeinsame Initiativen ins Leben zu rufen, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Rolle der Bildung im Wissensdreieck entwickelt werden muss.
Innerhalb des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung sollte die Kommission sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten über bewährte Verfahren im Hinblick auf diese sieben Prioritäten informiert werden und dass die Fortschritte in allen diesen Bereichen verglichen werden können.
BETONEN FERNER, WIE WICHTIG ES IST,
|
— |
Sorge dafür zu tragen, dass in der Strategie für Wachstum und Beschäftigung für die Zeit nach 2010 die Bildung als Basis des Wissensdreiecks festgehalten wird, und unterstreichen, dass alle drei Komponenten des Wissensdreiecks (Bildung — Forschung — Innovation) sich gegenseitig unterstützen und bereichern müssen. Das gesamte Bildungs- und Ausbildungssystem muss zur Förderung der für ein gut funktionierendes Wissensdreieck erforderlichen Schlüsselkompetenzen beitragen; |
|
— |
Sorge zu tragen für eine umfassende Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Strategien für die Weiterentwicklung des Europäischen Hochschulraums bzw. des Europäischen Forschungsraums und den Initiativen im Bereich der Innovation, insbesondere der breit angelegten Innovationsstrategie und dem künftigen europäischen Innovationsplan; |
|
— |
dass die Kommission die Erfordernisse der Strategie für Wachstum und Beschäftigung für die Zeit nach 2010 bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge für Gemeinschaftsprogramme im Bereich der Bildung und auf anderen relevanten Gebieten während der Geltungsdauer des nächsten Finanzrahmens umfassend berücksichtigt und zusammen mit den Mitgliedstaaten Überlegungen anstellt, wie die Strukturfonds genutzt werden könnten, um Initiativen in Verbindung mit der vollen Entfaltung der Bildung als Basis des Wissensdreiecks zu unterstützen. |
(1) In diesem Text wird der Begriff „Hochschulen“ für alle Arten von Hochschuleinrichtungen verwendet.
(2) Siehe die Entschließung des Rates vom 23. November 2007 über die Modernisierung der Universitäten im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas in einer globalen wissensbasierten Wirtschaft (Dok. 16096/1/07) sowie die Mitteilung der Kommission „Das Modernisierungsprogramm für Universitäten umsetzen: Bildung, Forschung und Innovation“ vom Mai 2006 (Dok. 9166/06).
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/6 |
Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 zur beruflichen Entwicklung von Lehrkräften und Schulleitern/-leiterinnen
2009/C 302/04
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
|
|
GESTÜTZT auf
|
|
|
und UNTER HINWEIS INSBESONDERE AUF
|
BEKRÄFTIGT,
dass die Zuständigkeit für die Organisation und den Inhalt der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zwar weiterhin bei jedem einzelnen Mitgliedstaat liegt, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene jedoch durch die offene Koordinierungsmethode im Zusammenspiel mit der effizienten Nutzung von Gemeinschaftsprogrammen zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung beitragen kann, indem auf nationaler Ebene ergriffene Maßnahmen unterstützt und ergänzt werden und den Mitgliedstaaten bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen geholfen wird;
STELLT Folgendes FEST:
|
1. |
Die Kenntnisse, die Fähigkeiten und das Engagement der Lehrkräfte (15) sowie die Qualität der Schulleitung sind die wichtigsten Faktoren für hochwertige Bildungsergebnisse. Guter Unterricht und die Fähigkeit, alle Schüler zu motivieren, ihr Bestes zu geben, können einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Zukunft der jungen Menschen haben. Aus diesem Grund ist es von wesentlicher Bedeutung, dass nicht nur sichergestellt wird, dass die Personen, die als Lehrkräfte oder für Posten in der Schulleitung eingestellt werden, hochqualifiziert und für ihre Aufgaben geeignet sind, sondern dass sie auch den höchsten Ansprüchen an ihre Erstausbildung und an ihre berufliche Weiterbildung als Lehrer auf allen Ebenen genügen. Dies wird wiederum dazu beitragen, dass sowohl der Status als auch die Attraktivität des Berufs gesteigert wird; |
|
2. |
Lehrerbildungsprogramme, die sowohl bei der Vorbereitung der Lehrer und Schulleiter auf die Erfüllung ihrer Aufgaben als auch bei der Gewährleistung der beruflichen Weiterentwicklung der Lehrkräfte und Schulleiter/-leiterinnen eine zentrale Rolle spielen, müssen von hoher Qualität und bedarfsrelevant sein sowie eine gut ausgewogene Kombination solider akademischer Forschung und umfassender praktischer Erfahrung darstellen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass Lehrererstausbildung, Unterstützung für Berufseinsteiger („Einführung“ (16) und fortlaufende berufliche Weiterbildung als kohärentes Ganzes behandelt werden; |
|
3. |
die erste Anstellung eines neuen Lehrers nach Abschluss seiner Erstausbildung ist eine besonders wichtige Zeit für seine Motivation, Leistung und berufliche Entwicklung. Neu eingestellte Lehrkräfte haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an die tatsächliche Situation an der Schule anzupassen und das bei der Lehrererstausbildung Erlernte anzuwenden. Tatsächlich gibt eine große Anzahl von ihnen ihre Karriere im Lehrberuf auf, wofür sowohl sie selbst als auch die Gesellschaft einen hohen Preis bezahlen. Umfangreiche nationale und internationale Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass strukturierte Unterstützungsprogramme für alle neuen Lehrkräfte einen Rückgang dieses Phänomens bewirken. Diese können auch für Lehrkräfte beim Wiedereinstieg in den Beruf von Nutzen sein; |
|
4. |
keine noch so gute Erstausbildung kann Lehrern und Lehrerinnen alle Kompetenzen vermitteln, die sie im Laufe ihrer Karriere benötigen. Die Anforderungen an den Lehrberuf entwickeln sich rasch und machen neue Konzepte unausweichlich. Um erfolgreich zu unterrichten und sich an die wandelnden Bedürfnisse der Lernenden in einer Welt der schnellen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen anzupassen, müssen auch die Lehrenden selbst ihren eigenen Lernbedarf im Kontext ihres besonderen schulischen Umfelds überdenken und mehr Verantwortung für ihre eigenen lebensbegleitenden Lernprozesse übernehmen, um ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen und weiterzuentwickeln. Tatsache ist allerdings, dass einige Lehrkräfte immer noch zu wenig Möglichkeit haben, an Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen, während auf der anderen Seite Lehrer und Lehrerinnen, die an solchen Programmen teilnehmen, oft den Eindruck haben, dass diese Programme nicht immer ausreichend relevant für ihre individuellen Bedürfnisse und die Herausforderungen sind, denen sie sich stellen müssen; |
|
5. |
eine erfolgreiche Schulleitung ist ein wesentlicher Faktor im Hinblick auf die Gestaltung des globalen Lehr- und Lernumfelds, die Förderung der Motivation und die Unterstützung von Schülern, Eltern und Personal, und trägt somit zu einem besseren Leistungsniveau bei. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, dass Schulleiter und -leiterinnen die Fähigkeiten und Qualitäten haben bzw. entwickeln können, die erforderlich sind, um die wachsende Zahl der sich ihnen stellenden Aufgaben, zu bewältigen. Von ebenso großer Bedeutung ist, dass sichergestellt wird, dass sie nicht mit Verwaltungsarbeit überlastet werden und sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren, wie beispielsweise die Qualität des Lernens, den Lehrplan, pädagogische Fragen sowie Leistung, Motivation und Entwicklung des Personals; |
|
6. |
Lehrkräfte auf allen Ebenen, einschließlich der Schulleitung, könnten größeren Nutzen aus einer erhöhten Bildungsmobilität und einer stärkeren Vernetzung ziehen, die eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Systeme und Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung gespielt sowie dazu beigetragen haben, dass diese Systeme und Einrichtungen offener, stärker nach außen orientiert, leichter zugänglich und effizienter wurden; |
IST SICH DARIN EINIG, dass
|
1. |
sich die Bildungssysteme in Europa in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden, dass sie jedoch gleichermaßen vor der Aufgabe stehen, hochqualifizierte Lehrkräfte und Schulleiter/-leiterinnen zu gewinnen und im Beruf zu halten, damit hochwertige Bildungsergebnisse erzielt werden können. Es sollte daher mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit das erforderliche Profil der zukünftigen Lehrer und Schulleiter/-leiterinnen festgelegt werden; genauso sorgfältig und aufmerksam sollten Lehrer und Schulleiter/-leiterinnen ausgewählt und auf die von ihnen zu erfüllenden Aufgaben vorbereitet werden; |
|
2. |
Lehrerbildungsprogramme qualitativ hochwertig, wissenschaftlich gesichert und bedarfsrelevant sein sollten. Diejenigen, die für die Lehrerausbildung – und für die Ausbildung von Lehrerausbildern – verantwortlich sind, müssen ihrerseits ein hohes akademisches Niveau erreicht haben und über solide praktische Unterrichtserfahrungen verfügen, sowie die für einen guten Unterricht erforderlichen Kompetenzen vorweisen können. Ferner sollten Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Lehrerbildungseinrichtungen einerseits mit Personen, die pädagogische Forschungsarbeiten in anderen Hochschuleinrichtungen durchführen, und andererseits mit Schulleitern/-leiterinnen wirksam zusammenarbeiten; |
|
3. |
Lehrer und Lehrerinnen angesichts der steigenden Anforderungen, die an sie gestellt werden, und der zunehmenden Komplexität ihrer Rollen, während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn Zugang zu einer wirksamen persönlichen und beruflichen Unterstützung brauchen, insbesondere ganz zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn; |
|
4. |
in einer sich schnell wandelnden Welt die Ausbildung und Entwicklung von Lehrkräften im Einklang mit dem Konzept des lebenslangen Lernens eine kohärente, kontinuierliche Größe darstellen muss, die sich von der Lehrererstausbildung (mit einer starken praktischen Komponente), über die Einführung bis zur beruflichen Weiterbildung erstreckt. Insbesondere sollten sich die Bemühungen darauf richten sicherzustellen, dass
|
|
5. |
angesichts des großen Einflusses, den Schulleiter/-leiterinnen auf das globale Lernumfeld, unter anderem auf die Motivation, die Arbeitsmoral und die Leistung des Personals, die Lehrpraxis und die Haltung und Motivation von Schülern und Eltern haben, sichergestellt werden muss, dass sie ausreichend Gelegenheit haben, wirksame Führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten. Da sich in ganz Europa ähnliche Herausforderungen an die Führungsrolle in Lerngemeinschaften stellen, sollten Schulleiter/-leiterinnen auch Nutzen aus der Kooperation mit ihren Kollegen in anderen Mitgliedstaaten, insbesondere durch den Austausch von Erfahrungen und Beispielen bewährter Verfahren, und aus grenzüberschreitenden Weiterbildungsmöglichkeiten ziehen; |
ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN,
|
1. |
weitere Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass hochqualifizierte Kandidaten als Lehrkräfte gewonnen und im Lehrberuf gehalten werden und dass Lehrkräfte eine ausreichende Vorbereitung und Unterstützung erhalten, damit sie ihre Aufgaben wirksam durchführen können; |
|
2. |
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass alle neuen Lehrkräfte an einem Einführungsprogramm teilnehmen, das ihnen in den ersten Berufsjahren sowohl fachliche als auch persönliche Unterstützung gibt; |
|
3. |
dafür zu sorgen, dass der Bedarf der Lehrkräfte an individueller beruflicher Entwicklung, der auf der Grundlage einer Selbstbewertung und/oder einer externen Bewertung ermittelt wird, regelmäßig überprüft wird und dass ausreichende Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung geboten werden, um diesen Bedarf zu decken und damit positive Auswirkungen auf die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu erzielen; |
|
4. |
die Nutzung der Möglichkeiten, die sich im Rahmen von Austausch- und Mobilitätssystemen auf nationaler und internationaler Ebene bieten, aktiv zu fördern und die Teilnahme an solchen Systemen zu unterstützen, um die Zahl der teilnehmenden Lehrkräfte und Schulleiter/-leiterinnen wesentlich zu erhöhen; |
|
5. |
die Zuständigkeiten von Schulleitern/-leiterinnen und die Bereitstellung von Unterstützung für sie zu überprüfen, insbesondere um den von ihnen zu bewältigenden Verwaltungsaufwand zu verringern, damit sie sich auf die Gestaltung des globalen Lehr- und Lernumfelds und auf das Erreichen eines besseren Leistungsniveaus konzentrieren; |
|
6. |
sicherzustellen, dass ein qualitativ hochwertiges Angebot zur Entwicklung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen sowohl für künftige Lehrkräfte als auch für im Beruf stehende Lehrkräfte, sowie zur Entwicklung – beispielsweise über spezielle Programme – von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen für eine erfolgreiche Schulleitung besteht; |
ERSUCHT DIE KOMMISSION,
|
1. |
die europäische strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Lehrererstausbildung, berufliche Weiterbildung und Schulleitung zu verbessern und zu unterstützen, insbesondere durch die Schaffung von Plattformen und Peer-Learning-Aktivitäten für den Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen und Fachwissen zwischen politischen Entscheidungsträgern und Lehrkräften; |
|
2. |
politischen Entscheidungsträgern praktische Informationen für die Ausarbeitung strukturierter Einführungsprogramme für alle neuen Lehrkräfte zu geben, die Beispiele für Maßnahmen enthalten, die zur Umsetzung oder Verbesserung solcher Programme ergriffen werden können; |
|
3. |
eine stärkere Teilnahme von Lehrkräften, Schulleitern/-leiterinnen und Lehrerausbildern/-ausbilderinnen an länderübergreifenden Mobilitätssystemen, Partnerschaften und Projekten im Rahmen von Gemeinschaftsprogrammen, insbesondere des Programms für lebenslanges Lernen, zu fördern und zu unterstützen; |
|
4. |
eine Studie über die bestehenden Bestimmungen in den Mitgliedstaaten über die Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Lehrerausbildern/-ausbilderinnen vorzubereiten; |
|
5. |
ein Kompendium der Kompetenzen der Lehrkräfte in den Mitgliedstaaten zusammen mit Peer-Learning-Aktivitäten in diesem Bereich vorzulegen; |
|
6. |
die weitere Entwicklung einer gesicherten Datengrundlage in Bezug auf den Lehrberuf und den Beruf des Schulleiters zu unterstützen, insbesondere durch Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen; |
|
7. |
den Rat im Rahmen bestehender Berichterstattungsmechanismen bei nächstmöglicher Gelegenheit über die Maßnahmen zu informieren, die von den Mitgliedstaaten und im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit im Anschluss an die Schlussfolgerungen des Rates von November 2007 zur Verbesserung der Qualität der Lehrerausbildung und der Schlussfolgerungen von November 2008 über eine Agenda für die europäische Zusammenarbeit im Schulwesen im Hinblick auf die berufliche Entwicklung von Lehrkräften und Schulleitern/-leiterinnen ergriffen wurden. |
(1) Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung von Lehrkräften und Ausbildern — SN 100/1/00 REV 1.
(4) Dok. 6905/04.
(5) Anlagen I und II des Dokuments 12414/07 ADD 1.
(8) ABl. L 327 vom 24.11.2006.
(9) ABl. L 394 vom 30.12.2006.
(10) ABl. C 311 vom 21.12.2007.
(11) ABl. C 320 vom 16.12.2008.
(12) ABl. C 119 vom 28.5.2009.
(13) ABl. C 300 vom 12.12.2007.
(14) ABl. C 319 vom 13.12.2008.
(15) Zum Zwecke dieser Schlussfolgerungen bezeichnen die Begriffe Lehrer/Lehrkraft eine Person, die nach den Rechtsvorschriften und der Praxis eines Mitgliedstaats den Status eines Lehrers/einer Lehrkraft (oder einen vergleichbaren Status) besitzt. Sie decken die besondere Situation der Lehrkräfte und Ausbilder/Ausbilderinnen in der beruflichen Bildung ab, beziehen sich jedoch nicht auf Personen, deren Lehrtätigkeit außerhalb des formellen Systems allgemeiner und beruflicher Bildung erfolgt, da Art und Inhalt ihrer Aufgaben unterschiedlich sind.
(16) Der Begriff „Einführung“ bezieht sich in diesem Text auf jedes strukturierte Unterstützungsprogramm, das für neue Lehrkräfte nach Beendigung ihres formellen Erstausbildungsprogramms und zu Beginn ihres ersten Lehrauftrags an einer Schule bereitgestellt wird.
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/10 |
Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2009 zu innovativen Anreizen für wirksame Antibiotika
2009/C 302/05
Nota bene: In diesem Dokument umfasst der Begriff „Antibiotika“ synthetisch hergestellte oder natürlich vorkommende Arzneimittel, die Bakterien abtöten oder deren Wachstum hemmen, sowie solche mit alternativen Wirkmechanismen, die beispielsweise die Virulenz der Bakterien beeinflussen. In diesem Zusammenhang sollten auch alternative Methoden für die Prävention und Kontrolle von Infektionen berücksichtigt werden.
|
1. |
VERWEIST AUF die Gemeinschaftsstrategie zur Resistenz gegen antimikrobielle Mittel (KOM(2001) 0333); |
|
2. |
VERWEIST AUF die Empfehlung des Rates vom 15. November 2001 zur umsichtigen Verwendung antimikrobieller Mittel in der Humanmedizin (1); |
|
3. |
VERWEIST AUF die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Juni 2008 zur Antibiotikaresistenz (2); |
|
4. |
VERWEIST AUF die Empfehlung des Rates vom 9. Juni 2009 zur Sicherheit der Patienten, unter Einschluss der Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen (3); |
|
5. |
VERWEIST AUF den Bericht der WHO von 2004 über prioritäre Arzneimittel („Priority Medicines for Europe and the World“) (4); |
|
6. |
VERWEIST AUF den gemeinsamen technischen Bericht des ECDC und der EMEA von 2009 „The bacterial challenge: time to react“ über die Diskrepanz zwischen multiresistenten Bakterien in der EU und der Entwicklung neuer antibakterieller Wirkstoffe (5). |
|
7. |
ERKENNT AN, dass die Verbreitung der Antibiotikaresistenz eine ernstzunehmende Gefahr für die weltweite Gesundheitssicherheit darstellt, der auf allen Ebenen begegnet werden muss. Die Gesundheitsbelastung durch antibiotikaresistente Bakterien, die mit Arzneimitteln erster oder sogar zweiter Generation nicht erfolgreich behandelt werden können, nimmt weltweit mit rascher Geschwindigkeit zu; |
|
8. |
ERKENNT AN, dass Antibiotikaresistenzen letztlich das Ergebnis einer Reihe von Unzulänglichkeiten im Gesundheitswesen und in der Tierzucht – auch bei der Prävention, dem Umgang mit und der Behandlung von Infektionen – sein könnten; |
|
9. |
ERKENNT AN, dass die Verfügbarkeit wirksamer und rationell eingesetzter Antibiotika entscheidend dazu beiträgt, einen umfassenden Schutz der öffentlichen Gesundheit und eine effiziente Gesundheitsfürsorge sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern zu gewährleisten. Stehen keine wirksamen Antibiotika zur Verfügung, so können gewöhnliche Infektionskrankheiten wieder zu lebensgefährlichen Bedrohungen werden und gehen zahlreiche medizinische und therapeutische Verfahren wie Krebsbehandlungen und Transplantationen mit hohen Risiken einher; |
|
10. |
ERKENNT AN, dass ein breites Spektrum an Maßnahmen erforderlich ist, um dafür zu sorgen, dass die Wirksamkeit der derzeit verfügbaren Antibiotika so lange wie möglich erhalten bleibt, wie etwa wirksame Impfungen zum Schutz vor Infektionen, neue diagnostische Verfahren und eine stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Angehörigen der Gesundheitsberufe einschließlich der im veterinärmedizinischen Bereich Tätigen dafür, wie wichtig der rationelle Einsatz von Antibiotika ist, um die Verbreitung der Antibiotikaresistenz bei Mensch und Tier zu verhindern; |
|
11. |
ERKENNT AN, dass eine angemessen angelegte Prävention und Kontrolle von Antibiotikaresistenzen und therapieassoziierter Infektionen eine kosteneffiziente Strategie darstellt, die zur finanziellen Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme insgesamt beiträgt und gewährleistet, dass die Qualität der Versorgung und die Sicherheit der Patienten stetig verbessert werden; |
|
12. |
ERKENNT AN, dass die Erforschung und Entwicklung wirksamer neuer Antibiotika beträchtlich abgenommen hat und voraussichtlich nicht genügend neue therapeutische Alternativen hervorbringen wird, um mit den medizinischen Anforderungen der nächsten 5-10 Jahre Schritt zu halten. Daher müssen dringend Anreize für die Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika geschaffen werden, insbesondere in den Bereichen, in denen der größte Bedarf besteht; |
|
13. |
BEGRÜSST die Ergebnisse der diesbezüglichen Konferenz vom 17. September 2009 in Stockholm („Innovative Incentives for Effective Antibacterials“), die wertvolle Anregungen für weitere Maßnahmen gegeben hat, mit denen die Erforschung und Entwicklung wirksamer neuer antibiotischer Arzneimittel und Therapien gefördert werden kann; |
14. RUFT DIE MITGLIEDSTAATEN auf,
|
— |
Strategien zu entwickeln und umzusetzen, mit denen der Öffentlichkeit und den Berufstätigen im Gesundheitswesen die Gefahren, die von Antibiotikaresistenzen ausgehen, sowie verfügbare Gegenmaßnahmen stärker ins Bewusstsein gerufen werden; |
|
— |
für die Entwicklung und Durchführung integrierter Strategien zur Eindämmung der Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen und therapieassoziierten Infektionen und ihrer Folgen zu sorgen; den Gesundheitseinrichtungen nahezulegen, entsprechende Strukturen bereitzuhalten, und eine effiziente Koordinierung von Programmen sicherzustellen, bei denen die Diagnose, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika und die Infektionskontrolle im Mittelpunkt stehen; |
|
— |
Optionen zu prüfen und zu erwägen, wie Anreize für die Erforschung und Entwicklung wirksamer neuer Antibiotika sowohl im Hochschulbereich als auch im gesamten pharmazeutischen Sektor geschaffen werden können, und dabei die Situation der kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Zu diesen Optionen und Methoden könnten einerseits kosteneffiziente Push-Mechanismen zur Überwindung anfänglicher Engpässe bei der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika und andererseits Pull-Mechanismen gehören, um die erfolgreiche Einführung neuer Produkte zu fördern; |
15. RUFT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION auf,
|
— |
die gemeinsame Nutzung von Forschungseinrichtungen, die Anwerbung von Forschern, die Anregung und Unterstützung internationaler Forschungszusammenarbeit, die stärkere Verbreitung von Forschungsergebnissen und Wissen über Informationsaustauschstrukturen sowie die Erwägung bestehender und neuer Finanzierungsinstrumente zu unterstützen; |
|
— |
Möglichkeiten zu erkunden, wie die öffentlich-private Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen, gemeinnützigen Organisationen und dem Gesundheitswesen weiter gefördert werden kann, um die Forschung in Bezug auf neue Antibiotika, Strategien für den Einsatz derzeit verfügbarer Antibiotika und diagnostische Verfahren zu erleichtern; |
|
— |
innerhalb des Rechtsrahmens für die Marktzulassung von Arzneimitteln die Entwicklung neuer Antibiotika zu erleichtern, für die besonderer medizinischer Bedarf besteht und für die der Antragsteller aus objektiven Gründen nur in begrenztem Umfang klinische Daten vorlegen kann, und zusätzliche Möglichkeiten zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit auszuschöpfen, etwa die Verwendung vorklinischer Bewertungsinstrumente und pharmakokinetischer Datenanalysen; |
|
— |
in geeignetes Regelungsinstrumentarium zu ermitteln, um eine frühzeitige Zulassung neuer Antibiotika zu erleichtern, für die besonderer medizinischer Bedarf besteht, indem eine kontinuierliche, von der EMEA und den zuständigen einzelstaatlichen Behörden unterstützte wissenschaftliche Beratung, einschließlich Strategien für ein geeignetes Follow-up erteilter Genehmigungen unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte, was auch die Beobachtung der Antibiotikaresistenz beinhaltet, angeboten wird; |
|
— |
zu prüfen, wie dafür gesorgt werden kann, dass wirksame Antibiotika auf dem Markt bleiben; |
|
— |
die Entwicklung wirksamer neuer Antibiotika zu fördern und zugleich die Prävention therapieassoziierter und anderer Infektionen sowie die rationelle Verwendung verfügbarer und neuer Arzneimittel zu gewährleisten; |
|
— |
zu gewährleisten, dass sämtliche Maßnahmen zwischen den verschiedenen Interessengruppen der betroffenen Bereiche wie Gesundheit, Finanzen, Wirtschaft, Justiz und Forschung in geeigneter Weise koordiniert werden; |
16. RUFT DIE KOMMISSION auf,
|
— |
innerhalb von 24 Monaten einen umfassenden Aktionsplan mit konkreten Vorschlägen für Anreize zur Entwicklung wirksamer neuer Antibiotika auszuarbeiten und dabei auch auf Möglichkeiten einzugehen, wie deren rationelle Verwendung gewährleistet werden kann; und sicherzustellen, dass diese Vorschläge den Auswirkungen auf die finanzielle Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme Rechnung tragen; |
|
— |
im Hinblick auf die entsprechenden Verfahren gegebenenfalls die Erfahrungen zu nutzen, die im Rahmen einschlägiger früherer Rechtsvorschriften der EU zu Arzneimitteln für seltene Leiden und für Kinder gesammelt wurden, um die Entwicklung neuer Antibiotika anzuregen, für die besonderer medizinischer Bedarf besteht; |
|
— |
ausgehend vom Auftreten neuer Antibiotikaresistenzen, der Beschreibung der betreffenden Krankheitserreger sowie neuer antibiotischer Arzneimittel und weiterer, in der Entwicklung befindlicher Methoden zur Behandlung und Verhütung von Infektionskrankheiten den Bedarf des Gesundheitswesens an neuen Antibiotika zu überwachen, dem Rat regelmäßig darüber Bericht zu erstatten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vorzuschlagen. |
(1) ABl. L 34 vom 5.2.2002, S. 13.
(2) Dok. 9637/08.
(3) ABl. C 151 vom 3.7.2009, S. 1.
(4) http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_PAR_2004.7.pdf
(5) http://www.nelm.nhs.uk/en/NeLM-Area/News/2009September/17/ECDCEMEA-joint-technical-report-The-bacterial-challengetime-to-react/
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/12 |
Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2009 zur sicheren und effizienten Gesundheitsversorgung durch eHealth
2009/C 302/06
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
|
1. |
WEIST darauf HIN, dass nach Artikel 152 des Vertrags bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt wird und die Gemeinschaft die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in diesem Artikel genannten Bereichen fördert und erforderlichenfalls deren Tätigkeit unterstützt. Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt; |
|
2. |
WEIST darauf HIN, dass die Gesundheitsstrategie der Gemeinschaft für die Jahre 2008—2013 (1) unter anderem darauf abzielt, dynamische Gesundheitssysteme und neue Technologien in der Erkenntnis zu fördern, dass diese Technologien die Bekämpfung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten erleichtern, die Patientensicherheit erhöhen und zu einer besseren Koordinierung der Gesundheitssysteme, einem effizienteren Einsatz der Ressourcen und mehr Nachhaltigkeit beitragen können; |
|
3. |
WEIST darauf HIN, dass die Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf der Ministerkonferenz über elektronische Gesundheitsdienste (eHealth) am 20. Februar 2009 in Prag eine Erklärung (2) verabschiedet haben, in der sie den Beitrag dieser Dienste zu einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen würdigen, zum Aufbau eines Raumes der elektronischen Gesundheitsdienste für die europäischen Bürger aufrufen und den Anstoß für ein abgestimmtes Vorgehen und eine bessere Verwaltung im eHealth-Bereich geben; |
|
4. |
VERWEIST AUF die Initiativen der Europäischen Union zu elektronischen Gesundheitsdiensten, insbesondere auf
|
|
5. |
BEGRÜSST, dass einige Mitgliedstaaten in jüngster Zeit zusammenarbeiten
|
|
6. |
BEGRÜSST den Bericht „eHealth for a Healthier Europe“ (11), den der schwedische Vorsitz auf der informellen Tagung der Gesundheitsminister am 6./7. Juli 2009 in Jönköping vorgelegt hat und in dem beispielhaft dargelegt wird, wie sich gesundheitspolitische Ziele durch Investitionen in die elektronischen Gesundheitsdienste verwirklichen lassen; |
|
7. |
IST SICH BEWUSST, dass eHealth ein wichtiges Instrument ist, das dazu beiträgt, die Qualität und Patientensicherheit zu verbessern, die nationalen Gesundheitssysteme zu modernisieren, ihre Effizienz zu erhöhen, sie für alle zugänglicher zu machen und sie besser an die individuellen Bedürfnisse der Patienten und der Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie an die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft anzupassen; |
|
8. |
IST SICH BEWUSST, dass mehr politische Vorgaben erforderlich sind und dass eHealth in die Gesundheitspolitik einbezogen werden muss, damit elektronische Gesundheitsdienste entwickelt werden, die den Erfordernissen des Gesundheitswesens entsprechen; |
|
9. |
FORDERT die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zu entwickeln und durchzuführen, die darauf abzielen, die Einrichtung und die Inanspruchnahme von elektronischen Gesundheitsdiensten zu fördern, und insbesondere
|
|
10. |
FORDERT die Kommission AUF,
|
|
11. |
FORDERT DIE Mitgliedstaaten und die Kommission AUF,
|
(1) Weissbuch — Gemeinsam für die Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013 (KOM(2007) 630).
(2) http://www.ehealth2009.cz/Pages/108-Prague-Declaration.html
(3) KOM(2004) 356.
(4) Dok. 9628/04.
(5) KOM(2007) 860.
(6) KOM(2008) 3282.
(7) KOM(2008) 689.
(8) Smart Open Services for European Patients (Intelligente offene Dienste für europäische Patienten) — von der EG aus der Haushaltslinie „Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation — Programm zur Unterstützung der Politik im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Förderprogramm)“ finanziert: http://www.epsos.eu
(9) Call for Interoperability — von der EG mit Mitteln des IKT-Förderprogramm finanziert: http://www.calliope-network.eu
(10) eHealth Interoperability Standards Mandate (M/403): http://www.ehealth-interop.nen.nl
(11) eHealth for a Healthier Europe — opportunities for a better use of healthcare resources (Ein gesünderes Europa durch eHealth — Chancen für einen besseren Einsatz der Ressourcen des Gesundheitswesens) http://www.se2009.eu
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/15 |
Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2009 zu Alkohol und Gesundheit
2009/C 302/07
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
1. VERWEIST AUF
|
— |
Artikel 152 des EG-Vertrags, wonach bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen von allen Organen der Gemeinschaft ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt wird und die Tätigkeit der Gemeinschaft die Politik der Mitgliedstaaten ergänzt; |
|
— |
die Mitteilung der Kommission über die gesundheitspolitische Strategie der Europäischen Gemeinschaft (1); |
|
— |
die Empfehlung des Rates zum Alkoholkonsum von jungen Menschen (2), in der die Kommission aufgefordert wurde, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Gemeinschaftspolitiken in vollem Umfang zu nutzen, um die in dieser Empfehlung behandelte Problematik anzugehen, unter anderem durch Entwicklung umfassender Gesundheitsförderungspolitiken auf nationaler und europäischer Ebene zur Bewältigung der Alkoholproblematik; |
|
— |
die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 2001 zu einer Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der schädlichen Wirkungen des Alkohols (3), die in den Schlussfolgerungen des Rates von 2004 (4) erneut bekräftigt wurden; |
|
— |
die Unterstützung des Rates (5) für die Mitteilung der Kommission „Eine EU-Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung alkoholbedingter Schäden“ (6) einschließlich der darin behandelten Schwerpunktbereiche und Maßnahmen sowie das Ersuchen an die Kommission, ab 2008 regelmäßig über die Fortschritte auf EU- und auf einzelstaatlicher Ebene zu berichten; |
|
— |
die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof wiederholt festgestellt hat, dass die öffentliche Gesundheit unter den in Artikel 30 EGV geschützten Interessen den ersten Rang einnimmt und dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, innerhalb der vom Vertrag gesetzten Grenzen zu bestimmen, auf welchem Niveau sie den Schutz der Gesundheit durch innerstaatliche Politiken und Rechtsvorschriften gewährleisten wollen (7); |
|
— |
die „Europäische Charta Alkohol“ der WHO, die alle EU-Mitgliedstaaten 1995 angenommen haben, insbesondere das darin erklärte ethische Prinzip, dass alle Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen das Recht haben, in einer Umwelt aufzuwachsen, in der sie vor den negativen Folgen des Alkoholkonsums und soweit wie möglich vor der Alkoholwerbung geschützt werden; |
|
— |
die Beratungen, die im Rahmen der Resolution WHA61.4 der Weltgesundheitsversammlung über „Strategien zur Reduzierung des Alkoholmissbrauchs“ stattgefunden haben, in der der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation ersucht wird, den Entwurf einer globalen Strategie zur Reduzierung des Alkoholmissbrauchs auszuarbeiten, die den Dokumenten für die für Januar 2010 anberaumte 126. Tagung des Exekutivrats hinzugefügt werden soll; |
2. BEKRÄFTIGT,
|
— |
dass die Zuständigkeit für die einzelstaatliche Alkoholpolitik hauptsächlich bei den Mitgliedstaaten liegt und dass die Kommission die jeweilige einzelstaatliche Gesundheitspolitik im Rahmen der Alkoholstrategie der EU unterstützen und ergänzen kann; |
|
— |
dass schädlicher und riskanter Alkoholkonsum – nach Tabak und Bluthochdruck – der drittgrößte Risikofaktor für Gesundheitsstörungen und vorzeitige Todesfälle in der EU ist (8); |
|
— |
dass viele Gemeinschaftspolitiken potenziell positive oder negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben und dass es wichtig ist, bei der Beschlussfassung in allen Politikbereichen die Auswirkungen auf die Gesundheit zu berücksichtigen; |
3. STELLT FEST,
|
— |
dass das Ausmaß der schädlichen Wirkungen des Alkohols, insbesondere unter anfälligen Bevölkerungsgruppen, im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz, in den Mitgliedstaaten immer noch beträchtlich ist, dass schätzungsweise 15 % der erwachsenen Bevölkerung in der EU regelmäßig Alkohol in gesundheitsschädlichen Mengen zu sich nehmen, dass zwischen fünf und neun Millionen Kinder in Familien in der EU von den negativen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums betroffen sind und dass schädlicher und riskanter Alkoholkonsum Mitursache für Kindesmisshandlung und -vernachlässigung in rund 16 % der Fälle und für schätzungsweise 60 000 Neugeborene mit Untergewicht im Jahr verantwortlich ist (9) (10); |
|
— |
dass die schädlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums in jüngeren Altersgruppen beiderlei Geschlechts besonders gravierend sind. Mehr als 10 % der Todesfälle in der weiblichen Bevölkerung und rund 25 % in der männlichen Bevölkerung sind auf riskanten Alkoholkonsum zurückzuführen (11); zudem wirkt sich der schädliche Alkoholkonsum unter Kindern und Jugendlichen auf ihre schulischen Leistungen aus; |
|
— |
dass Probleme im Zusammenhang mit Alkohol angesichts der grenzüberschreitenden Faktoren und ihrer negativen Auswirkungen sowohl auf die wirtschaftliche als auch auf die soziale Entwicklung und die Gesundheit der Bevölkerung auch für die Gemeinschaft von Belang sind; |
|
— |
dass die Vermarktung von Alkohol in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren, wie der Rolle der Familie und des sozialen Umfelds, ein Faktor ist, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kinder und Jugendliche anfangen, Alkohol zu trinken bzw. ihren Alkoholkonsum erhöhen, wenn sie bereits Alkohol trinken (12); |
|
— |
dass Alkohol in der EU zwischen 1996 und 2004 billiger geworden ist (13) und dass sich eine angemessene nationale Preispolitik für Alkohol, insbesondere zusammen mit anderen Präventionsmaßnahmen, positiv auf das Ausmaß schädlichen und riskanten Alkoholkonsums und der damit verbundenen Schäden insbesondere unter jungen Menschen auswirken kann (14); |
|
— |
dass der Konsum bestimmter Mengen Alkohol bei ärmeren Bevölkerungsgruppen einen unverhältnismäßig größeren alkoholbedingten Schaden verursachen kann und damit im Hinblick auf den Gesundheitszustand zu Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt (15); |
|
— |
dass ältere Menschen (ab 60 Jahren) anfälliger für die Auswirkungen schädlichen Alkoholkonsums sind als andere Erwachsene, dass Todesfälle im Zusammenhang mit Alkohol unter älteren Menschen in den letzten zehn Jahren beträchtlich zugenommen haben und dass sich die Anzahl der Todesfälle teilweise mehr als verdoppelt hat (16); |
|
— |
dass ein Zusammenhang zwischen schädlichem Alkoholkonsum und übertragbaren Krankheiten wie HIV/AIDS und Tuberkulose (TB) sowie der Gesundheit von Müttern besteht (17); |
|
— |
dass aus der regionalen Konsultation der WHO in Europa (18) deutlich hervorgeht, dass Ressourcen zur Durchführung politischer Maßnahmen und einer angemessenen Behandlung derjenigen, die eine Behandlung brauchen, als äußerst wichtig erachtet werden; |
4. IST DER AUFFASSUNG,
|
— |
dass in der Alkoholstrategie der EU eingeräumt wird, dass es in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten in Bezug auf den Alkoholkonsum gibt (19), und dass deshalb bei den ergriffenen Maßnahmen die Ergebnisse nationaler Folgenabschätzungen zu berücksichtigen sind; |
|
— |
dass Kinder, Jugendliche und junge Menschen und/oder Familien, die von den schädlichen Wirkungen des Alkohols betroffen sind, Beratung und Unterstützung erhalten sollten; |
|
— |
dass die Altersgruppe der Menschen ab 60 Jahren in den bestehenden Informationssystemen auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene berücksichtigt werden sollte; |
|
— |
dass die Verhaltensmuster von Frauen und Männern verschiedener Altersgruppen untersucht werden sollten, damit die Präventionsmaßnahmen besser auf die jeweilige Gruppe zugeschnitten werden können und angemessen gegen die unterschiedlichen Arten von Risiken vorgegangen werden kann; |
|
— |
dass es einen engen Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenen Ungleichheiten, die auf soziale Determinanten zurückzuführen sind, und — unter anderen Faktoren — dem Alkoholkonsum — sowohl als Ursache als auch als Folge — gibt; dass schädlicher Alkoholkonsum als Risikofaktor oder Mitursache bestimmter übertragbarer und nicht-übertragbarer Krankheiten bekannt ist und Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitskräfte hat; |
5. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN,
|
— |
die in der Alkoholstrategie der EU vorgestellten bewährten Praktiken anzuwenden und vorhandene Erkenntnisse über wirksame Maßnahmen zur Verringerung alkoholbedingter Schäden unter Berücksichtigung der fünf herausgestellten Schwerpunktbereiche zu nutzen: Jugendliche, Kinder und das Kind im Mutterleib zu schützen, die Zahl der Verletzungen und Todesfälle durch alkoholbedingte Straßenverkehrsunfälle zu senken, Maßnahmen zur Vorbeugung alkoholbedingter Schädigung bei Erwachsenen und zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf den Arbeitsplatz zu treffen, über die schädlichen Auswirkungen schädlichen und riskanten Alkoholkonsums zu informieren und aufzuklären und sie stärker ins Bewusstsein zu rufen und eine gemeinsame Grundlage von wissenschaftlich gesicherten Daten auf EU-Ebene einzurichten und weiterzuentwickeln; |
|
— |
einen sektorenübergreifenden Ansatz zu fördern und in Abstimmung mit den Arbeiten auf EU-Ebene umfassende, auf die jeweiligen nationalen Bedürfnisse zugeschnittene einzelstaatliche Strategien oder Aktionspläne zu entwickeln bzw. auszubauen und der Kommission bis 2011 über die diesbezüglichen Entwicklungen und Ergebnisse Bericht zu erstatten; |
|
— |
die wirksamsten Maßnahmen zu nutzen, um auf einzelstaatlicher Ebene eine Regelung und Durchsetzung im Bereich der Alkoholpolitik zu gewährleisten; |
|
— |
die Rolle der Preispolitik — etwa in Form von Regelungen für „Happy Hour“-Angebote, Sondersteuern auf Mix- und Gratisgetränke — insbesondere zusammen mit anderen Präventionsmaßnahmen als wirksames Instrument zur Verringerung alkoholbedingter Schäden in Betracht zu ziehen und ihre Auswirkungen abzuschätzen; |
|
— |
das Wohlergehen der alternden Bevölkerung in der EU ins Auge zu fassen und dabei zu berücksichtigen, dass schädlicher Alkoholkonsum dem Altern in Gesundheit und Würde in der EU abträglich ist, und dazu beizutragen, Angehörigen der Pflegeberufe, informellen Pflegern und älteren Menschen die potenziellen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Alkohol stärker ins Bewusstsein zu rufen; |
6. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION,
|
— |
der Alkoholpolitik im Rahmen des Gesundheitswesens bis 2012 weiterhin hohe Priorität einzuräumen, um eine nachhaltige und langfristige Verpflichtung zur Verringerung alkoholbedingter Schäden auf EU-Ebene zu schaffen und Prioritäten zu ermitteln, die sich die Kommission bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten in deren Bemühungen, alkoholbedingte Schäden auf EU-Ebene zu verringern, in ihrer nächsten Arbeitsphase zu eigen machen sollte; |
|
— |
für eine stärkere Ermittlung, Verbreitung und Überwachung wirksamer Maßnahmen zu sorgen, die darauf abzielen, die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des schädlichen Alkoholkonsums weitestgehend einzuschränken; |
|
— |
die Ausarbeitung und Verbreitung faktengestützter Beispiele für Präventivprogramme zur Verringerung alkoholbedingter Schäden während der Schwangerschaft und im Straßenverkehr zu fördern; |
|
— |
die Verringerung von Ungleichheiten beim Gesundheitszustand als politische Priorität einzustufen und die Notwendigkeit anzuerkennen, Ungleichheiten sowohl durch Maßnahmen im sozialen Bereich als auch durch auf die Bedürfnisse zugeschnittene Maßnahmen im Bereich der Alkohol-Prävention unter Berücksichtigung sozialer Determinanten zu verringern; |
|
— |
die Hersteller und Vertreiber alkoholischer Getränke dazu zu bewegen, eine aktivere Rolle bei der Durchsetzung von Regulierungsmaßnahmen zu übernehmen, so dass ihre Produkte verantwortungsvoll hergestellt, vertrieben und vermarktet werden und auf diese Weise ein Beitrag zur Verringerung alkoholbedingter Schäden geleistet wird; ferner zu prüfen, wie die Umsetzung bestehender einzelstaatlicher und EU-Regelungen für die Vermarktung von Alkohol verbessert werden kann, um Kinder und junge Menschen so weit wie möglich wirksam vor dem Einfluss des Marketings für Alkohol zu schützen; |
|
— |
dafür zu sorgen, dass gegebenenfalls vorhandene Selbstregulierungsstandards und Verhaltenskodizes in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Gesundheitsförderung ausgebaut, umgesetzt und überwacht werden; |
|
— |
wissenschaftliche Daten zum Alkoholkonsum und zu den Schäden, die der schädliche Alkoholkonsum in der Altersgruppe ab 60 Jahren verursacht, in bestehende Informationssysteme aufzunehmen; |
|
— |
die Forschung über die Zusammenhänge zwischen schädlichem Alkoholkonsum und Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS und TB zu verstärken; |
|
— |
Verfahren zur Früherkennung und Kurzzeitintervention im Bereich der primären und der auf Senioren ausgerichteten Gesundheitsfürsorge sowie im Rahmen schulischer Gesundheitsprogramme auszuarbeiten und durchzuführen; |
|
— |
Initiativen zu fördern, mit denen im Rahmen eines umfassenden Ansatzes im Sinne des Konzepts der „gesundheitsfördernden Schule“ das Bewusstsein für die Auswirkungen schädlichen Alkoholkonsums auf die Gesundheit und das soziale Wohlergehen geschärft wird; |
|
— |
zu prüfen, wie Verbraucher am besten informiert und aufgeklärt werden können, einschließlich der Erforschung, wie die Etikettierung alkoholischer Getränke dazu beitragen könnte, Verbrauchern die Einschätzung ihres eigenen Konsumverhalten zu erleichtern oder sie über Gefahren für die Gesundheit aufzuklären. |
|
— |
die vorliegenden Schlussfolgerungen bei der Entwicklung und Förderung der Umsetzung der Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum zu berücksichtigen; |
7. ERSUCHT DIE KOMMISSION,
|
— |
die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung einer umfassenden, wirksamen und nachhaltigen einzelstaatlichen Alkoholpolitik weiter nachdrücklich zu unterstützen; |
|
— |
die erforderlichen Schritte einzuleiten, um sicherzustellen, dass das Ziel der Verringerung alkoholbedingter gesundheitlicher und sozialer Schäden bei der Festlegung und Durchführung aller einschlägigen Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen berücksichtigt wird; |
|
— |
erforderlichenfalls weitere Schritte zu erwägen, um Kinder, Jugendliche und junge Menschen vor alkoholbedingten Schäden zu schützen und insbesondere den Alkoholkonsum von Minderjährigen, das Rauschtrinken und den Einfluss des Marketings für Alkohol zu verringern sowie die Schäden zu vermindern, die Kinder davontragen, die in Familien mit Alkoholproblemen aufwachsen; |
|
— |
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten den Kenntnisstand in Bezug auf grenzüberschreitende Probleme im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken zu verbessern, die derzeit in der EU durch illegalen Handel, grenzüberschreitende Vermarktung oder Preisunterschiede im Einzelhandel entstehen; |
|
— |
den Kenntnisstand in Bezug die Auswirkungen von Alkohol am Arbeitsplatz und Möglichkeiten zu verbessern, wie schädlicher Alkoholkonsum im breiteren Rahmen der Unfall- und Krankheitsprävention und der Gesundheitsförderung begegnet werden kann; |
|
— |
dem Rat spätestens 2012 über die Fortschritte und Ergebnisse der Arbeit der Kommission sowie die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, von denen sie Mitteilung erhalten hat, Bericht zu erstatten; |
|
— |
Prioritäten für die nächste Phase der Arbeit der Kommission im Bereich Alkohol und Gesundheit nach dem Ende der derzeitigen Strategie im Jahr 2012 festzulegen. |
(1) Dok. 8756/00.
(2) Empfehlung 2001/458/EG des Rates vom 5. Juni 2001 zum Alkoholkonsum von jungen Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen (ABl. L 161 vom 16.6.2001, S. 38).
(3) Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 2001 zu einer Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der schädlichen Wirkungen des Alkohols (ABl. C 175 vom 20.6.2001, S. 1).
(4) Schlussfolgerungen des Rates vom 1.—2. Juni 2004„Die Problematik Alkohol und junge Menschen“ (Dok. 9881/04).
(5) Schlussfolgerungen des Rates über eine EU-Strategie zur Verringerung alkoholbedingter Schäden, 30. November—1. Dezember 2006 (Dok. 16165/06).
(6) Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2006 (Dok. 14851/06).
(7) Rechtssachen Franzen (C-89/95), Heinonen (C-394/97), Gourmet (C-405/98), Cataluña (verbundene Rechtssachen C-1/90 und C-176/90), Loi Evin (verbundene Rechtssachen C-262/02 und C-429/02).
(8) WHO-Regionalbüro für Europa, „Alcohol in Europe“ (2006).
(9) Alcohol in Europe — A public health perspective, Institute of Alcohol Studies, UK 2006, auf der Grundlage der Studie der WHO „Global Burden of Disease“, Rehm et al. (2004 und 2005).
(10) Alkoholstrategie der EU, Europäische Kommission (2006).
(11) Alkoholstrategie der EU, Europäische Kommission (2006) und Folgenabschätzung.
(12) Wissenschaftliche Stellungnahme der wissenschaftlichen Fachgruppe des Europäischen Forums „Alkohol und Gesundheit“ (2009) und „Impact of Alcohol Advertising and Media Exposure on Adolescent Alcohol Use:
A Systematic Review of Longitudinal Studies“ (2009).
(13) Quelle: Eurostat, Berechnungen Rabinovich L. et.al.
(14) Rabinovich L. et al. (2009) „The affordability of alcoholic beverages in the EU: understanding the link between alcohol affordability, consumption and harms“.
(15) WHO-Kommission für soziale Determinanten und Alkohol: „Equity and Social Determinants“, Hintergrunddokument der WHO zur internationalen Expertentagung zum Thema Alkohol, Gesundheit und soziale Entwicklung, 23. September 2009, http://www.who.int/social_determinants/final_report/en/index.html
(16) Mats H. et al., „Alcohol consumption among elderly European Union citizens“ (2009).
(17) Rehm et al., Alcohol, Social Development and Infectious Disease (2009).
(18) Regionale Konsultation der WHO, Kopenhagen, 20.—23. April 2009 http://www.who.int/substance_abuse/activities/globalstrategy/en/index.html
(19) Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2006 (Dok. 14851/06, S. 4).
Kommission
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/19 |
Euro-Wechselkurs (1)
11. Dezember 2009
2009/C 302/08
1 Euro =
|
|
Währung |
Kurs |
|
USD |
US-Dollar |
1,4757 |
|
JPY |
Japanischer Yen |
131,13 |
|
DKK |
Dänische Krone |
7,4420 |
|
GBP |
Pfund Sterling |
0,90515 |
|
SEK |
Schwedische Krone |
10,4490 |
|
CHF |
Schweizer Franken |
1,5125 |
|
ISK |
Isländische Krone |
|
|
NOK |
Norwegische Krone |
8,4435 |
|
BGN |
Bulgarischer Lew |
1,9558 |
|
CZK |
Tschechische Krone |
25,727 |
|
EEK |
Estnische Krone |
15,6466 |
|
HUF |
Ungarischer Forint |
273,12 |
|
LTL |
Litauischer Litas |
3,4528 |
|
LVL |
Lettischer Lat |
0,7068 |
|
PLN |
Polnischer Zloty |
4,1457 |
|
RON |
Rumänischer Leu |
4,2568 |
|
TRY |
Türkische Lira |
2,2058 |
|
AUD |
Australischer Dollar |
1,6076 |
|
CAD |
Kanadischer Dollar |
1,5481 |
|
HKD |
Hongkong-Dollar |
11,4373 |
|
NZD |
Neuseeländischer Dollar |
2,0274 |
|
SGD |
Singapur-Dollar |
2,0495 |
|
KRW |
Südkoreanischer Won |
1 718,14 |
|
ZAR |
Südafrikanischer Rand |
11,0255 |
|
CNY |
Chinesischer Renminbi Yuan |
10,0755 |
|
HRK |
Kroatische Kuna |
7,2810 |
|
IDR |
Indonesische Rupiah |
13 936,05 |
|
MYR |
Malaysischer Ringgit |
5,0166 |
|
PHP |
Philippinischer Peso |
68,082 |
|
RUB |
Russischer Rubel |
44,3730 |
|
THB |
Thailändischer Baht |
48,868 |
|
BRL |
Brasilianischer Real |
2,5846 |
|
MXN |
Mexikanischer Peso |
19,0144 |
|
INR |
Indische Rupie |
68,7100 |
(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/20 |
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Linienflugverkehr
(Text von Bedeutung für den EWR)
2009/C 302/09
|
Mitgliedstaat |
Frankreich |
|||||||
|
Flugstrecken |
Pointe-à-Pitre–La Désirade Pointe-à-Pitre–Les Saintes Pointe-à-Pitre–Marie-Galante Pointe-à-Pitre–Saint-Barthélemy Pointe-à-Pitre–Saint-Martin (Grand Case) |
|||||||
|
Datum des Inkrafttretens der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen |
Aufhebung |
|||||||
|
Anschrift, bei der der Text und andere einschlägige Informationen und/oder Unterlagen im Zusammenhang mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen angefordert werden können |
Erlass vom 10. November 2009 zur Aufhebung der im Linienflugverkehr zwischen Pointe-à-Pitre und La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Martin (Grand Case) bzw. Saint-Barthélemy auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen NOR: DEVA0926582A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Ansprechpartner:
|
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/21 |
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Linienflugverkehr
(Text von Bedeutung für den EWR)
2009/C 302/10
|
Mitgliedstaat |
Frankreich |
|||||||
|
Flugstrecken |
Clermont–Ferrand–Lille Clermont–Ferrand–Marseille Clermont–Ferrand–Straßburg Clermont–Ferrand–Toulouse |
|||||||
|
Datum des Inkrafttretens der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen |
1. Januar 2010 |
|||||||
|
Anschrift, bei der der Text und andere einschlägige Informationen und/oder Unterlagen im Zusammenhang mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen angefordert werden können |
Erlass vom 26. November 2009 zur Auferlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen Clermont-Ferrand und Lille NOR: DEVA0925650A Erlass vom 26. November 2009 zur Auferlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen Clermont-Ferrand und Marseille NOR: DEVA0925656A Erlass vom 26. November 2009 zur Auferlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen Clermont-Ferrand und Straßburg NOR: DEVA0925660A Erlass vom 26. November 2009 zur Auferlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen Clermont-Ferrand und Toulouse NOR: DEVA0925664A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Für weitere Auskünfte:
|
V Bekanntmachungen
VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK
Kommission
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/22 |
Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe)
Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
(Text von Bedeutung für den EWR)
2009/C 302/11
|
1. |
Am 3. Dezember 2009 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen AXA LBO FUND IV (Frankreich), das letztlich vom AXA-Konzern („AXA“, Frankreich) kontrolliert wird, erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung durch Erwerb von Anteilen die alleinige Kontrolle über das Unternehmen Home Shopping Europe GmbH („HSE“, Deutschland). |
|
2. |
Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:
|
|
3. |
Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich vor. Dieser Fall kommt für das vereinfachte Verfahren im Sinne der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) in Frage. |
|
4. |
Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen. Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach Veröffentlichung dieser Anmeldung eingehen. Sie können der Kommission unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe per Fax (+32 22964301 oder 22967244) oder per Post an folgende Anschrift übermittelt werden:
|
(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. C 56 vom 5.3.2005, S. 32.
|
12.12.2009 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 302/s3 |
HINWEIS
Am 12. Dezember 2009 wird im Amtsblatt der Europäischen Union C 302 A der „Gemeinsame Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — 28. Gesamtausgabe“ erscheinen.
Die Abonnenten des Amtsblatts erhalten unentgeltlich die der Zahl und der/den Sprachfassung(en) ihrer Abonnements entsprechenden Exemplare. Sie werden gebeten, den unten stehenden Bestellschein ordnungsgemäß ausgefüllt und mit ihrer „Matrikelnummer“ (dem Code, der links auf jedem Etikett erscheint und mit O/… beginnt) versehen zurückzusenden. Die kostenlose Bereitstellung des Amtsblatts wird während eines Jahres ab dem jeweiligen Erscheinungsdatum gewährleistet.
Nichtabonnenten können dieses Amtsblatt kostenpflichtig bei einem unserer Vertriebsbüros beziehen (http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm).
Das Amtsblatt kann ebenso wie sämtliche anderen Amtsblätter (L, C, C A, C E) kostenlos über die Internet-Site http://eur-lex.europa.eu abgefragt werden.
