ISSN 1977-088X
doi:10.3000/1977088X.C_2013.356.deu
Amtsblatt
der Europäischen Union
C 356
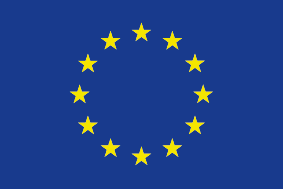
Ausgabe in deutscher Sprache
Mitteilungen und Bekanntmachungen
56. Jahrgang
5. Dezember 2013
|
ISSN 1977-088X doi:10.3000/1977088X.C_2013.356.deu |
||
|
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356 |
|
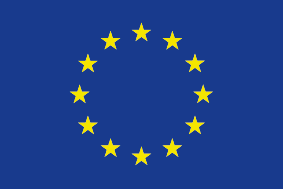
|
||
|
Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
56. Jahrgang |
|
|
III Vorbereitende Rechtsakte |
|
|
|
AUSSCHUSS DER REGIONEN |
|
|
|
103. Plenartagung vom 7.-9. Oktober 2013 |
|
|
2013/C 356/16 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Viertes Eisenbahnpaket |
|
|
2013/C 356/17 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze |
|
|
2013/C 356/18 |
||
|
DE |
|
I Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen
ENTSCHLIESSUNGEN
Ausschuss der Regionen
103. Plenartagung vom 7.-9. Oktober 2013
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/1 |
Entschließung des Ausschusses der Regionen zur 19. Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention — Die internationale Klimaschutzagenda voranbringen
2013/C 356/01
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
erklärt seine volle Unterstützung für den gemeinsamen EU-Standpunkt und ruft alle an der 19. Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention beteiligten Parteien auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um spätestens 2015 ein rechtsverbindliches internationales Klimaschutzübereinkommen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad zu unterzeichnen und dieses bis 2020 umzusetzen; |
|
2. |
fordert die Verhandlungsführer der EU auf, sich auf die Dringlichkeit des Anliegens zu besinnen und auf eine ambitionierte Gestaltung des neuen Übereinkommens hinzuwirken; |
|
3. |
weist nachdrücklich darauf hin, dass die nationalen Regierungen und die EU ihre Zielvorgaben nur bei einer aktiven Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erreichen können, da diese am unmittelbarsten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen und weitgehend für die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen zuständig sind; betont daher den Bedarf an territorial differenzierten Daten über die Auswirkungen des Klimawandels und über Anpassungsstrategien; |
|
4. |
fordert die Aufnahme der Klimaschutzmaßnahmen in alle Bereiche und Haushalte auf allen Verwaltungsebenen und weist darauf hin, dass viele reformbedürftige Bereiche wie Energie, Landwirtschaft, Gebäudewirtschaft, Raumplanung, Abfallwirtschaft und Verkehr in die Zuständigkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften fallen; |
|
5. |
fordert daher die internationalen Einrichtungen und die Delegation der EU auf, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zentral in die internationalen Klimaschutzverhandlungen und Umsetzungsprozesse einzubinden und anzuerkennen, dass sie bei diesen Verhandlungen eine unterstützende Rolle spielen können; |
|
6. |
begrüßt den Vorschlag des UN-Generalsekretärs, im September 2014 einen Weltklimagipfel der Staats- und Regierungschefs einzuberufen; hält im Hinblick auf die Wirksamkeit dieses Gipfels eine Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften für notwendig; |
|
7. |
weist darauf hin, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre mittlerweile die kritische Schwelle von 400 ppm überschreitet, und äußert zudem seine große Besorgnis über die „Gigatonnen-Lücke“ zwischen den von den Verhandlungsführern bereits beschlossenen Maßnahmen und den Maßnahmen, die noch ergriffen werden müssen, um die Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen; |
|
8. |
anerkennt die Ungewissheit im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Klimamodellen und die Erfüllung der Reduktionsziele und spricht sich daher für die Anwendung des Vorsichtsprinzips auf die Anpassungsmaßnahmen aus, die auf die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs um mehr als 2 °C ausgerichtet sind; |
|
9. |
teilt die Ansicht, dass das für 2015 erwartete UN-Klimaschutzübereinkommen nicht nur Maßnahmen zur Eindämmung, sondern auch zur Anpassung beinhalten sollte, die seiner Ansicht nach gleichrangig vorangetrieben werden sollten; |
|
10. |
fordert die Verhandlungsführer auf, die Mittelzusagen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für den Klimafonds (Green Climate Fund) einzuhalten und das Konzept der „Verluste und Schäden“ wie auf der Vertragsstaatenkonferenz 2012 in Doha vereinbart in die Praxis umzusetzen; |
|
11. |
begrüßt die Fortschritte auf dem Gebiet des Waldschutzes und fordert weitere Fortschritte, insbesondere bei den methodologischen Aspekten des UN-Programms zur Verringerung von Emissionen durch Entwaldung und Schädigung von Wäldern (REDD+); stellt zudem fest, dass die finanziellen Möglichkeiten in diesem Bereich entsprechend aufgestockt werden sollten; |
|
12. |
unterstreicht die wesentliche Bedeutung des Bereichs Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) bei der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels, verweist jedoch nachdrücklich darauf, dass dabei der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums und der Ernährungssicherheit insbesondere in Entwicklungsländern Rechnung getragen werden muss; |
|
13. |
bekräftigt, dass die Stärkung der Klimaresilienz — insbesondere der besonders vulnerablen Regionen der Welt und Bevölkerungsgruppen — von ganz entscheidender Bedeutung ist, wenn dieses Übereinkommen gerecht sein soll; |
|
14. |
fordert, die künftigen Emissionsreduktionen und alle anderen Klimaschutzmaßnahmen in gerechter Weise auf die gesamte Staatengemeinschaft zu verteilen, wobei es die unterschiedlichen Fähigkeiten und Ausgangspositionen der Staaten und Regionen gebührend zu berücksichtigen gilt; |
|
15. |
fordert in diesem Zusammenhang auch eine umfassende strukturelle Reform des EU-Emissionshandelssystems; |
|
16. |
stellt fest, dass dringend Synergie-Effekte zwischen Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen genutzt werden müssen, indem Erfahrungen und bewährten Praktiken ausgetauscht und Forschung, Innovation sowie strategische Koordinierung gefördert werden; |
|
17. |
betont, dass die EU gezeigt hat, dass eine Entkopplung der CO2-Emissionen vom BIP-Wachstum möglich ist; bekräftigt, dass die EU durch Verwirklichung ehrgeiziger und verbindlicher Ziele, wie sie sie sich zur Verringerung der CO2-Emissionen und in den Bereichen erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz gesetzt hat, weiter mit gutem Beispiel vorangehen muss; |
|
18. |
hebt die Anstrengungen der Städte und Regionen aus ganz Europa hervor, die lokale oder regionale Klima- und Energiestrategien oder Initiativen für ambitionierte Ziele auf nationaler Ebene beschlossen haben, wie z.B. „die Grünen Hauptstädte Europas“ oder der Bürgermeisterkonvent, dessen Unterzeichner sich verpflichtet haben, die CO2-Emissionen bis 2020 um mindestens 20 % zu senken; |
|
19. |
fordert, die Anstrengungen der Städte und Regionen im Rahmen von Anrechnungssystemen zur Messung, Berichterstattung und Nachprüfung (MRV) anzuerkennen und zu verbuchen; |
|
20. |
fordert einen stärkeren weltweiten Informationsaustausch und bekräftigt seine Verpflichtungen im Rahmen der gemeinsamen Absichtserklärung, die der AdR und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) unterzeichnet haben, um Synergien zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen zu fördern und die Durchführung multilateraler Umweltübereinkommen zu verbessern; bekräftigt in diesem Zusammenhang auch seine Verpflichtungen im Rahmen der gemeinsamen Absichtserklärung mit der US-Bürgermeisterkonferenz und im Rahmen der künftigen Vereinbarung mit den Bürgermeistern Chinas; |
|
21. |
dringt darauf, dass künftige EU-Strategien das Potenzial der multilateralen dezentralen Zusammenarbeit mit Drittländern nutzen, und verweist dabei auf die Instrumente, die er eigens für diese Zusammenarbeit entwickelt hat; |
|
22. |
spricht sich dafür aus, den Klimaschutzkriterien in den verschiedenen Finanzinstrumenten der EU, darunter auch in der europäischen Entwicklungspolitik, in vollem Umfang Rechnung zu tragen; |
|
23. |
verweist auf die Tatsache, dass den subnationalen Verwaltungsebenen und lokalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Vereinbarung von Cancún größerer Stellenwert beigemessen wurde, und fordert erneut einen Multi-Level-Governance-Ansatz in der globalen Umweltpolitik; verlangt daher von den Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention klare Zusagen hinsichtlich der Einbeziehung und Unterstützung der subnationalen Verwaltungsebenen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung der Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenz nach dem Beispiel des Beschlusses X/22 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt; |
|
24. |
beauftragt den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, dem Präsidenten des Europäischen Rates, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, dem litauischen EU-Ratsvorsitz sowie dem künftigen litauischen Ratsvorsitz und dem Sekretariat der Klimarahmenkonvention zu übermitteln. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
STELLUNGNAHMEN
Ausschuss der Regionen
103. Plenartagung vom 7.-9. Oktober 2013
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/3 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Empfehlungen für eine bessere Mittelverwendung
2013/C 356/02
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
hebt die Bedeutung der lokalen und regionalen Haushalte für die öffentlichen Ausgaben in der Europäischen Union hervor. In diesem Sinne hält der AdR es für angemessen, die Mittel der Kohäsionspolitik als Investitionen und nicht als einfache öffentliche Ausgaben zu analysieren; |
|
— |
ist der Auffassung, dass eine wirksamere und effizientere Mittelzuweisung für eine bessere Mittelverwendung nicht ausreicht, sondern dass es erforderlich ist, die territorialen Unterschiede und die Hindernisse zu berücksichtigen, die das Wachstum in bestimmten Regionen beeinträchtigen können, die Auswirkungen auf die entsprechenden Maßnahmen zu analysieren und zu eruieren, wie sich die Folgen für die Wirkung der Kohäsionspolitik verringern lassen; |
|
— |
unterstreicht, dass die Multi-Level-Governance und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen von grundlegender Bedeutung für eine bessere Verwendung der Mittel mit Blick auf die Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie sind; |
|
— |
weist erneut darauf hin, dass die Ex-ante-Auflagen auf direkt mit der Durchführung der Kohäsionspolitik verbundene Bereiche beschränkt sein sollten und die Kohäsionspolitik nicht mit Zuständigkeiten überfrachtet werden sollte, die nicht in ihren Bereich fallen und zur Erhöhung des bürokratischen Aufwands beitragen; |
|
— |
bekräftigt, dass er makroökonomische Auflagen entsprechend der Position des Europäischen Parlaments entschieden ablehnt; |
|
— |
bedauert, dass der Rat auf der Leistungsreserve besteht; schlägt stattdessen erneut die Einrichtung einer Flexibilitätsreserve aus automatisch freigegebenen Mitteln vor; |
|
— |
schlägt folgende mögliche Vereinfachungsmechanismen für die Verwaltung vor: die Vereinheitlichung der Verfahren und die Standardisierung von Dokumenten, die Nutzung gemeinsamer IT-Tools sowie die Einführung zentraler Anlaufstellen, durch die sich Arbeitsvorgänge zwischen den Abteilungen ein und derselben Verwaltung vermeiden lassen. |
|
Berichterstatter |
Alberto NUÑEZ FEIJÓO (ES/EVP), Präsident der Autonomen Gemeinschaft Galicien |
Referenzdokument
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Rolle der Kohäsionspolitik und der lokalen und regionalen Haushalte
|
1. |
hebt die bisherige Bedeutung der Kohäsionspolitik für den Konvergenzprozess zwischen den Regionen der Europäischen Union hervor und unterstreicht ihre künftige Rolle als grundlegende Komponente für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Inangriffnahme des Problems des sozialen und territorialen Zusammenhalts, durch die sie zur Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie beitragen wird. In der Tat machen die Strukturfonds in sechs Mitgliedstaaten mehr als 60% und in sieben Mitgliedstaaten zwischen 30% und 60% der gesamten öffentlichen Investitionen aus; |
|
2. |
hebt die Bedeutung der lokalen und regionalen Haushalte für die öffentlichen Ausgaben in der Europäischen Union hervor, die 2011 bei 16,7% des BIP lagen und damit 34% der Gesamtausgaben der EU auf sich vereinen, und streicht die Direktinvestitionen in diesen Haushalten heraus, die ein Schlüsselelement für eine rasche Erholung der Wirtschaft darstellen. In diesem Sinne hält der AdR es für angemessen, die Mittel der Kohäsionspolitik als Investitionen und nicht als einfache öffentliche Ausgaben zu analysieren; |
Allgemeine Aspekte einer besseren Mittelverwendung
|
3. |
ist der Auffassung, dass eine wirksamere und effizientere Mittelzuweisung für eine bessere Mittelverwendung nicht ausreicht, sondern dass es erforderlich ist, die territorialen Unterschiede und die Hindernisse zu berücksichtigen, die das Wachstum in bestimmten Regionen beeinträchtigen können, die Auswirkungen auf die entsprechenden Maßnahmen zu analysieren und zu eruieren, wie sich die Folgen für die Wirkung der Kohäsionspolitik verringern lassen; |
|
4. |
weist darauf hin, dass eines der zu berücksichtigenden Elemente der Anreizeffekt der Ausgabenkonzentration in bestimmten Bereichen ist, was insbesondere Wissen, Bildung, Forschung und Innovation betrifft. Angemessenes Handeln in diesen Bereichen wird eine Hebelwirkung auf die übrige Wirtschaft der Regionen haben; |
|
5. |
sieht öffentliche Investitionen als eine zwischen allen Regierungs- und Verwaltungsebenen geteilte Zuständigkeit an und begrüßt den Vorschlag der OECD für eine Empfehlung zu den Grundprinzipien für wirksame öffentliche Investitionen (1); empfiehlt, diese Grundprinzipien auf EU-Ebene anzunehmen, und schlägt vor, ihre Anwendung regelmäßig zu überprüfen, indem vom AdR erarbeitete Indikatoren für die Multi-Level-Governance hinzugezogen werden; |
Koordinierung der Maßnahmen
|
6. |
hält den integrierten Ansatz des Gemeinsamen Strategischen Rahmens für den neuen Programmplanungszeitraum, bei dem die gesamten verfügbaren Mittel für regionale Zwecke verwendet werden, für positiv, weist jedoch auf das Problem der Koordinierung der Maßnahmen hin, da die in der Verordnung im Rahmen der Vorschläge für gemeinsame Bestimmungen angeführten thematischen Ziele nicht mit den sechs Prioritäten des ELER und des EMFF übereinstimmen; |
|
7. |
weist erneut auf die Schnittstellen der Kohäsionspolitik und der Europa-2020-Strategie sowie die Gültigkeit der globalen Ziele zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand sind nach wie vor uneingeschränkt aktuell) hin. In diesem Sinne ist der Impuls der Kohäsionspolitik für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie für das Wissen äußerst wichtig: So konnten innovative Projekte entwickelt, der gemeinschaftliche Mehrwert gesteigert und die Bedeutung der Koordinierung der Programme und Instrumente zur Finanzierung der Kohäsionspolitik mit innovations- und forschungspolitischen Maßnahmen verdeutlicht werden; |
|
8. |
erinnert daran, wie wichtig es ist, die dank der Kohäsionspolitik erreichten Ergebnisse zu überwachen, um ihre Wirkung messen zu können. Jede Maßnahme muss quantifizierbar sein und sollte anhand von Ergebniskriterien analysiert werden, um ihren Beitrag zur regionalen und lokalen Entwicklung bewerten zu können. Andererseits vereinfacht ein zielorientierter, statt auf Subventionierungskriterien ausgerichteter Ansatz es den Regionen, Instrumente und Maßnahmen auszuwählen und sie an ihre Bedürfnisse anzupassen; |
Governance und Dezentralisierung
|
9. |
unterstreicht, dass die Multi-Level-Governance und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen von grundlegender Bedeutung für eine bessere Verwendung der Mittel mit Blick auf die Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie sind. Insofern hat der AdR mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass die Multi-Level-Governance und das Partnerschaftsprinzip zu den horizontalen Grundsätzen des Gemeinsamen Strategischen Rahmens gehören, und verpflichtet sich, sich zu dem Entwurf eines Vorschlags der Kommission für den in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (Gemeinsame Bestimmungen) vorgesehenen europäischen Verhaltenskodex zu äußern, um die aktive Beteiligung der lokalen und regionalen Behörden, der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Organisationen der Zivilgesellschaft an allen Phasen des Programmplanungszyklus zu fördern; |
|
10. |
bekräftigt, dass eine stärkere Dezentralisierung der Planungs- und Programmierungsaufgaben sowie die dezentrale Umsetzung aufgrund ihrer größeren Bürgernähe sowohl erheblich kostengünstiger sind als auch wesentlich bessere Dienstleistungen zeitigen. Außerdem bieten sie große Vorteile bei der Feststellung der Bedürfnisse und Wünsche sowie bei der Konzipierung der politischen Maßnahmen zur Stärkung des nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wachstums und fördern gleichzeitig Selbstverwaltung und lokale Demokratie; |
|
11. |
vertritt die Auffassung, dass die Dezentralisierung über die regionalen und lokalen Behörden eine entscheidende Rolle für den Abbau des wirtschaftlichen und sozialen Gefälles zwischen den Regionen in Europa spielt und so dazu beiträgt, die negative Wirkung der Landflucht aus den armen Regionen in die großen städtischen Ballungsräume sowie die den Arbeitsmarkt schwächende Migration von einem Mitgliedstaat zu einem anderen abzumildern; weist darauf hin, dass eine vorausschauende langfristige und jährliche Planung und Gestaltung von Investitionen in den Regionen wichtig für zielgerichtetere und wirksame Investitionen ist. Ein von der Basis ausgehender Ansatz ist von entscheidender Bedeutung für die bessere Planung von nationalen Investitionsprogrammen und Entwicklungsplänen; |
|
12. |
weist darauf hin, dass der Mehrwert der Ausgaben der Europäischen Union von den spezifischen Hemmnissen der einzelnen Regionen abhängt und folglich keine gemeinsame, allgemein auf alle Regionen anwendbare Strategie eingeführt werden kann, was eine gewisse Flexibilität des regulatorischen Rahmens für den Programmplanungszeitraum unabdingbar macht; |
|
13. |
hält es für die Erreichung der verfolgten Ziele unabhängig von den Unterschieden zwischen den Regionen für unerlässlich, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Zeitraum 2014-2020 eng in die Umsetzung der Fonds einzubinden, von der Erarbeitung des für sie geltenden regulatorischen Rahmens bis zur Durchführung der Maßnahmen; |
|
14. |
empfiehlt, die Verwaltung auf regionaler und lokaler Ebene zu dezentralisieren, was die Koordinierung und Komplementarität steigern und einen auf den Bedürfnissen und Merkmalen des jeweiligen Gebiets fußenden Bottom-up-Ansatz gewährleisten wird. Zudem erhalten die mit der Durchführung der Maßnahmen beauftragten lokalen und regionalen Gebietskörperschaften durch diese Dezentralisierung die Zuständigkeiten, die allen für die operationellen Programmen verantwortlichen Behörden erteilt werden; |
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
|
15. |
betont, dass das Subsidiaritätsprinzip im Vertrag von Lissabon konsolidiert wurde, und bekräftigt, dass der auf der Subsidiarität beruhende Ansatz der Kohäsionspolitik gewahrt und weiterentwickelt werden muss, um die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in allen Phasen der Strukturmaßnahmen zu stärken; |
|
16. |
setzt auf die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in Kombination mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur im Hinblick auf größere Effizienz: So muss beispielsweise das derzeitige dezentrale System zur Erarbeitung operationeller Programme erhalten oder sogar gestärkt werden, damit die regionale und lokale Selbstverwaltung bei der praktischen Umsetzung der europäischen Kohäsionspolitik einen Impuls erhält. Dies wird eine besser an die Bedürfnisse und Prioritäten der einzelnen Regionen angepasste Programmplanung zur Folge haben; |
|
17. |
ist der Meinung, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei den in den Regionen durchgeführten Programmen und Maßnahmen möglichst viele Kompetenzen ausüben müssen, um einen echten integrierten territorialen (place-based) Ansatz zu erreichen. Denn sie sind die am besten geeigneten Gesprächspartner für die auf europäischer Ebene für die Fonds zuständigen Stellen und können die europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Initiativen miteinander verbinden; |
Auflagenbindung und Kohäsionspolitik
|
18. |
weist erneut darauf hin, dass die Ex-ante-Auflagen auf direkt mit der Durchführung der Kohäsionspolitik verbundene Bereiche beschränkt sein sollten und die Kohäsionspolitik nicht mit Zuständigkeiten überfrachtet werden sollte, die nicht in ihren Bereich fallen und zur Erhöhung des bürokratischen Aufwands beitragen; |
|
19. |
bekräftigt die Position, die er bereits zu dem Entwurf einer allgemeinen Verordnung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 zur Kohäsionspolitik bezogen hat, wobei er betonte, dass der Großteil der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nicht für die Erreichung der Ziele der wirtschaftspolitischen Steuerung zuständig ist, weshalb die Anwendung der makroökonomischen Auflagen auf nationaler Ebene zu einer weniger fairen Kohäsionspolitik führen und gleichzeitig Ungewissheit über die Finanzierung künftiger neuer Projekte schaffen würde; |
|
20. |
bekräftigt, dass er makroökonomische Auflagen entsprechend der Position des Europäischen Parlaments entschieden ablehnt; |
Überwachungsmechanismen
|
21. |
setzt auf einen differenzierten Ansatz bei der Verwendung qualitativer und quantitativer Ergebnisindikatoren, die relevant und angemessen ausgewählt sein müssen, auf die Ergebnisse der Projekte und den langfristigen Nutzen anstelle theoretischer Annahmen abstellen und darauf ausgerichtet sind, die Kriterien zur Bewertung der Ergebnisse der im Rahmen der Fonds ergriffenen Maßnahmen auf europäischer Ebene zu harmonisieren; |
|
22. |
unterstützt ausdrücklich die Evaluierungskultur, die eine ständige Verbesserung der Qualität der Strategien und Verfahren ermöglicht, und empfiehlt den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahrensweisen zwischen nationalen und lokalen Behörden in ganz Europa. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt der AdR vor, eine Datenbank einzurichten, in der bewährte Verfahrensweisen und beste verfügbare Technologien gesammelt werden, die aus den Fonds des Gemeinsamen Strategischen Rahmens finanziert werden; |
Reserven
|
23. |
bedauert, dass der Rat auf der Leistungsreserve besteht; schlägt stattdessen erneut die Einrichtung einer Flexibilitätsreserve aus automatisch freigegebenen Mitteln vor, damit die politischen Entscheidungsträger die Strategie mittelfristig ausrichten können, wodurch ein Anreiz besteht, die Ausgaben für die operationellen Programme zu tätigen, für die sie ursprünglich vorgesehen waren; |
Integrierte territoriale Investitionen
|
24. |
ist der Auffassung, dass die Möglichkeit, mit Hilfe der integrierten territorialen Investitionen Strategien zu konzipieren und anzuwenden, über die bereichsübergreifende Maßnahmen durchgeführt werden können, die mittels einem oder mehreren Schwerpunkten oder Programmen finanziert werden, dazu beitragen wird, dass die ausgewählten Projekte eine größere reale Wirkung auf das Gebiet haben, in dem sie stattfinden, und gleichzeitig die Mittel durch größere Ausgabeneffizienz mit höherem Mehrwert eingesetzt werden; |
Programmverwaltung
|
25. |
teilt den Gedanken, die Finanzinstrumente und Subventionen als ergänzende Instrumente zu kombinieren, die zu einer ausgewogenen regionalen Entwicklung und zu intelligentem Wachstum beitragen; ihr sinnvoll kombinierter Einsatz muss das Fundament für die Investitionspolitik im Zeitraum 2014-2020 bilden. In diesem Sinne hat sich auch das Europäische Zentrum für politische Studien (CEPS) in einem Bericht für das Europäische Parlament geäußert, in dem es erklärt, dass die innovativen Finanzinstrumente nicht die Beihilfen ersetzen dürfen und nur für rentable Projekte geeignet sind; |
|
26. |
ist der Meinung, dass sich während der Umsetzung der Mehrjahresrahmen Aspekte ergeben, durch die sich die ursprünglichen Ziele und Prioritäten ändern, sodass, obwohl häufige Umdisponierungen nicht wünschenswert sind, mehr Möglichkeiten bestehen sollten, intern einen Teil der Programmmittel umzuschichten. Eine solche Umschichtung darf auf keinen Fall die ursprünglichen Ziele beeinträchtigen, sie muss in Proportionen vorgenommen werden, die die Konkretisierung dieser Ziele nur unerheblich ändert und gleichzeitig ihre Anpassung an die neuen Gegebenheiten der Region ermöglicht; |
Vereinfachung
|
27. |
vertritt die Auffassung, dass sich die angekündigten Vereinfachungen im Zeitraum 2007-2013 nicht eingestellt haben, sondern im Gegenteil unverhältnismäßige Kosten entstanden sind, obwohl die Anwendungsanforderungen und die Finanzkontrollbestimmungen verschärft wurden. Deshalb bekräftigt der AdR die Notwendigkeit, eine echte Verringerung des bürokratischen Aufwands vorzunehmen und den Großteil der Bemühungen auf die Programmverwaltung zu konzentrieren. Diese Vereinfachung muss sowohl die Kommission als auch die potenziellen Begünstigten betreffen und mit den unabdingbaren Anforderungen für die Prüfung und Kontrolle der Maßnahmen sowie mit der Einhaltung der Garantien für die Begünstigten vereinbart werden; |
|
28. |
ist überzeugt, dass alle Vereinfachungsmaßnahmen, die auf EU-Ebene ergriffen werden, sich nur unerheblich auf die Programmverwaltung auswirken, wenn sie nicht mit tatsächlichen Vereinfachungsmaßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene gemäß den Befugnissen der jeweiligen Verwaltung einhergehen; |
|
29. |
schlägt folgende mögliche Vereinfachungsmechanismen für die Verwaltung vor: die Vereinheitlichung der Verfahren und die Standardisierung von Dokumenten, die Nutzung gemeinsamer IT-Tools sowie die Einführung zentraler Anlaufstellen, durch die sich Arbeitsvorgänge zwischen den Abteilungen ein und derselben Verwaltung vermeiden lassen; |
|
30. |
empfiehlt die allgemeine Nutzung der elektronischen Verwaltung, die ein grundlegendes Element für die Verwendung der Mittel und die Beziehungen zwischen einerseits den Begünstigten, echten Wohlstandsförderern, und andererseits den Behörden und Trägern der verschiedenen Maßnahmen darstellen kann; |
|
31. |
empfiehlt die Alternative der Standardkosten für die Genehmigung und Rechtfertigung der Ausgaben, die einen geringeren Verwaltungsaufwand erfordert und die mit den Maßnahmen verfolgten Ziele nicht beeinflusst; |
|
32. |
weist erneut auf die Möglichkeit hin, auch andere bürokratische Vorgänge mit Hilfe von vereinfachten Berichten und Kontrollen für die Messung der Fortschritte, den Nachweis der Zuverlässigkeit der Prüfungs- und Kontrollverfahren sowie die Kontrolle und das Audit der Programme zu verringern; |
|
33. |
erinnert an den Nutzen der Monofondsprogramme, durch die sich die Genehmigungs- und Überprüfungsverfahren im Vergleich zu den integrierten Programmen vereinfachen lassen, sowie die Vorteile der operationellen Programme auf der Grundlage verschiedener Fonds. Diese ermöglichen es, die positive Wirkung der EU-Maßnahmen in den Regionen zu maximieren, indem die durch die verschiedenen Entwicklungsinstrumente geschaffenen Möglichkeiten in integrierter Form genutzt werden; |
|
34. |
weist darauf hin, dass die Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften in einzelstaatliches Recht einen möglichen Konfliktherd für die Verwaltung der Finanzmittel darstellt, weshalb der AdR von den zuständigen Behörden bei der Erarbeitung der Bestimmungen äußerste Strenge fordert, insbesondere bei denjenigen, die eine horizontale Wirkung auf die Programme haben, wie das bei der Auftragsvergabe oder Subventionen der Fall ist; |
|
35. |
ist der Meinung, dass aufgrund der engen Verbindung der Kohäsionspolitik mit den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bei jeglicher Reform besonders auf die Vereinbarkeit der Finanzierungsmechanismen zu achten ist und kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand für die Programmverwaltung entstehen darf; |
|
36. |
bekräftigt, dass ein klarer Rahmen für die Anwendung der Bestimmungen für staatliche Beihilfen auf die Finanzinstrumente und die öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) sinnvoll ist, durch den Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Projektdurchführung vermieden werden; |
|
37. |
schlägt vor, die Vereinfachung zu nutzen, die die Kommission durch die Beschränkung der Zahl der Kriterien für die Zuschussfähigkeit bei bestimmten Maßnahmen eingeführt hat. Dazu plädiert der AdR dafür, in die Verfahren zur Projektauswahl Indikatoren einzuführen, mittels derer sich sowohl der Effekt der Investition als auch die Projektreife analysieren lassen, um die Mittel effizienter zuweisen zu können und den Projekten mit höherem Mehrwert und rascherer wirtschaftlicher Wirkung den Vorrang zu geben. Wesentlich für den langfristigen Erfolg von Investitionen ist die Stärkung der administrativen Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften, vor allem wenn sie die Endbegünstigten des Projekts sind, in Bezug auf die Vergabe öffentlicher Aufträge und die technische Überwachung sowie die Verwaltung von Vermögenswerten nach der Investitionsphase; |
Finanzierungsalternativen
|
38. |
empfiehlt den zuständigen Behörden, als zusätzliche Option der Kohäsionspolitik angesichts immer knapperer öffentlicher Mittel die Möglichkeit zu nutzen, Projekte privat mitfinanzieren zu lassen, was zweifellos einen Mehrwert für diese Politik darstellen wird. Insofern können die Formen öffentlich-privater Partnerschaften ein im neuen Programmplanungszeitraum auszubauendes Instrument sein. Außerdem trägt die private Mitfinanzierung von Projekten für die Wirtschaftsentwicklung dazu bei, die Relevanz solcher Maßnahmen sowie das Engagement und die Eigenverantwortung der Unternehmen für die eingeleiteten Initiativen zu gewährleisten; |
|
39. |
weist auf die wichtige Rolle hin, die die EIB hier spielen kann, sowie auf die zusätzlichen Möglichkeiten, die die „Rahmenkredite“ und „Kredite im Rahmen der Strukturprogramme“ bieten; |
|
40. |
fordert, wie dies bereits in früheren Stellungnahmen der Fall war, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, für die Finanzierung von Großprojekten Anleihen mit mittelfristiger Rendite zu begeben; |
Finanzinstrumente
|
41. |
erkennt die derzeitigen Funktionsschwierigkeiten der Finanzinstrumente an und nimmt insbesondere die spezifischen Sorgen und Bedürfnisse der Städte und städtischen Gebiete im Hinblick auf das Instrument Jessica zur Kenntnis, die eine Folge der Spannungen zwischen den für die Programmverwaltung zuständigen Behörden und den städtischen Behörden sind. Deshalb bekräftigt der AdR das Erfordernis, bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik den Einsatz der auf Krediten beruhenden Instrumente in geeigneten Bereichen zu vereinfachen, da sie einen Multiplikatoreffekt haben und die Effizienz der Maßnahmen steigern sowie gleichzeitig die regionalen und lokalen Haushalte weniger belasten und schlägt vor, neben anderen Akteuren die Beteiligung der Förderbanken zu berücksichtigen; |
Rückwirkung der Bestimmungen
|
42. |
lehnt die Praxis ab, rückwirkende Bestimmungen einzuführen, und ist der Auffassung, dass sie künftig vermieden werden sollte, da sie die Verwaltung verkompliziert und Rechtsunsicherheit schafft, und dringt darauf, die Anwendung eines Prinzips der Verhältnismäßigkeit zu prüfen, das die Kontrollanforderungen an die Größe der über die Strukturfonds kofinanzierten Projekte anpasst; |
Verhältnismäßigkeit der Kontrolle
|
43. |
ist der Auffassung, dass durch die Einführung von „Vertrauenspakten“ zwischen der Europäischen Kommission und den Regionen Doppelarbeit bei den Auditverfahren vermieden werden kann und so das Prinzip der Verhältnismäßigkeit Anwendung findet; |
|
44. |
hält es für erforderlich, die Konzipierung der EU-Leitlinien für die Mechanismen zur Verwaltung und Kontrolle von Mehrfonds- bzw. Multiprogrammprojekten in spezifischer Form anzugehen, so dass administrative Doppelarbeit vermieden wird, die die Empfänger von einer Nutzung abhalten könnte. Das gilt insbesondere für die Benennung zentraler Anlaufstellen, eine umfassende Rechenschaftspflicht und integrierte Audits; beabsichtigt deshalb, zu den Anwendungsleitlinien für die neuen Mehrfondsprojekte Stellung zu nehmen; |
|
45. |
vertritt die Auffassung, dass die für die Projektverwaltung zuständigen Behörden für die zusätzlichen Mittel, die die Europäische Union den Regionen zur Verfügung stellt, besondere Aufmerksamkeit aufbringen müssen und empfiehlt deshalb, ihre Einrichtungen so anzupassen, dass eine ausreichende und geeignete Organisationsstruktur für die optimale Nutzung dieser Mittel gewährleistet ist. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Siehe: OECD-Papier GOV/TDPC/(2013)3. Diese Prinzipien umfassen u.a.: die Anwendung einer an die verschiedenen Gebiete angepassten integrierten Strategie, die Annahme wirksamer Instrumente für die Koordinierung zwischen den nationalen und nachgeordneten Verwaltungen, die Koordinierung zwischen den nachgeordneten Regierungs- und Verwaltungsebenen, um auf der am besten geeigneten Ebene zu investieren, die Vorabevaluierung der langfristigen Auswirkungen und Risiken öffentlicher Investitionen, die Einbindung der Interessenträger in alle Phasen des Investitionszyklus, die Mobilisierung der privaten Akteure und der Finanzinstitutionen zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen und zum Ausbau der Kapazitäten, den Ausbau der Kapazitäten der an den öffentlichen Investitionen beteiligten Personen und Institutionen, die Konzentration auf die Ergebnisse und die Förderung des Lernens, die Entwicklung eines an die Investitionsziele angepassten Steuerrahmens, das Erfordernis eines strengen und transparenten Finanzmanagements auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen, Transparenz und intelligente Nutzung des öffentlichen Auftragswesens, die Förderung eines hochwertigen und kohärenten Regelungsrahmens auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/9 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Stadt-Land-Partnerschaften und ihre Steuerung
2013/C 356/03
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
ist sich der legislativen und administrativen bzw. steuerlichen und finanziellen Hürden bewusst, die die Bildung von Stadt-Land-Partnerschaften und deren Dynamik beeinträchtigen. Diese Hindernisse müssen erkannt und beseitigt werden, damit ein Rechtsrahmen gewährleistet wird, der die Bildung von Partnerschaften fördert; |
|
— |
empfiehlt den Verwaltungsbehörden auf der Ebene der Mitgliedstaaten, die neuen Instrumente für territoriale Entwicklung zu nutzen, die die EU im Rahmen der Politik für regionale Entwicklung und zur Entwicklung des ländlichen Raums vorschlägt, nämlich integrierte territoriale Investitionen (ITI), von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale Entwicklung (CLLD), Systeme für Globalzuschüsse oder die Multifondsstrategie; |
|
— |
unterstreicht, dass die funktionalen Regionen hinsichtlich der Förderfähigkeit durch die Fonds anerkannt werden müssen, wobei auch die Finanzierungsquellen einzubeziehen sind, die im Rahmen der Regionalpolitik und der gemeinsamen Agrarpolitik der EU zur Verfügung stehen; |
|
— |
hält eine bessere Datensammlung auf der Ebene der funktionalen Regionen für unerlässlich. Hierdurch kann eine Datenbank für eine bessere und fundierte Raumplanung geschaffen werden, mit der der Umfang der Maßnahmen begründet werden kann; |
|
— |
verweist mit Nachdruck auf die grenzübergreifenden Aspekte von Stadt-Land-Partnerschaften und die Art und Weise, wie und ob die von der Kommission vorgeschlagenen Finanzinstrumente genutzt werden, um das Wirtschaftsentwicklungspotenzial von grenzübergreifenden Stadt-Land-Verbindungen zu fördern; |
|
— |
hebt hervor, dass die Privatwirtschaft und die Sozialwirtschaft eingebunden werden müssen, deren Beitrag überaus viele Vorteile bringt, nicht nur hinsichtlich der Leistungskriterien, der unternehmerischen Kapazitäten und der Fähigkeit zur Innovation sowie der Nutzung von Chancen und der Mobilisierung der verschiedenen Gemeinschaften, sondern auch und vor allem für die Mobilisierung von Kapital und die Schaffung öffentlich-privater Partnerschaften. |
|
Berichterstatter |
Romeo STAVARACHE (RO/ALDE), Bürgermeister von Bacău |
|
Referenzdokument |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Überlegungen zu Stadt-Land-Partnerschaften
|
1. |
Städtische und ländliche Gebiete sind in demografischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie im Bereich der Infrastruktur für den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen miteinander verbunden. Den Verbindungen zwischen Stadt und Land, zu denen der Gütertransport, der Pendlerverkehr zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser, Abfallentsorgung, wirtschaftliche Beziehungen, der Zugang zu natürlichen Ressourcen sowie Erholungs- und kulturelle Aktivitäten zählen, muss die besondere Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger auf allen Regierungsebenen gelten. Die Art und Weise, wie diese Verbindungen gesteuert werden, wirkt sich auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der funktionalen Regionen und damit auf die Lebensqualität der dort lebenden Menschen aus. |
|
2. |
Eine fehlende Koordinierung der Stadt-Umland-Beziehungen führt häufig zu Fehlentwicklungen sowohl in der Stadt als in ihrem Umland. Um die Probleme der städtischen und ländlichen Gebiete besser lösen zu können, muss man sich dieser wechselseitigen Abhängigkeit bewusst sein und sie verstehen. Auf beiden Seiten ist die Einsicht in das Bestehen funktionaler Verknüpfungen und Abhängigkeiten zu fördern. |
|
3. |
Zur Bestimmung der besten Modelle für die Steuerung funktionaler Regionen müssen zunächst die Verbindungen verstanden und die Herausforderungen ermittelt werden, vor denen sowohl die städtischen als auch die ländlichen Gebiete stehen. Ein „Pauschalkonzept“ kann es in diesem Zusammenhang ohnehin nicht geben. |
|
4. |
Bevölkerungsrückgang insbesondere in abgelegenen Gebieten, ökologische Nachhaltigkeit und Landschaftsschutz, uneingeschränkter Zugang zu natürlichen und kulturellen Ressourcen, öffentlichen Dienstleistungen und Konsumgütern, die Ausbreitung der städtischen auf Kosten der ländlichen Gebiete, wirtschaftliche Rezession, regionale Wettbewerbsfähigkeit, Verbindungen innerhalb der Regionen, Wirksamkeit öffentlicher Maßnahmen und die Nutzung der Möglichkeiten der externen Finanzierung — all dies sind Beispiele für Herausforderungen, die im Rahmen der Entwicklung einer Partnerschaft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten bewältigt werden müssen. |
|
5. |
Die Vielfalt der Herausforderungen kommt außerdem in den Zielen der Stadt-Land-Partnerschaften zum Ausdruck: wirtschaftliche Entwicklung, eine integrierte gemeinsame Planung, Nutzung von Synergieeffekten, Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, Skaleneffekte bei der Erbringung von Dienstleistungen in Partnerschaft, Fördermaßnahmen für das gesamte Gebiet, gemeinsame Wahrung von Interessen und strategische Zusammenarbeit im Hinblick auf öffentliche oder private Mittel usw. |
|
6. |
Die funktionalen Stadt-Land-Regionen können aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und geografischen Verbindungen auf der Gebietsebene ermittelt werden. Die Festlegung dieser Regionen ist nötig, weil das herkömmliche Konzept, auf dem die Politik zur Entwicklung der Städte und Gemeinden fußt, an den Verwaltungsgrenzen endet und nicht der sozioökonomischen Wirklichkeit vor Ort entspricht. |
|
7. |
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) definiert eine funktionale Region folgendermaßen: Eine funktionale Region ist ein geografischer Raum, dessen Grenzen zwar zumeist nicht mit der Verwaltungseinteilung der Gebietskörperschaften zusammenfallen, in dem sich jedoch spezifische gebietsbezogene Zusammenhänge (in Bezug auf die Funktion) beobachten lassen, die möglicherweise einer gewissen politischen Steuerung bedürfen. |
|
8. |
Stadt-Land-Partnerschaften zeichnen sich durch flexible Geometrie aus. Diese Flexibilität ergibt sich aus 1) dem Ziel der Partnerschaft, die sich auf einen oder mehrere Bereiche beziehen kann, 2) ihrer Daseinsberichtigung (Steuerung eines Projekts oder integrierte Verwaltung der funktionalen Region) und 3) dem gewählten Steuerungsmodell (von oben nach unten oder umgekehrt). |
|
9. |
Die Erfahrung zeigt, dass die Ansätze und Probleme von Region zu Region und von Land zu Land variieren. In bestimmten Fällen haben die nationalen Verwaltungen den Rahmen für die Stadt-Land-Zusammenarbeit institutionalisiert, während dieser Rahmen in anderen Ländern flexibel ist. Diese Vielfalt stellt einen realen Vorteil für die EU dar, denn sie bietet Möglichkeiten des Erkundens und Neu-Schaffens ausgehend von unterschiedlichen Modellen und Praktiken. |
|
10. |
Ein wesentlicher gemeinsamer Faktor für den Erfolg der Zusammenarbeit besteht unabhängig vom jeweiligen Hintergrund im Dialog und im Vertrauen zwischen den Partnern, ebenso wie in der Anerkennung und Berücksichtigung der gemeinsamen Bedürfnisse des betreffenden Gebietes. |
|
11. |
Sowohl auf horizontaler Ebene zwischen den lokalen Partnern als auch vertikal zwischen den Behörden der verschiedenen betroffenen Regierungsebenen kann mangelndes Vertrauen zwischen den Parteien schädlich sein und die Zusammenarbeit generell verlangsamen. Es bedarf anhaltender politischer Anstrengungen seitens aller beteiligten Entscheidungsgremien, um Vertrauen aufzubauen und über Lösungen für komplexe Fragen von gemeinsamem Interesse nachzudenken. |
Herausforderungen auf der Ebene der Europäischen Union
|
12. |
Auch wenn sich in der Europäischen Union das Entwicklungsgefälle zwischen den Mitgliedstaaten im Laufe der letzten Jahre verringert hat, ist dies in Bezug auf die Regionen nicht der Fall, wo sich — dies zeigen makroökonomische Analysen der statistischen Daten von vor der Krise — eine Vergrößerung der Rückstände beobachten lässt. Es müssen die besten Lösungen gefunden werden, um das Gefälle unter den Regionen zu verringern, die Lebensqualität in den wirtschaftlich rückständigen Gebieten zu verbessern und die Wirtschaft, den Dienstleistungssektor sowie die biologische Landwirtschaft zu entwickeln. |
|
13. |
Oft erfolgt die Raumplanung nur auf der Verwaltungsebene der Gebietskörperschaften und nicht auf der Ebene der funktionalen Regionen, so dass die wechselseitige Abhängigkeit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten nicht berücksichtigt wird. Dies kann negative Folgen für den territorialen Zusammenhalt haben und die Möglichkeiten zur Schaffung lokaler Synergien verringern, die die wirtschaftliche und soziale Entwicklung fördern. |
|
14. |
Ein integrierter Ansatz für Entwicklungsmaßnahmen sollte aus Gründen der Effizienz nicht abrupt an den Verwaltungsgrenzen enden, die das städtische und das ländliche Gebiet voneinander trennen, sondern die Funktionalität des jeweiligen Gebietes berücksichtigen. Die stadtnahen (sog. periurbanen) Gebiete tragen zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung bei, liefern Energie sowie Umwelt- und Kulturressourcen und verbessern somit die Lebensqualität. Die Städte wiederum sind anerkanntermaßen Pole für öffentliche Dienstleistungen, Handel, das Gesundheitswesen, höhere Bildung, Verkehr, Innovation und Beschäftigung. |
|
15. |
Die Verwaltungsgrenzen der Städte und Gemeinden entsprechen oftmals nicht der wirtschaftlichen Geografie einer Region. Außerdem zeichnen sich funktionale Regionen durch eine fortwährende Dynamik aus, weshalb die gebietsbezogenen Politiken anpassungsfähig und ausreichend flexibel sein müssen. So ist z.B. in Bezug auf den häufigsten Faktor der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, nämlich den Pendlerverkehr zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, allgemein anerkannt, dass die Fahrzeit normalerweise eine Stunde nicht überschreiten sollte — oberhalb dieser Schwelle wird die Erreichbarkeit des Arbeitsortes immer schlechter. |
|
16. |
Durch den integrierten Ansatz ausgehend von Partnerschaften zwischen städtischen und ländlichen Gebieten können sich neue und dynamische Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung ergeben. Das nachhaltige und integrative Wirtschaftswachstum auf regionaler Ebene hängt großenteils von der Nutzung des Potenzials für Zusammenarbeit zwischen den Städten und ihrem Umland ab. |
|
17. |
Wenn man davon ausgeht, dass zwischen städtischen und ländlichen Gebieten keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine gegenseitige Ergänzung bestehen sollte, so stellt die Koordinierung der Tätigkeiten der öffentlichen Hand ein großes Aufgabenfeld dar. Schließlich können Stadt und Land nur auf diese Weise gewinnbringende Lösungen finden, durch die mögliche Interessenkonflikte entschärft werden. |
|
18. |
Stadt-Land-Partnerschaften bedürfen eines langfristigen Ansatzes für die Erarbeitung der Strategien und Programme sowie insbesondere zur Entwicklung von Steuerungsstrukturen. Die Vorteile langfristiger Überlegungen bestehen vor allem in der Kohärenz und der Erzielung tragfähiger Ergebnisse. Die Partnerschaften können zur Lösung wirklicher Probleme beitragen, indem sie dem Bedarf vor Ort sowohl im städtischen wie im ländlichen Raum entsprechen oder indem sie gemeinsame praktische Lösungen umsetzen. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften müssen darauf bestehen, dass der langfristige strategische Ansatz im Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung der EU und deren Ausführung Priorität genießt, damit die Unzulänglichkeiten beseitigt werden, die sich aus den verfahrenstechnischen Regelungen ergeben. |
|
19. |
Aus den Fallstudien zur Art der Partnerschaft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten geht hervor, dass ihr Erfolg nicht nur von dem politischen Handeln der höheren Ebenen abhängt, wie gesetzgeberischen Maßnahmen oder Finanzierungsinstrumenten, seien es nationale oder europäische. Entsprechende Maßnahmen können die Entwicklung der Partnerschaften, ihre Attraktivität, ihre Dauerhaftigkeit, ihre Wirksamkeit und ihre Fähigkeit zur Realisierung der gewünschten Ziele allerdings entscheidend beeinflussen. Außerdem gibt es Situationen, in denen die Schaffung und Verwaltung von Partnerschaften Kosten beinhalten, die von den Partnern nicht in gleicher Weise aufgebracht werden können. In solchen Fällen bedarf es der Bereitstellung finanzieller oder auch technischer Unterstützung, um den Zusammenhalt der Partnerschaft zu gewährleisten. Die Aufgabe für die EU besteht darin, die Interventionsmaßnahmen festzulegen, durch die die Partnerschaften belebt und unterstützt werden, ohne sie jedoch in eine Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung zu bringen, und überdies zu vermeiden, dass Partnerschaften rein formal geschaffen werden, die nicht dem öffentlichen Interesse der Gemeinschaft dienen. |
|
20. |
Das Regieren auf mehreren Ebenen („Multi-Level-Governance“) im Rahmen einer Stadt-Land-Partnerschaft setzt die Teilnahme aller Verwaltungsebenen und relevanten institutionellen Partner voraus. Oft berücksichtigen die Organe, die mit der Verwaltung der nationalen oder europäischen Instrumente im Bereich der Politik zur städtischen und ländlichen Entwicklung betraut sind, die wechselseitige Abhängigkeit der städtischen und ländlichen Gebiete nicht, ebenso wenig wie die hiermit verbundenen Herausforderungen, Risiken und potenziellen Vorteile. |
|
21. |
Eine neue Dynamik für grenznahe Regionen ergab sich dabei insbesondere im Zuge der fortschreitenden Öffnung der Grenzen innerhalb der EU. Die Förderung grenzüberschreitender Stadt-Land-Partnerschaften stellt ein beachtliches Entwicklungspotenzial dar, bei dessen Nutzung insbesondere die Europäische Union eine essentielle Rolle spielt. |
Der Blickwinkel der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
|
22. |
Der Mehrwert der Stadt-Land-Partnerschaft besteht in einer höheren Wirksamkeit der öffentlichen Maßnahmen, einer größeren Kohärenz bei der Verwendung von finanziellen Mitteln und der Förderung integrierter Lösungen für gemeinsame Probleme sowie vor allem in der Förderung der territorialen Solidarität. |
|
23. |
Die Maßnahmen der städtischen und ländlichen Behörden müssen auf die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung an der Planung und Durchführung der Arbeiten gerichtet sein, da die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen von deren aktiver Mitwirkung abhängt. |
|
24. |
Für die Bewältigung der Probleme, der häufigen Veränderungen und der geografischen Herausforderungen, mit denen die Regionen konfrontiert sind, sind wirksame Maßnahmen unabdingbar; allerdings sollte beachtet werden, dass eine Verankerung der Steuerung viel mehr Zeit benötigt. Daher müssen die beteiligten Parteien — insbesondere die städtische Seite — uneigennützig und entgegen der gängigen Vorurteile handeln, die Gleichbehandlung der Partner trotz administrativer oder wirtschaftlicher Ungleichgewichte fördern, bindende Verpflichtungen eingehen, die politischen Anstrengungen zur Schaffung der Kapazitäten aufrechterhalten und für einen flexiblen Ansatz offen sein. |
|
25. |
Es gibt eine Reihe legislativer und administrativer bzw. steuerlicher und finanzieller Hürden, die die Bildung von Stadt-Land-Partnerschaften und deren Dynamik beeinträchtigen. Diese Hindernisse müssen erkannt und beseitigt werden, damit ein Rechtsrahmen gewährleistet wird, der die Bildung von Partnerschaften fördert. |
|
26. |
Die wechselseitige Abhängigkeit bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, die nachhaltige Entwicklung und die wirtschaftlichen Perspektiven von Stadt-Land-Partnerschaften bieten geeignete Anreize, um die städtischen und ländlichen Partner für die Zusammenarbeit zu motivieren. |
|
27. |
Der Beobachtung und Bewertung der Vorteile für die Partner kommt eine große Bedeutung zu. Während die spürbaren Vorteile leichter messbar sind, ist dies bei den weniger spürbaren Vorteilen nicht der Fall, diese sind aber keinesfalls weniger wichtig. Außerdem ist im Falle der Maßnahmen, die von externen, die Partnerschaft finanzierenden Einrichtungen ergriffen werden, eine Bezifferung der Vorteile noch wichtiger, auch wenn die Partner mit den erzielten Fortschritten bereits mehr oder weniger zufrieden sind. |
Politische Empfehlungen des Ausschusses der Regionen
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
28. |
bestätigt seine Unterstützung für die vorbereitende Maßnahme „RURBAN“, die vom Europäischen Parlament und von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde und derzeit umgesetzt wird — hierdurch wird die Grundlage für neue Maßnahmen geschaffen, mit denen auf der Ebene der Europäischen Union die integrierte territoriale Entwicklung und die Stadt-Land-Partnerschaft gefördert werden; |
|
29. |
begrüßt die auf der Ebene der Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Territorialen Agenda 2020 und der von den für Kohäsionspolitik zuständigen Ministern angenommenen Dokumente, nämlich der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, der Erklärung von Marseille zur Umsetzung des Referenzrahmens für nachhaltige europäische Städte sowie der Erklärung von Toledo zur integrierten Stadterneuerung und deren Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele der Europa-2020-Strategie; |
|
30. |
erinnert an die Empfehlungen des Europäischen Parlaments für „ein effizientes Regelungssystem (‚Good Governance‘) für die Regionalpolitik der EU: Verfahren der Unterstützung und Überwachung durch die Kommission“ und fordert, diese im Rahmen des neuen Programmplanungszyklus 2014-2020 umzusetzen (1); |
|
31. |
betont, dass der Austausch bewährter Praktiken und von Fachwissen im Bereich der Partnerschaften und der Steuerung von städtischen und ländlichen Gebieten erleichtert werden sollte (2); |
|
32. |
anerkennt die Bedeutung der Harmonisierung der EU-Vorschriften zur Kohäsion und zur ländlichen Entwicklung im Rahmen der neuen gemeinsamen Regeln in Bezug auf Fördermittel, die den lokalen Gebietskörperschaften mehr Flexibilität bei der Gestaltung themenübergreifender, integrierter territorialer Projekte ermöglicht, und insbesondere die Vorschlägen für die integrierten territorialen Investitionen (ITI) und die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD); |
|
33. |
empfiehlt den Verwaltungsbehörden auf der Ebene der Mitgliedstaaten, die neuen Instrumente für territoriale Entwicklung zu nutzen, die die EU im Rahmen der Politik für regionale Entwicklung und zur Entwicklung des ländlichen Raums vorschlägt, nämlich integrierte territoriale Investitionen (ITI), von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale Entwicklung (CLLD), Systeme für Globalzuschüsse oder die Multifondsstrategie; |
|
34. |
empfiehlt, den integrierten territorialen Ansatz im neuen Programmplanungszyklus dadurch zu fördern, dass die territoriale Dimension der Maßnahmen und der Fördermittel in die Partnerschaftsabkommen aufgenommen und deutlich benannt wird, insbesondere der Maßnahmen für Stadt-Land-Partnerschaften auf der Ebene der funktionalen Regionen; |
|
35. |
unterstreicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ihre Investitionsprogramme an den thematischen Zielen der Europa-2020-Strategie ausrichten; in Bezug auf den betreffenden geografischen Raum können sie jedoch funktionale Regionen festlegen. Diese funktionalen Regionen müssen hinsichtlich der Förderfähigkeit durch die Fonds anerkannt werden, wobei auch die Finanzierungsquellen einzubeziehen sind, die im Rahmen der Regionalpolitik und der gemeinsamen Agrarpolitik der EU zur Verfügung stehen; |
|
36. |
teilt die Einschätzung, dass Stadt-Land-Partnerschaften weder ein Instrument zur Umverteilung des wirtschaftlichen Potenzials innerhalb eines bestimmten Raums noch ein Mittel zur Neuverteilung der Mittel innerhalb einer funktionalen Region sind. Stadt-Land-Partnerschaften dienen der angemessenen Nutzung des vorhandenen Potenzials und der Verbindung der Parteien mit dem Ziel, die lokale Entwicklung zu fördern; |
|
37. |
hält eine bessere Bezifferung der Gefahren einer institutionellen Fragmentierung für notwendig, denen die Stadt-Land-Partnerschaft ausgesetzt ist, etwa mögliche Interessenkonflikte zwischen Partnern und deren wirtschaftliche Dimension, Möglichkeiten für Reformen zur Stärkung der ökonomischen Effizienz bei gleichzeitiger Gefährdung der Stabilität für die Anerkennung der Legitimität der Maßnahmen, finanzielle Instabilität und Tragkraft, eventuelles Ungleichgewicht zwischen dem Finanzierungsbedarf und den vorhandenen Möglichkeiten, Gefahr einer unzureichenden Einbeziehung der relevanten öffentlichen Partner und der privaten Partner u.a.; |
|
38. |
vertritt den Standpunkt, dass die Vorteile der Partnerschaft auf europäischer Ebene besser hervorgehoben und anerkannt werden müssen. Die Stärkung der institutionellen Kapazitäten der lokalen Behörden für die Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags, die Entwicklung und Nutzung der vorhandenen Kapazitäten und Erhöhung der Produktivität, ein rationeller Einsatz der Mittel und ein besserer Zugang zu natürlichen Ressourcen sollten von allen Regierungsebenen einschließlich der EU unterstützt werden. Die bessere Sichtbarkeit der funktionalen Regionen, die Verringerung der negativen Auswirkungen der Konkurrenz zwischen benachbarten Verwaltungseinheiten (insbesondere bezüglich der Besteuerung), höhere Skaleneffekte für Investitionen, ökonomische Tragfähigkeit, der Zugang zu Dienstleistungen, die Mobilisierung ungenutzter Ressourcen, die Erhöhung des Fachwissens auf lokaler Ebene dank Informationsaustausch und die Zügelung der Zersiedlung sind Beispiele für Herausforderungen, vor denen die städtisch-ländliche Zusammenarbeit steht; |
|
39. |
empfiehlt, die funktionalen Regionen und die grenzübergreifenden Stadt-Land-Partnerschaften zu unterstützen, die dann als Referenzwert für die Durchführung von mehrjährigen, aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds finanzierten Entwicklungsprogrammen dienen können; |
|
40. |
verweist mit Nachdruck darauf, dass die europäischen Programme so flexibel gestaltet sein müssen, dass sie der tatsächlichen Situation in den funktionalen Regionen angepasst werden können und die Entwicklung von Mechanismen ermöglichen, die die ländlichen und städtischen Gebiete darin unterstützen und sie dazu motivieren, geschmeidiger zusammenzuarbeiten und wirkungsvolle politische Lösungen zu fördern; |
|
41. |
hält eine bessere Datensammlung auf der Ebene der funktionalen Regionen für unerlässlich. Hierdurch kann eine Datenbank für eine bessere und fundierte Raumplanung geschaffen werden, mit der der Umfang der Maßnahmen begründet werden kann, d.h. die Notwendigkeit, dass das Planungsverfahren dort durchgeführt wird, wo die Probleme bzw. die Veränderungen tatsächlich auftreten. Für eine umfangreichere Nutzung der Informationen über die Funktionsfähigkeit der Partnerschaft bedarf es darüber hinaus praktischer Beispiele, die den Mehrwert und die Vorteile der Partnerschaft für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung belegen (3). Eine ESPON-Analyse wird für politische Entscheidungsträger und Projektpraktiker in diesem Bereich von größter Bedeutung sein; |
|
42. |
ist überzeugt, dass ein besseres Verständnis der spürbaren und verborgenen Vorteile der Stadt-Land-Partnerschaften für die Bewertung ihrer Qualität von wesentlicher Bedeutung ist. Hierdurch kann der europäische Mehrwert bewiesen werden, den diese Partnerschaften für die Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie haben. Daher kann es angebracht sein, gemeinsame Indikatoren zur Bezifferung der Vorteile festzulegen, deren Verwendung den lokalen Gebietskörperschaften nahegelegt werden könnte. Langfristig könnten die Partnerschaften Gegenstand einer vergleichenden Bewertung sein, vor allem wenn es sich um aus europäischen Mitteln finanzierte Programme handelt; |
|
43. |
ermutigt die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, innovative Modelle der Stadt-Land-Steuerung zu entwerfen, um die Effekte der Zusammenarbeit zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten sowie deren Ergebnisse zu optimieren; |
|
44. |
schlägt vor, Stadt-Land-Partnerschaften zu einem der vorrangigen Themen des URBACT-Programms und innovativer Maßnahmen zu machen, um die Erfahrungen und Praktiken im Bereich der Stadt-Land-Partnerschaft in der EU zu sammeln und innovative Steuerungsmodelle zu fördern; |
|
45. |
hält es für notwendig, die Zusammenarbeit — insbesondere die grenzübergreifende — zu stärken und die finanzielle Unterstützung durch die europäischen Programme zur Kofinanzierung der Transaktionskosten der Partnerschaften auszuweiten, die recht hoch ausfallen können (z.B. Verwaltungs- und Personalkosten). Zur Sicherstellung der Tragkraft der Partnerschaft müssen diese ebenso wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet werden; |
|
46. |
ist überzeugt, dass eine Partnerschaft die Schlüsselakteure, den privaten Sektor, die Sozialwirtschaft und regierungsunabhängige Organisationen umfassen muss, damit der Rückhalt in der Bevölkerung gewährleistet ist; |
|
47. |
verweist mit Nachdruck auf die grenzübergreifenden Aspekte von Stadt-Land-Partnerschaften und die Art und Weise, wie und ob die von der Kommission vorgeschlagenen Finanzinstrumente genutzt werden, um das Wirtschaftsentwicklungspotenzial von grenzübergreifenden Stadt-Land-Verbindungen zu fördern; |
|
48. |
unterstreicht die Bedeutung des Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern, der für die Stadt-Land-Steuerung unerlässlich ist, um einen Konsens über eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele herzustellen und das Vertrauen zu stärken; |
|
49. |
hält die Ergreifung von Maßnahmen für angezeigt, die einer städtischen Zersiedlung vorbeugen, die unerwünschte Folgen für die Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung mit sich bringt, indem Bodenversiegelung und der Gefahr von Überschwemmungen Vorschub geleistet, Maßnahmen zur Risikoprävention konterkariert sowie die Wasserversorgung und die Luftqualität beeinträchtigt werden. Die Zersiedelung hat außerdem Auswirkungen auf die Mobilität, da sie z.B. Staus sowie zusätzliche Kosten für die Infrastruktur und für die Raumplanung im Allgemeinen verursacht. Für derartige Probleme können Lösungen gefunden werden, wenn die städtischen und ländlichen Gebiete partnerschaftlich zusammenarbeiten; |
|
50. |
hebt hervor, dass die Privatwirtschaft und die Sozialwirtschaft eingebunden werden müssen, deren Beitrag überaus viele Vorteile bringt, nicht nur hinsichtlich der Leistungskriterien, der unternehmerischen Kapazitäten und der Fähigkeit zur Innovation sowie der Nutzung von Chancen und der Mobilisierung der verschiedenen Gemeinschaften, sondern auch und vor allem für die Mobilisierung von Kapital und die Schaffung öffentlich-privater Partnerschaften; |
|
51. |
erinnert an die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Partnerschaft, nämlich die Schaffung von Vertrauen, die Ermittlung aller bestehenden Möglichkeiten, das Anstellen von Überlegungen zur Umsetzung konkreter Vorhaben, Lösungen, die sowohl der Stadt als auch dem ländlichen Gebiet Vorteile bringen, Zielsetzungen bezüglich der Mobilisierung von Kapital sowie dauerhafte Kohärenz und Tragfähigkeit. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Bericht (2009/2231(INI)) des EP: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0280+0+DOC+XML+V0//DE
(2) Empfehlungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) — umfassende Studie über die Stadt-Land-Partnerschaft; Studie des nationalen Forschungsinstituts für Bau, Stadtentwicklung und Raumordnung mit dem Titel „Partnerschaft für nachhaltige Stadt-Land-Entwicklung: vorhandene Daten“; Eurocities-Bericht „Zusammenarbeit der Städte über die Verwaltungsgrenzen hinweg: Erfahrungsbasierte Daten“; Bericht des Rats der Gemeinden und Regionen Europas über die „Stadt-Land-Partnerschaft für die integrierte territoriale Entwicklung“.
(3) In diesem Zusammenhang kann auf das europäische Netzwerk „PURPLE“ verwiesen werden, in dem periurbane Gebiete aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten rund um das Thema Lebensqualität in stadtnahen ländlichen Gebieten zusammenarbeiten.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/15 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Der Entwurf des EU-Haushaltsplans für 2014
2013/C 356/04
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
unterstreicht, dass die Aufstellung des Jahreshaushaltsplans der EU für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften politische und strategische Bedeutung hat und schlägt eine förmliche Befassung mit den künftigen Jahreshaushaltsplänen vor; |
|
— |
begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission, Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln bereitzustellen, ist jedoch der Ansicht, dass die öffentlich zugänglichen Informationen unzureichend und zu lückenhaft sind, um einen präzisen Überblick über die von den Gebietskörperschaften verwalteten Ausgaben aus EU-Mitteln zu bekommen; |
|
— |
betont, dass er genau beobachten wird, ob sich ein langsamer Programmanlauf und eine langsame Mittelaufnahme negativ auf die für 2016 geplante Halbzeitüberprüfung des MFR auswirken werden; |
|
— |
nimmt zur Kenntnis, dass ein Drittel der RAL insgesamt (70,7 Mrd. EUR) 2014 ausgezahlt werden, ist jedoch wie die Europäische Kommission besorgt mit Blick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016; |
|
— |
erachtet es als nicht hinnehmbar, dass Zahlungen verzögert werden, und verlangt nachdrücklich, dass die Zahlungsfrist von 60 Tagen für Programme mit geteilter Mittelverwaltung verbindlich sein sollte und bei einem Überschreiten der Frist rechtliche oder finanzielle Sanktionen verhängt werden sollten; |
|
— |
bedauert, dass in der Darlegung der politischen Prioritäten des EU-Haushalts für 2014 kein Hinweis auf das Europäische Semester enthalten ist; |
|
— |
regt an, im Sinne einer raschen Umsetzung das Vorziehen sämtlicher Ausgaben der YEI in den Jahren 2014-2015 durch geeignete Maßnahmen zu flankieren (etwa Kapazitätsaufbau); |
|
— |
fordert das Vorziehen weiterer Verpflichtungsermächtigungen von bis zu 200 Mio. EUR für Horizont 2020, 150 Mio. EUR für Erasmus und 50 Mio. EUR für COSME in den Jahren 2014-2015; |
|
— |
begrüßt, dass 351,9 Mio. EUR von der ersten auf die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) übertragen werden sollen, und bringt erneut seine strikte Ablehnung von Übertragungen in umgekehrter Richtung zum Ausdruck; |
|
— |
regt an, die zusätzliche Flexibilität innerhalb des „Gesamtspielraums für Wachstum und Beschäftigung“ auch für die Rubrik 1b zu nutzen. |
|
Berichterstatter: |
Luc VAN DEN BRANDE (BE/EVP), Präsident des Verbindungsbüros Flandern-Europa |
|
Referenzdokumente |
Europäische Kommission, Haushaltsvoranschlag der Europäischen Kommission für das Haushaltsjahr 2014 (Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2014), SEC(2013)370, Juni 2013 Ministerrat der Europäischen Union, Entwurf einer Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020, 11655/13, 27. Juni 2013 |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
betont, dass er erstmals eine Stellungnahme zum jährlichen EU-Haushaltsverfahren erarbeitet hat, um die Standpunkte der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zu den Haushaltslinien darzulegen, bei denen diese die wichtigsten Empfänger sind; |
|
2. |
unterstreicht, dass die Aufstellung des Jahreshaushaltsplans der EU für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften politische und strategische Bedeutung hat, und schlägt eine förmliche Befassung mit den künftigen Jahreshaushaltsplänen durch die Kommission, den Rat oder das Parlament vor, damit der AdR Stellung beziehen kann, nachdem die Europäische Kommission den Entwurf des Haushaltsplans veröffentlicht hat und vorzugsweise bevor der Rat den Entwurf des Haushaltsplans an das Parlament übermittelt; |
|
3. |
verweist darauf, dass die vorliegende Stellungnahme nicht die Verwaltungsausgaben unter der Rubrik 5 zum Gegenstand hat; |
|
4. |
konzentriert sich in dieser Stellungnahme auf die Haushaltslinien, die für den Ausschuss der Regionen und die Gebietskörperschaften von wesentlichem Interesse sind, einschließlich Strukturfonds, Horizont 2020, COSME, Kohäsionsfonds und anderer Programme mit geteilter Mittelverwaltung wie ELER und EMFF sowie LIFE+; |
Der EU-Haushalt und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
|
5. |
hält fest, dass der EU-Haushalt besondere Bedeutung für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften hat, denn sie verwalten direkt einige der EU-Programme mit geteilter Mittelverwaltung und sind daher unmittelbar betroffen von der Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wie auch der Zahlungsermächtigungen in diesen Bereichen, insbesondere mit Blick auf die Verzögerungen bei den Zahlungen, die aus der Anhäufung ausstehender Forderungen in den vergangenen Jahren entstanden sind und sich unmittelbar auf die öffentlichen Finanzen in zahlreichen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften überall in der EU auswirken; |
|
6. |
hält weiterhin fest, dass zahlreiche Gebietskörperschaften Gelder aus den EU-Fonds wie dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) erhalten und für die Erreichung ihrer politischen Ziele in starkem Maße von diesen Fonds abhängig sind; |
|
7. |
möchte zudem daran erinnern, dass der EU-Haushalt nur einen kleinen Anteil (rund 2 %) aller Ausgaben der öffentlichen Hand in der Europäischen Union ausmacht und per se nicht ausreicht, um die im Rahmen von Europa 2020 erforderlichen zukunftsorientierten Direktinvestitionen in Höhe von 1 800 Mrd. EUR zu liefern. Der Ausschuss der Regionen ist daher der Ansicht, dass eine weitergehende Einbeziehung der Gebietskörperschaften in den neuen Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung in Europa entscheidend ist, und er unterstreicht die Bedeutung der Beteiligung der Gebietskörperschaften im Rahmen der Partnerschaftsabkommen; |
|
8. |
unterstreicht den Multiplikatoreffekt und die Hebelwirkung dieser Investitionen über private und öffentliche Kofinanzierungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene; Investitionen der öffentlichen Hand hängen in zahlreichen Mitgliedstaaten in starkem Maße von den Strukturfonds ab, die über 30 % der öffentlichen Investitionen in 13 Staaten und in sechs Mitgliedstaaten sogar über 60 % ausmachen; |
|
9. |
stellt fest, dass keine Klarheit herrscht über den Anteil der Regionen und Kommunen, obwohl vermutet wird, dass ein Großteil des EU-Haushalts von Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, von öffentlichen Stellen, nichtstaatlichen Organisationen, Verbänden ohne Erwerbszweck, privaten Verbänden, Unternehmen, Universitäten und Bildungseinrichtungen, Einzelpersonen usw. verwendet wird, und dass insgesamt ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben und zwei Drittel der öffentlichen Investitionen auf regionaler und kommunaler Ebene getätigt werden; |
|
10. |
ist überzeugt, dass die Gebietskörperschaften eine entscheidende und unersetzliche Rolle bei der Verwirklichung der politischen Ziele der EU spielen. Die Gebietskörperschaften sind unmittelbar oder mittelbar beteiligt an:
|
|
11. |
stellt fest, dass die Regionen und Kommunen mittelbar oder unmittelbar an der Verwaltung von über 75 % der Ausgaben aus dem EU-Haushalt mitwirken (1); |
|
12. |
begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission, Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln entweder unmittelbar von der Europäischen Kommission oder über Behörden auf nationaler und regionaler Ebene bereitzustellen, um die Verantwortung durch mehr Transparenz zu erhöhen, ist jedoch der Ansicht, dass öffentlich zugängliche Informationen unzureichend und zu lückenhaft sind, um einen präzisen Überblick über die von den Gebietskörperschaften verwalteten Ausgaben aus EU-Mitteln zu bekommen; |
|
13. |
bedauert das Fehlen statistischer Daten, die dem Ausschuss der Regionen die Wahrnehmung seiner beratenden Funktion ermöglichen würden, und fordert die Europäische Kommission auf, ab 2014 Folgendes bereitzustellen:
|
|
14. |
fordert die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Europäischen Rat auf, das Verfahren zur Änderung der Haushaltsentwürfe zu straffen und zu harmonisieren, um den Prozess der demokratischen Kontrolle zu erleichtern; |
|
15. |
betont in dieser Hinsicht, dass die Wirksamkeit der EU-Politik von der richtigen Anwendung des Grundsatzes der Multi-Level-Governance abhängt, der als allgemein für die Verwaltung der Strukturfonds geltender Grundsatz angesehen wird (3), wobei alle Regierungs- und Verwaltungsebenen je nach ihren Zuständigkeiten effizient zusammenarbeiten, um die politischen Ziele zu erreichen. Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften können nicht als Mittelempfänger im gleichen Maße wie nichtstaatliche Organisationen, private Verbände, Unternehmen, Bildungseinrichtungen usw. angesehen werden; |
|
16. |
unterstützt die Initiative der Europäischen Kommission zum Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaft (ECCP) als Ergänzung zu der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen; durch den ECCP wird die Partnerschaft bei der Aufstellung, Umsetzung und Bewertung der GSR-Programme und Fonds konkret ausgestaltet und erweitert; er ist der Ansicht, dass eine solche Partnerschaft die beste Gewähr für eine wirksame Nutzung der Ressourcen und die Anpassung an den Bedarf der Region bzw. Gemeinde bietet, und er bedauert, dass der Rat den ECCP nicht in die Verhandlungsbox aufgenommen hat, obwohl dieser Kodex ein wichtiges Verwaltungsinstrument für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 ist; |
|
17. |
fordert die Kommission auf, in verständlicher Weise darüber zu berichten, wie die Gebietskörperschaften rechtzeitig und strukturiert in die Erarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen und der operationellen Programme für 2014-2020 einbezogen wurden; |
|
18. |
bekräftigt die Notwendigkeit, die Verwaltungslasten für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zu verringern, und ersucht die Kommission, den Rat und das Parlament dringend, dies bei der Aufstellung neuer Vorschriften für die Gebietskörperschaften zu berücksichtigen; |
|
19. |
wiederholt seine Forderung an die Europäische Kommission, Vorschläge zu erarbeiten, um die Qualität der öffentlichen Ausgaben in der makroökonomischen Rechnungslegung der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. In diesen Vorschlägen sollte es insbesondere darum gehen, bei der Berechnung des Haushaltsdefizits die laufenden Ausgaben von den Investitionen zu trennen, um zu vermeiden, dass Investitionen mit langfristigem Nettogewinn auf der Negativseite verbucht werden; |
|
20. |
begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission, die öffentlichen Ausgaben für Maßnahmen im Bereich der Klimapolitik im Auge zu behalten; |
Der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
|
21. |
begrüßt, dass am 27. Juni 2013 eine politische Einigung zwischen dem Parlament, dem Vorsitz des Rates und der Kommission über den Mehrjährigen Finanzrahmen für 2014-2020 erzielt wurde; |
|
22. |
ist beunruhigt, dass die Kommission keine ordentliche Risikomanagementstrategie besitzt, um zu gewährleisten, dass die Kohäsionspolitik beim Fehlen eines mehrjährigen Finanzrahmens auf der Grundlage jährlicher Haushaltspläne weiter funktionieren könnte; |
|
23. |
ist insbesondere besorgt, dass die vom Europäischen Rat beschlossene Gesamthöhe des folgenden MFF nicht ausreichend sein könnte, um die ehrgeizigen Ziele der EU in der „Strategie Europa 2020“ und im „Pakt für Wachstum und Beschäftigung“ zu verwirklichen; |
|
24. |
bedauert, dass die Obergrenze des MFR für die Verpflichtungsermächtigungen (960 Mrd. EUR) um 34 Mrd. EUR niedriger ist als für den Zeitraum 2007-2013, und dies in einer Zeit, in der Europa die notwendigen Mittel braucht, um sich von der derzeitigen Krise koordiniert zu erholen, und dass die MFR-Obergrenze (960 Mrd. EUR) um 80 Mrd. EUR niedriger ist als ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen; |
|
25. |
unterstützt die Position des EP, dass die MFR-Verordnung nicht rechtmäßig verabschiedet werden kann, solange keine politische Übereinkunft über die entsprechenden Rechtsgrundlagen vorliegt; |
|
26. |
bedauert, dass bei der Reform des Eigenmittelsystems als Mittel zur Verringerung der Direktzahlungen der Mitgliedstaaten in den EU-Haushalt keine substanziellen Fortschritte erreicht wurden; fordert daher den Rat, die Kommission und das Europäische Parlament auf, unverzüglich über das Mandat und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zum Thema Eigenmittel zu entscheiden, so wie es in der Vereinbarung vom 27. Juni vorgesehen ist, um den Zeitplan einzuhalten und 2014 eine erste Bewertung vornehmen zu können. Die Arbeitsgruppe sollte zum Zeitpunkt der formellen Annahme der MFR-Verordnung zusammentreten; |
|
27. |
begrüßt die Vereinbarung über eine erweiterte Flexibilität im Hinblick auf die volle Ausnutzung der jeweiligen MFR-Obergrenzen, sodass nicht verwendete Mittel automatisch von einem Haushaltsjahr in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können, sowie die obligatorische Überprüfung und anschließende Überarbeitung des MFR bis Ende 2016; |
|
28. |
betont erneut, dass er jede Form der makroökonomischen Konditionalität nachdrücklich ablehnt, und ist der Ansicht, dass die von einigen Mitgliedstaaten gewünschte Option der Ausweitung auf alle Haushaltslinien nicht hilfreich ist, denn so könnten regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht dafür verantwortlich sind, dass ihre Mitgliedstaaten die Anforderungen nicht erfüllt haben, stark benachteiligt werden; bedauert, dass die makroökonomische Konditionalität weiterhin in Art. 6 des Entwurfs einer Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre enthalten ist; |
|
29. |
wiederholt seine Ablehnung einer Leistungsreserve, denn damit könnten wenig ehrgeizige Vorhaben gefördert und die Innovation gebremst werden; bedauert, dass in der politischen Einleitung zum Haushaltsentwurf 2014 auf diese Reserve verwiesen wird; |
|
30. |
unterstützt den Standpunkt des EP, dass die Zustimmung zu der MFR-Verordnung nur erteilt werden kann, sofern eine „absolute Gewähr“ besteht, dass die ausstehenden Zahlungsanträge für 2013 vollständig beglichen werden und dass daher der Rat nicht nur einen formellen Beschluss über den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 2/2013 (7,3 Mrd. EUR) fasst, sondern auch seine politische Zusage einhält, ohne Verzögerung einen weiteren Berichtigungshaushaltsplan anzunehmen (3,9 Mrd. EUR, um die erforderlichen 11,2 Mrd. EUR zu erreichen) (4), und begrüßt hierbei die Tatsache, dass die Kommission sich in ihrem Entwurf des Haushaltsplans 2014 auf die Annahme stützt, dass die beiden Berichtigungshaushaltspläne 2013 angenommen werden; |
|
31. |
betont, dass er genau beobachten wird, ob sich ein langsamer Programmanlauf und eine langsame Mittelaufnahme negativ auf die für 2016 geplante Halbzeitüberprüfung des MFR auswirken werden; |
Das strukturelle Defizit des EU-Haushalts
|
32. |
ist beunruhigt darüber, dass der MFR 2014-2020 ein zusätzliches strukturelles Defizit im EU-Haushalt von 52 Mrd. EUR einführt. Die Gebietskörperschaften, die für ihre Investitionen stark von den EU-Mitteln abhängig sind, sehen dies als sehr gefährliche Tendenz an, denn die Kommission wird wegen fehlender Ermächtigungen nicht rechtzeitig alle eingegangenen Verpflichtungen erfüllen können, und er stellt fest, dass die Schaffung eines solchen strukturellen Defizits im EU-Haushalt den Bestimmungen des Vertrags (Art. 310 und 323 AEUV) zuwiderläuft; |
|
33. |
zeigt sich sehr verwundert darüber, dass selbst unter der Annahme, dass die beiden Berichtigungshaushaltspläne 2013 mit zusätzlichen 11,2 Mrd. Zahlungen für 2013 angenommen werden, dennoch von rund 225 Mrd. EUR (5) RAL Ende 2013 ausgegangen wird, die aus Programmen von 2007-2013 in den neuen Finanzierungszeitraum übergehen werden, was rund 25 % der Obergrenze des MFF für Zahlungen in den Jahren 2014-2020 bzw. 1,6 mal den EU-Haushalt eines Jahres ausmacht; |
|
34. |
stellt fest, dass dieser Betrag zu dem politischen Ziel des EP im Widerspruch steht, den neuen Programmplanungszeitraum mit einem kompletten Neustart zu beginnen, und warnt davor, dass Ende 2020 annähernd 277 Mrd. EUR RAL verbleiben werden (6) und dass diese Kluft bzw. dieses strukturelle Defizit mit jedem MFR zunehmen wird; |
|
35. |
verweist darauf, dass die beiden Bereiche, die am meisten zur Gesamthöhe der RAL beitragen, die Kohäsionspolitik (zwei Drittel des Gesamtbetrags) und die ländliche Entwicklung sind, und empfiehlt Lösungen zu suchen, durch die eine Anhäufung von RAL über die Jahre vermieden wird; |
|
36. |
unterstützt den Aufruf des Europäischen Parlaments an die Kommission, „monatliche Berichte über die Entwicklung der Zahlungsanträge der Mitgliedstaaten für die Strukturfonds, den Kohäsionsfonds, den Fonds für die ländliche Entwicklung und den Fischereifonds (mit einer Aufschlüsselung nach Mitgliedstaat und nach Fonds) vorzulegen“; |
|
37. |
nimmt zur Kenntnis, dass ein Drittel der RAL insgesamt (70,7 Mrd. EUR) 2014 ausgezahlt werden, ist jedoch wie die Europäische Kommission besorgt mit Blick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016; er befürchtet, dass nach dem Jahr 2014 diese Flexibilität im Laufe der Jahre immer geringer ausfallen wird, denn 2014 ist das erste Jahr des neuen MFR mit mehr Spielraum bei den Zahlungsermächtigungen, und die neuen Programme werden Anlaufzeit benötigen (vor allem die Programme mit geteilter Mittelverwaltung); |
|
38. |
unterstreicht in dieser Hinsicht die positive Seite der Einigung über den MFR (7) mit Möglichkeiten für Flexibilität innerhalb des MFR und dem sogenannten „Gesamtspielraum für Zahlungen“ (8); |
|
39. |
zeigt sich besorgt darüber, dass die Kommission keinen Spielraum für das Jahr 2014 vorsieht, denn die Höhe der Zahlungen ist auf 136,1 Mrd. EUR festgesetzt. Das bedeutet, dass die Kommission keinen zusätzlichen Spielraum für 2015 haben wird, und dass das strukturelle Defizit mit der Ausführung der Programme im Zeitraum 2014-2020 und der verbleibenden Altlast aus den Jahren 2007-2013 (+/- EUR 155 Mrd. EUR) erneut anwachsen wird; |
|
40. |
weist darauf hin, dass die Folgen der neuen „n+3“-Regel für die Aufhebung von Mittelbindungen im Bereich der Kohäsionspolitik Auswirkungen auf die Anhäufung von RAL in den kommenden Jahren haben wird. Hier empfiehlt der Ausschuss der Regionen, der Zahlung ausstehender Forderung aus den Jahren 2007-2013 im Zeitraum 2014-2016 Vorrang einzuräumen (70 Mrd. EUR jährlich über die drei Jahre), denn die Zahlungsanträge für den neuen Programmplanungszeitraum werden sich höchstwahrscheinlich 2017-2018 häufen (2014 + 3 Jahre, eingerechnet die Verzögerung beim Anlaufen der Programme im Jahr 2014 wegen der verspäteten Einigung auf den MFR); |
|
41. |
erachtet es als nicht hinnehmbar, dass Zahlungen verzögert werden, und verlangt nachdrücklich, dass die Zahlungsfrist von 60 Tagen für Programme mit geteilter Mittelverwaltung verbindlich sein sollte und bei einem Überschreiten der Frist rechtliche oder finanzielle Sanktionen verhängt werden sollten; zudem sollte die bereits bestehende Geldstrafe (Zinszahlung) für zentral verwaltete Programme (Projekte im Rahmen des siebten Rahmenprogramms bzw. des künftigen Programms „Horizont 2020“) auch für andere Fonds in Betracht gezogen werden, wenn die Zahlungen nicht fristgerecht erfolgen. Dies ist besonders wichtig für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die auf Erstattungen warten. Der Ausschuss der Regionen erwartet daher dafür eine Lösung, die bei der nächsten Überarbeitung der Haushaltsordnung der EU gefunden werden muss; |
|
42. |
bedauert die Zunahme der Zahl der Berichtigungshaushalte während des Haushaltsjahres, die auf den vom Rat, der Kommission und vom Parlament unrealistisch niedrig veranschlagten Zahlungsbedarf zurückzuführen ist. Für 2013 wurden bereits fünf Berichtigungshaushaltspläne aufgestellt, und 2010 gab es zehn davon; |
|
43. |
fordert nachdrücklich von Kommission, Parlament und Rat, Lösungen für die Beseitigung des strukturellen Haushaltsdefizits der EU vorzulegen, damit die bereits gebundenen Einnahmen der Gebietskörperschaften nicht länger von einem Wegfall europäischer Zahlungsermächtigungen bedroht werden; |
Der Entwurf des EU-Haushaltsplans 2014: strategische Prioritäten für die Gebietskörperschaften
Europa 2020
|
44. |
bekräftigt, dass sich die öffentlichen Investitionen der nachgeordneten Ebene mehr und mehr auf eine Reihe von Schlüsselbereichen konzentrieren, die für den Erfolg der Europa-2020-Strategie entscheidend sind; wiederholt seine Forderung, dass der Schaffung von Synergien zwischen den Haushalten der EU, der Mitgliedstaaten und der Regionen und Kommunen mit Blick auf die Erreichung der vereinbarten vorrangigen Ziele der EU eine stärkere politische Priorität eingeräumt werden muss; |
|
45. |
begrüßt die Initiative der Kommission, alle öffentlichen Aufwendungen für die Finanzierung der Europa-2020-Strategie nachzuvollziehen, ist aber überrascht, dass die sieben Leitinitiativen als Grundlage herangezogen werden, und nicht die fünf Kernziele (Beschäftigung, Innovation, Bildung, soziale Eingliederung und Klimawandel / Energie); |
|
46. |
beklagt das Fehlen jeglichen Verweises auf die elf thematischen Ziele aus der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, auf die die Struktur- und Investitionsfonds der EU ausgerichtet werden müssen (9) und die im Einklang mit dem Gemeinsamen strategischen Rahmen gemäß dem Vorschlag der Europäischen Kommission vom 14. März 2012 stehen sollten; |
|
47. |
wiederholt seine Forderung nach mehr Flexibilität, um den territorialen Besonderheiten der Regionen und Städte gerecht zu werden; |
|
48. |
bedauert, dass in der Darlegung der politischen Prioritäten des EU-Haushalts für 2014 kein Hinweis auf das Europäische Semester enthalten ist. bedauert des Weiteren, dass die Kommission die Forderung des EP ignoriert hat, faktengestützte und konkrete Daten dazu vorzulegen, wie der von ihr vorgeschlagene Entwurf des EU-Haushaltsplans tatsächlich eine impulsgebende, katalytische, synergetische und ergänzende Rolle für Investitionen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene übernehmen kann, um die im Rahmen des Europäischen Semesters vereinbarten Prioritäten umzusetzen (10), und verlangt daher zur Wahrung des Grundsatzes des Regierens auf mehreren Ebenen nachdrücklich die Einbeziehung der Regionen, insbesondere der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen, in das Europäische Semester; |
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI)
|
49. |
unterstützt die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und fordert, dass sie Teil künftiger Partnerschaftsvereinbarungen wird; er unterstreicht zugleich, dass die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften umfassend in die Verwirklichung jeglicher Beschäftigungsinitiativen einbezogen werden müssen, denn sie können am besten den Arbeitsmarkt vor Ort und die auf die jungen Menschen zugeschnittenen Programme beurteilen, und viele Regionen sind auch vollumfänglich zuständig für diesen Politikbereich; |
|
50. |
bedauert, dass die YEI parallel zu den anderen Fonds eingerichtet und nicht der ESF zur Bewältigung dieses Problems genutzt wird, woraus sich für die Empfänger zusätzliche Verwaltungslasten ergeben; |
|
51. |
stellt fest, dass die Kommission vorschlägt, sämtliche Ausgaben (6 Mrd. EUR) (11) der YEI in den Jahren 2014-2015 vorzuziehen und regt an, im Sinne einer raschen Umsetzung dieses Vorziehen durch geeignete Maßnahmen zu flankieren (etwa Kapazitätsaufbau), denn der Entwurf der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und der ESF-Verordnung kann nicht vor der MFR-Verordnung, also gegen Ende 2013, verabschiedet werden. Dies wird zu Verzögerungen bei der Umsetzung führen, und zudem bestehen größere Ungewissheiten in Bezug auf die Frage, wie die Mitgliedstaaten/Regionen die YEI praktisch umsetzen und wie schnell die Mittel absorbiert werden; fordert daher insbesondere eine Änderung von Artikel 9 Buchstabe f der MFR-Verordnung, um die ausdrückliche Begrenzung der neuen Haushaltslinie für die Initiative auf 3 Mrd. EUR zu beseitigen. Dies wäre umso notwendiger, um das Zurückstellen von Programmen bis nach 2016 zu vermeiden, die für den Zusammenhalt von kritischer Bedeutung sind, wie die Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder Teile der Fazilität „Connecting Europe“; |
Haushaltskürzungen in entscheidenden Programmen
|
52. |
ist besonders beunruhigt angesichts der Kürzungen unter zahlreichen Haushaltslinien, die entscheidende Bedeutung für die Verwirklichung langfristiger Investitionen für eine rasche wirtschaftliche Erholung besitzen, vorrangig in den Bereichen Kohäsionspolitik, ländliche Entwicklung, COSME oder Horizont 2020; |
|
53. |
fordert im Einklang mit Art. 9 des Entwurfs einer Verordnung des Rates über den MFR vom 27. Juni 2013 das Vorziehen weiterer Verpflichtungsermächtigungen von bis zu 200 Mio. EUR für Horizont 2020, 150 Mio. EUR für Erasmus und 50 Mio. EUR für COSME in den Jahren 2014-2015; |
|
54. |
ist nicht überrascht, dass die Verpflichtungsermächtigungen für die Kohäsionspolitik im Jahr 2014 so gering ausfallen, denn es werden Verzögerungen (12) bei der Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarungen und der operationellen Programme erwartet; fordert die Mitgliedstaaten jedoch auf, sich auf die operationellen Programme zu konzentrieren, um die Mittel bereits 2014 zu aktivieren; |
|
55. |
bedauert die Streichung des Haushaltspostens für einen Erasmus-Austausch gewählter Vertreter der lokalen und regionalen Ebene unter der Rubrik 1b (Haushaltsposten 13 03 77 11) und fordert die Fortführung dieser Initiative ausgehend von den einschlägigen Erfahrungen des AdR; |
|
56. |
begrüßt die Aufstockung der Verpflichtungsermächtigungen für das Programm LIFE+ um 10,3 % gegenüber 2013, erachtet jedoch die Senkung der Zahlungsermächtigungen (– 1,1 %) als unverständlich; |
|
57. |
begrüßt die umfassende Umstellung von der direkten Mittelverwaltung auf die geteilte Mittelverwaltung für den EMFF, auch wenn dies geringere Zahlungen zu Beginn des Finanzierungszeitraums bedeutet; |
|
58. |
begrüßt die in Art. 8 des Entwurfs der MFR-Ratsverordnung aufgenommene Bestimmung, derzufolge der MFR überprüft werden kann, um zusätzlich zu den entsprechenden Ausgabenobergrenzen Mittelzuweisungen auf Folgejahre übertragen zu können, die 2014 nicht verwendet wurden, sofern die Annahme neuer Vorschriften oder Programme mit geteilter Mittelbewirtschaftung erst nach dem 1. Januar 2014 erfolgt; |
Haushaltsflexibilität
|
59. |
begrüßt, dass 351,9 Mio. EUR von der ersten auf die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) übertragen werden sollen, und bringt erneut seine strikte Ablehnung von Übertragungen in umgekehrter Richtung zum Ausdruck; |
|
60. |
betont, dass weder der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 7./8. Februar 2013 noch der Ministerrat in seinem Entwurf einer MFR-Verordnung vom 27. Juni 2013 eine Teilobergrenze für die Kohäsionspolitik vorgesehen haben, die stattdessen in eine Teilrubrik umgewandelt wurde. Ausgehend davon spricht sich der AdR gegen die zahlreichen Verweise auf diese Teilobergrenze in der Einleitung zum Haushaltsentwurf 2014 (13) und für Übertragungen zwischen Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen innerhalb der Rubrik 1 aus, wo dies erforderlich wird; |
|
61. |
begrüßt den „Gesamtspielraum für Wachstum und Beschäftigung“, der innerhalb der Obergrenzen des MFR für Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2014-2017 geschaffen wird, und begrüßt, dass die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen „über die Obergrenzen“ hinaus, die für die Jahre 2017 bis 2020 (14) festgelegt sind, verwendet werden können; er regt an, diese zusätzliche Flexibilität auch für die Rubrik 1b zu nutzen. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Diese Berechnung beruht auf den Verpflichtungsermächtigungen im ursprünglichen Haushaltsplan 2013 und betrifft die folgenden wichtigen Haushaltsposten: Europäischer Sozialfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, Transeuropäische Verkehrsnetze, Life+, Forschungsprogramme, Fischereifonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Kohäsionsfonds, Instrument für Heranführungshilfe, Programm für das lebenslange Lernen, Kultur, Jugend in Aktion, Media 2007, Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument.
(2) RAL: „reste à liquider“ (allgemein verwendeter französischer Ausdruck) — noch abzuwickelnde Verpflichtungen. Die Differenz zwischen der Höhe der Verpflichtungen und der Höhe der entsprechenden Zahlungen pro Jahr ergibt die zusätzlichen RAL oder auch „Altlasten“ für dieses Jahr.
(3) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.
SEC(2011) 1141 final, SEC(2011) 1142 final.
(4) Eine anders lautende Zahl von 16,2 Mrd. EUR war von der Europäischen Kommission mit Blick auf die ausstehenden Zahlungen am Jahresende 2012 genannt worden, aber die europäische Kommission hält sich nunmehr an diese neue Zahl für 2013. Die 11,2 Mrd. EUR betreffen alle EU-Haushaltsrubriken, wobei die Rubrik 1b allein (Kohäsionspolitik) 9 Mrd. EUR ausmacht.
(5) Europäische Kommission, Haushaltsvoranschlag der Europäischen Kommission für das Haushaltsjahr 2014 (Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2014), SEC(2013) 370, Juni 2013, Anhang III — Übersicht über die Auszahlungsanträge, S. 86.
(6) 277 Mrd. EUR ( von 2007-2013 und früheren Zeiträumen, die voraussichtlich 2014-2020 ausgezahlt werden).
von 2007-2013 und früheren Zeiträumen, die voraussichtlich 2014-2020 ausgezahlt werden).
(7) Entwurf einer Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020, 27. Juni 2013, Art. 3A.
(8) Der „Gesamtspielraum für Zahlungen“ bedeutet, dass die Kommission jährlich und beginnend mit dem Jahr 2015 die Obergrenze für die Zahlungen nach oben anpasst um einen Betrag, der der Differenz zwischen den ausgeführten Zahlungen und der Obergrenze des MFR für das Jahr n-1 (Zebu dann 2014) entspricht.
(9) Lambert van Nistelrooij/Constanze Angela Krehl — Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen (…), angenommen am 10. Juni 2013 im Ausschuss des EP, Art. 9: (1) Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation; (2) Verbesserung der Zugänglichkeit sowie der Nutzung und Qualität der Informations- und Kommunikationstechnologien; (3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen, des Agrarsektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF); (4) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft (5) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements; (6) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz; (7) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen; (8) Förderung von nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte; (9) Förderung der sozialen Eingliederung, Bekämpfung von Armut und jedweder Diskriminierung; (10) Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen; (11) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und Förderung einer effizienten öffentlichen Verwaltung.
(10) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2013 zu den allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung des Haushaltsplans 2014, Einzelplan III — Kommission, Ziffer 22.
(11) Etwa das Vorziehen der besonderen ergänzenden Zuweisung in Höhe von 2 143 Mrd. EUR, das in der Vereinbarung zwischen EP und Rat festgelegt wurde (Art. 9f), und die aus den ESF-Mitteln übertragenen 3 Mrd. EUR.
(12) Im Jahr 2006 wurde die allgemeine Verordnung im Amtsblatt Ende Juli veröffentlicht, während diesmal nicht mit einer Veröffentlichung vor November-Dezember zu rechnen ist — das sind fünf bzw. sechs zusätzliche Monate Verzögerung gegenüber dem auslaufenden Finanzierungszeitraum (bei dem es bereits zu einer erheblichen Verzögerung gekommen ist).
(13) Die einzigen vereinbarten Teilobergrenzen betreffen marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen unter der Rubrik 2 und Verwaltungsausgaben unter der Rubrik 5.
(14) Siehe Art. 9g des Entwurfs einer Verordnung des Rates über den MFR.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/23 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Schiefergas und -öl sowie Tight Gas und Tight Öl (Kohlenwasserstoffe aus unkonventionellen Lagerstätten) aus Sicht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
2013/C 356/05
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
ist wie der EU-Umweltkommissar der Meinung, dass bisherige Studien eine Reihe von Unsicherheiten oder Lücken in den geltenden EU-Rechtsvorschriften zutage gebracht haben, betont, dass die Berücksichtigung von Gesundheits- und Umweltrisiken Voraussetzung für die öffentliche Akzeptanz der Industrie ist, und fordert die EU auf, einen Rahmen für das Risikomanagement und die Behebung von Schwachstellen im EU-Recht abzustecken; |
|
— |
verlangt, dass Entscheidungen seitens lokaler und regionaler Behörden über ein Verbot oder eine Einschränkung von Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung beachtet werden. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten das Recht haben, sensible Gebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Dörfer, Anbauflächen usw.) von potenziellen Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung auszunehmen; |
|
— |
unterstreicht die fundamentale Bedeutung des Transparenzgrundsatzes und der Beteiligung der betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Entscheidungsfindung in diesem sensiblen Bereich und ist besorgt, dass bis jetzt diesen Grundsätzen nicht in allen Mitgliedstaaten ausreichend Rechnung getragen wird; |
|
— |
unterstützt den Vorschlag, dass unkonventionelle Kohlenwasserstoffe in Anhang I der überarbeiteten UVP-Richtlinie aufgenommen und somit die einschlägigen Vorhaben verpflichtend einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, und drängt die Europäische Kommission, im Interesse kohärenter und verständlicher Umweltverträglichkeitsprüfungen die Aufstellung gemeinsamer Umweltstandards für die Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe in der EU zu prüfen. |
|
Berichterstatter: |
Brian MEANEY (IE/EA), Mitglied des Grafschaftsrats Clare und der Regionalbehörde Mid-West |
|
Referenzdokument |
Initiativstellungnahme |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
bestätigt, dass Europa erschwingliche, kohlenstoffneutrale, nachhaltige, global wettbewerbsfähige und sichere Energiequellen benötigt — eine enorme Herausforderung für die Europäische Union. Die Mitgliedstaaten müssen daher alle möglichen Alternativen ausloten, und so sind Kohlenwasserstoffe aus unkonventionellen Lagerstätten in den Blickpunkt geraten, wobei es in der EU bislang an einem übereinstimmenden und koordinierten Regelungsrahmen fehlt; erinnert jedoch daran, dass Kohlenwasserstoffe aus unkonventionellen Lagerstätten weder im Hinblick auf den Klimawandel, noch auf die langfristige Energieversorgung nachhaltig und mit hohen Risiken behaftet sind; |
|
2. |
ist sich der erheblichen Umwelt- und Gesundheitsgefahren in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung (Hydraulic Fracturing: horizontale hydraulische Risserzeugung durch Einpressen einer Frackflüssigkeit) bewusst; |
|
3. |
betont, dass die Europäische Kommission klare politische Signale setzen muss, und ruft sie auf, durch geeignete Maßnahmen die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, den zuständigen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die notwendigen Ressourcen zu geben, damit sie den in ihre jeweiligen Zuständigkeiten fallenden Regelungs- und Aufsichtstätigkeiten und -verantwortlichkeiten, insbesondere im Sozial- und Umweltbereich und für die gute Bewirtschaftung aller natürlichen Ressourcen, nachkommen können; |
|
4. |
unterstreicht, dass die Möglichkeit einer 100 %igen Umstellung auf erneuerbare Energien klar im Blick behalten werden muss und die notwendige Aufmerksamkeit und Mittel für die Energiewende nicht auf nichtkonventionelle oder sonstige Energien umgelenkt werden dürfen; räumt ein, dass unkonventionelle Kohlenwasserstoffe eine Rolle als Übergangstechnologie zwischen fossilen und erneuerbaren Energieträgern spielen können; |
A. Allgemeine Grundsätze
|
5. |
stellt fest, dass jeder Mitgliedstaat laut Artikel 194 des Vertrags von Lissabon (2009) das Recht hat, "die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen". Die Meinungen über die Nutzung von Schiefergas gehen dementsprechend EU-weit stark auseinander. Der AdR fordert, dass die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Standpunkte und Ansichten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften von allen Beteiligten und insbesondere der Europäischen Kommission anerkannt, respektiert und berücksichtigt werden, wenn unter Rücksicht auf die vor Ort vorhandenen natürlichen Ressourcen Vorschläge für eine sichere und zuverlässige unkonventionelle Kohlenwasserstoffförderung ausgearbeitet werden; |
|
6. |
eingedenk der Sach- und spezifischen Ortskenntnis der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, der Ressourcenknappheit sowie ferner der erheblichen und vielfältigen Auswirkungen und Risiken der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung verlangt der AdR, dass Entscheidungen seitens lokaler und regionaler Behörden über ein Verbot oder eine Einschränkung von Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung beachtet werden. Er betont, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften das Recht haben sollten, sensible Gebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Dörfer, Anbauflächen usw.) von potenziellen Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung auszunehmen oder diese Tätigkeiten zu untersagen, wenn dadurch die Emissionsreduktionsziele der betreffenden Gebietskörperschaften unterlaufen werden. Ferner sollte die Entscheidungsbefugnis der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hinsichtlich des Verbots von Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung gestärkt werden; erinnert in diesem Zusammenhang an die Verbote der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten, die zum Beispiel in Bulgarien, Frankreich, Luxemburg, dem Schweizer Kanton Fribourg oder der spanischen Region Kantabrien beschlossen worden sind; |
|
7. |
stimmt dem EP darin zu, dass die freiwilligen Leitlinien wie bspw. die Global Reporting Initiative, der Globale Pakt der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, denen zufolge die mineralgewinnende Industrie den negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten Rechnung tragen muss, nicht ausreichen, um die negativen Folgen des Abbaus einzudämmen; |
|
8. |
ist wie der EU-Umweltkommissar der Meinung, dass bisherige Studien eine Reihe von Unsicherheiten oder Lücken in den geltenden EU-Rechtsvorschriften zutage gebracht haben, betont, dass die Berücksichtigung von Gesundheits- und Umweltrisiken Voraussetzung für die öffentliche Akzeptanz der Industrie ist, und fordert die EU auf, einen Rahmen für das Risikomanagement und die Behebung von Schwachstellen im EU-Recht abzustecken; |
|
9. |
fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, die Mitgliedstaaten zur Einschränkung der Entwicklung der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung anzuhalten, bis die Schwachstellen in den relevanten EU-Richtlinien behoben sind; |
|
10. |
geht davon aus, dass es zwar Sache der Mitgliedstaaten ist, welche Energiequellen sie nutzen, indes aber jedwede Entwicklungstätigkeit in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung unter unionsweit fairen und gleichen Ausgangsbedingungen und unter umfassender Beachtung der einschlägigen EU-Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften erfolgen sollte. Der Ausschuss spricht sich für ein klares rechtsverbindliches EU-Regelwerk, vorzugsweise eine Richtlinie über die Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe, aus, die einen angemessenen Schutz gegenüber den Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen durch die Förderung von Schiefergas bieten kann; |
|
11. |
vertritt die Auffassung, dass das Vorsorgeprinzip der EU-Umweltpolitik konsequent EU-weit angewendet und Umweltfolgenschätzungen unabhängig von der Größenordnung der Tätigkeiten zur Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe verpflichtend vorgeschrieben werden sollten, wobei den wirtschaftlichen Interessen, der notwendigen Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung zu tragen ist; |
|
12. |
beharrt darauf, dass im Vorfeld jeder Genehmigung eines Entwicklungsvorhabens in Verbindung mit unkonventionellen Kohlenwasserstoffen eine Ökobilanzierung als Eckstein einer neuen EU-Richtlinie über die Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe vorgeschrieben werden muss; |
|
13. |
unterstreicht die fundamentale Bedeutung des Transparenzgrundsatzes und der Beteiligung der betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Entscheidungsfindung in diesem sensiblen Bereich und ist besorgt, dass bis jetzt diesen Grundsätzen nicht in allen Mitgliedstaaten ausreichend Rechnung getragen wird; |
B. Allgemeines
|
14. |
stellt fest, dass jüngste technologische Fortschritte in bestimmten Weltregionen die Förderung unkonventionellen Gases im industriellen Maßstab beschleunigt haben, insbesondere in den USA, wo Schiefergas vorgeblich einen Paradigmenwechsel herbeigeführt hat; indes ist sich der AdR der technischen und wirtschaftlichen Grenzen der Schiefergasförderung in der EU bewusst. Es wird immer deutlicher, dass in Europa kein den USA vergleichbarer Schiefergas-Boom stattfinden wird (1). Europäische unkonventionelle Gasressourcen dürften bestenfalls den Rückgang bei der konventionellen Erdgasproduktion ausgleichen, denn ihre Förderung wird u.a. durch unterschiedliche geologische Voraussetzungen (2), Rechtsvorschriften und eine höhere Bevölkerungsdichte eingeschränkt. Der AdR räumt ein, dass in diesem Bereich noch umfangreiche Bewertungsarbeiten erforderlich sind; |
|
15. |
stellt zudem fest, dass die Ausbeute von Bohrungen nach unkonventionellen Kohlenwasserstoffen sehr viel rascher sinkt als bei der konventionellen Förderung, sodass immer wieder neue Bohrungen gesetzt werden müssen, was die Produktionskosten in die Höhe treibt; weist jedoch darauf hin, dass die Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten mit Hilfe moderner Techniken erfolgt, z.B. Horizontalbohrungen oder Multi-Well-Pads (mehrere Bohrungen von einem Bohrplatz aus), durch die die Auswirkungen auf die Umwelt und die Umgebung eventuell eingedämmt werden können; |
|
16. |
ist in Anbetracht der aktuellen Gaspreise der Ansicht, dass das Schiefergas-Potenzial zu gering ist, um die europäische Erdgasversorgungslage spürbar zu beeinflussen. Selbst ein beschleunigter Ausbau der Schiefergasförderung in Europa würde höchstens mit einem einstelligen Prozentsatz zur europäischen Gasversorgung beitragen. An der immer weiter sinkenden einheimischen Produktion und der steigenden Importabhängigkeit würde sich nichts ändern (3). Der AdR räumt ein, dass in diesem Bereich noch weitere Bewertungsarbeiten erforderlich sind; |
|
17. |
ist sich bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit von Schiefergas womöglich durch eine nachlässige Rechtsetzung begünstigt worden ist, zumal u.a. die Ausnahme von Schiefergas von einer Reihe Umweltschutzvorschriften eine der treibenden Kräfte hinter dem US-amerikanischen Schiefergas-Boom ist: So fallen bspw. die der Frackflüssigkeit hinzugefügten chemischen Begleitstoffe unter den Patentschutz und müssen nicht offengelegt werden; unterstreicht deshalb mit Nachdruck, dass für die Genehmigung entsprechender Vorhaben in der Europäischen Union eine Offenlegung aller chemischen Bestandteile und ihres Anteils an der Frackflüssigkeit unbedingt zu fordern ist; |
|
18. |
stellt fest, dass das Bohren nach Schiefergas und Tight Öl infolge der Sondenplätze, der Stellplätze und des Manövrierbereichs für Lastkraftwagen, der Bohrausrüstung, der Gasaufbereitungs- und -transportanlagen sowie der Zufahrtswege unvermeidlich zu sehr hohem Flächenverbrauch führt, der städtische und ländliche Siedlungen und natürliche Lebensräume in ihrem Bestand bedrohen kann. Die wichtigsten nachweislichen und potenziellen Folgen sind Luftverschmutzung, Grundwasserverschmutzung durch unkontrollierte Gas- oder Flüssigkeitsströme infolge von Ausbrüchen oder Freisetzungen, Leckagen von Frackflüssigkeit und unkontrollierten Einleitungen von Abwässern. Frackflüssigkeit enthält gefährliche Stoffe, und der Flowback enthält dazu noch aus dem Untergrund gelöste Schwermetalle und radioaktive Stoffe. Somit stellen Schiefergas-Bohrungen ein höheres Risiko für die menschliche Gesundheit (4) und die Umwelt dar als die Förderung anderer fossiler Brennstoffe (5), zumal mehr Bohrungen gesetzt werden müssen, um eine vergleichbare Fördermenge zu erzielen; |
|
19. |
ist besorgt darüber, dass die aktuellen bergrechtlichen und sonstigen für den Bergbau in Europa maßgebenden Vorschriften den spezifischen Aspekten der Entwicklung der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung keine Rechnung tragen. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den bergrechtlichen Vorschriften der EU-Mitgliedstaaten. Häufig bricht Bergrecht Bürgerrechte und die Behörden vor Ort haben keinen Einfluss auf potenzielle, von nationalen Behörden genehmigte Vorhaben oder Bergbaustandorte; weist außerdem darauf hin, dass in Europa, anders als in den Vereinigten Staaten, die Landbesitzer in der Regel keine automatischen Besitzrechte an den Bodenschätzen unter ihrem Land haben, sodass sie auch nicht in allen Fällen von deren Ausbeutung profitieren; |
|
20. |
fordert, da dies ein grundlegend wichtiger Aspekt für jedwede Energieplanung und/oder energiepolitische Maßnahme ist, eine korrekte Bewertung des tatsächlichen Potenzials unkonventionellen Erdgases in Europa als Übergangsressource auf dem Weg zu einem höheren Anteil erneuerbarer Energieträger am Energiemix in der gesamten EU, wie dies bspw. im für die Energiezukunft Europas richtungsweisenden Energiefahrplan 2050 dargestellt wird. Eine solche Bewertung sollte auch die Prüfung der Möglichkeit einer systematischeren Nutzung lokaler Energiequellen ermöglichen. Ein Ziel dieser Planungen und Maßnahmen muss es sein, den Umstieg auf zukünftige, wettbewerbsfähige Energieträger mit möglichst geringem CO2-Ausstoß so zu gestalten, dass die EU gegenüber anderen Weltregionen wettbewerbsfähig wird. Die Förderung von Schiefergas bedeutet nicht nur eine unvorhersehbare Gefährdung von Umwelt, Klima und Gesundheit, sondern könnte auch die Entwicklung der erneuerbaren Energieträger untergraben und die Abhängigkeit Europas von fossilen Energieträgern noch weiter steigern. Die Förderung von Schiefergas sollte ebenso wenig wie die CCS-Technologie als politisches Ziel unabhängig von den Bedürfnissen der Bürger vorangetrieben und auch nicht als grüne Option für die Energiezukunft Europas beworben werden. In Anbetracht seiner hohen Kohlenstoffintensität, des erforderlichen Ausbaus und der notwendigen Investitionen ist zu klären, inwieweit Schiefergas als Übergangsbrennstoff geeignet ist. Durch die aufgrund des US-Schiefergas-Booms sinkenden Gaspreise könnten die Wirtschaftlichkeit kohlenstoffarmer Alternativen beeinträchtigt werden und nationale Fördermechanismen unter Druck geraten; |
|
21. |
sieht mit Sorge, dass unkontrollierte Methanemissionen, die das 20- bis 25-fache Treibhauspotenzial von CO2 aufweisen, durch die weltweite Zunahme der Exploration und Gewinnung von Schiefergas stark zunehmen könnten und dass sich das Klima aufgrund des Treibhauspotenzials von Schiefergas um mehr als 3,5°C aufheizen könnte (6). (Als zumutbare Höchstgrenze gelten 2°C.) Ferner könnte die Gewinnung unkonventioneller Öl- und Gasvorkommen das Erreichen des UN-Millenniumsentwicklungsziels (MDG) 7 — "Ökologische Nachhaltigkeit sicherstellen" — behindern und die jüngsten, in der Kopenhagener Vereinbarung verankerten internationalen Klimaschutzverpflichtungen untergraben; |
|
22. |
befürwortet eine verstärkte EU-seitige Förderung von Forschung und Entwicklung im Ökodesign-Bereich über die Struktur- und Kohäsionsfonds und die Europäische Investitionsbank, wobei eventuelle wettbewerbsverzerrende Wirkungen neuer Standards nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Der AdR begrüßt die von der Kommission vorgenommene vorläufige Einschätzung der auf unkonventionelle Kohlenwasserstoffe anzuwendenden EU-Umweltvorschriften und fordert die Kommission dringend auf,
|
Technische Aspekte in Verbindung mit einer — vom AdR bevorzugten — Richtlinie
C. Bestandsaufnahme
|
23. |
fordert die Kommission auf, der Industrie die Bereitstellung unabhängiger, verifizierbarer Analysen der Umweltvoraussetzungen in den Gebieten, für die Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung vorgeschlagen werden, vorzuschreiben:
|
D. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
|
24. |
stellt mit Sorge fest, dass die geltende UVP-Richtlinie nicht das tägliche Fördervolumen von unkonventionellen Kohlenwasserstoffen berücksichtigt. Trotz ihrer Umweltauswirkungen muss deshalb für die einschlägigen Projekte keine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip und in Übereinstimmung mit der Forderung des Europäischen Parlaments in seiner Entschließung vom 21. November 2012 unterstützt der AdR den Vorschlag, dass unkonventionelle Kohlenwasserstoffe in Anhang I der überarbeiteten UVP-Richtlinie aufgenommen und somit die einschlägigen Vorhaben verpflichtend einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden; |
|
25. |
drängt die Kommission, im Interesse kohärenter und verständlicher Umweltverträglichkeitsprüfungen die Aufstellung gemeinsamer Umweltstandards für die Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe in der EU zu prüfen; |
|
26. |
ist sich des Mangels an Erfahrung und Sachkunde in Europa bewusst; betont, dass eine angemessene Regulierung der Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe auch von den Zuständigkeiten und Ressourcen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften abhängt; sieht es als erforderlich an, im Zusammenhang mit unkonventionellen Kohlenwasserstoffvorkommen die Zuständigkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu erweitern und ihre personellen Ressourcen auszubauen; |
E. Wasser
|
27. |
ist angesichts der Tatsache, dass die unkonventionellen Kohlenwasserstoffe aus einer Tiefe von mehr als 2 km gefördert werden, der Meinung, dass die Bohrungsintegrität und die Qualität des Bohrloch-Casings und der Bohrloch-Zementation ausschlaggebend für die Vermeidung von Grundwasserverschmutzung sind. Bei 6 % der Bohrungen in den USA sind Undichtigkeiten aufgetreten (7); |
|
28. |
verlangt, dass jeder Frack-Vorgang überwacht und die maximale Rissausbreitung und die Distanz der Risse zu Grundwasserleitern protokolliert werden; |
|
29. |
fordert die Kommission auf, die Industrie im Fall von Methanaufstieg oder Ausspülung natürlich vorkommender radioaktiver Stoffe ins Grundwasser oder bei der Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch eine Freisetzung anderer Stoffe, bei der Erzeugung weiterführender Risse bis hin zu Grundwasserleitern oder bei Undichtigkeiten von Bohrloch-Casings oder -Zementation zu Korrekturmaßnahmeverfahren zu verpflichten; |
|
30. |
besteht darauf, dass das Abbinden des Zements verpflichtend protokolliert und die Verrohrung der Bohrung sowie ihre Zementation vor jedweder Frackingtätigkeit einem Drucktest unterzogen werden; |
|
31. |
betont, dass eine wirksame Vorsorge eine konsequente Überwachung der genauen Einhaltung der etablierten anspruchsvollsten Standards und Verfahren bei Bohrungskonstruktionen voraussetzt; betont, dass sowohl die Industrie als auch die zuständigen Behörden regelmäßige Qualitätskontrollen der Bohrloch-Casings und -Zementation vornehmen sollten; |
|
32. |
plädiert dafür, dass die Betreiber, die Regulierungsbehörden und die Notfalldienste gemeinsam verpflichtende Notfallpläne für die Vermeidung, Eindämmung und Bekämpfung der Folgen von Kontaminationen (Spill Prevention, Control and Countermeasure (SPCC) Plans) aufstellen; |
|
33. |
spricht sich für die Festlegung von Mindestabständen zwischen Sondenplätzen und öffentlichen oder privaten Quellen oder Brunnen aus; |
|
34. |
weist darauf hin, dass die Abfälle und die Abwässer, die bei der Ausbeutung unkonventioneller Kohlenwasserstoffvorkommen anfallen, eine Reihe von Problemen im Hinblick auf die sichere Lagerung, das Recycling und die Entsorgung aufwerfen, und es daher entsprechender Regulierung bedarf; in diesem Zusammenhang ist die Beteiligung der betroffenen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die häufig die Verantwortung für die Abfallbewirtschaftung tragen, unerlässlich; |
F. Abfallbewirtschaftung
|
35. |
fordert, dass das bei der hydraulischen Risserzeugung anfallende Abwasser so wiederverwendet werden muss, dass das Undichtigkeits- und Austrittsrisikos möglichst gering ist; nimmt das bei der hydraulischen Risserzeugung anfallende hohe Abwasservolumen mit seiner unterschiedlichen Schadstofffracht zur Kenntnis; hält die Wiederverwendung von Frack- und Lagerstättenwasser in einem geschlossenen Kreislauf vor Ort unter Einsatz von stählernen Lagertanks während der Exploration und Erschließung der Lagerstätten für eine Möglichkeit zur Behandlung des Flowback bei gleichzeitiger Senkung des Wasserverbrauchs, des Leckagepotenzials an der Oberfläche und der Kosten/des Verkehrsaufkommens/der Straßenschäden, die durch den Transport des Flowback zu Entsorgungseinrichtungen verursacht werden; spricht sich aufgrund des höheren Undichtigkeits- und Austrittsrisikos gegen die Weiternutzung von offenen, mit Plastikfolie ausgekleideten Abwassergruben aus; |
|
36. |
fordert die Veröffentlichung der Menge und der Zusammensetzung der Frackflüssigkeit, die nach Durchführung einer Frackingmaßnahme nicht wieder gefördert wird, sowie — unter Berücksichtigung der Boden- und Gesteinsbeschaffenheit — ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Bodenwasser und Fauna; |
|
37. |
betont, dass kommunale und nationale Abfallentsorgungs- bzw. Klär- und Klärschlammentsorgungsanlagen womöglich nicht über die für das Volumen und die Zusammensetzung des Abwassers erforderlichen Kapazitäten oder technischen Voraussetzungen verfügen; spricht sich dafür aus, dass die Betreiber in Zusammenarbeit mit den Abfallwirtschaftsbehörden und den zuständigen Regulierungsbehörden Abwasserbehandlungsnormen und verpflichtende Wasserwirtschaftspläne aufstellen; |
|
38. |
verweist darauf, dass in geologischen Formationen natürlich vorkommende radioaktive Stoffe von Gesteinsschicht zu Gesteinsschicht unterschiedlich sind; betont die Notwendigkeit einer Analyse der radioaktiven Bestandteile des Untergrunds vor der Erteilung von Fördergenehmigungen; |
G. Chemikalien
|
39. |
sieht mit Sorge, dass es derzeit auf EU-Ebene keine Verpflichtung zur Offenlegung der Zusammensetzung der Frackflüssigkeiten gibt; spricht sich für vollständige Transparenz und zwingende Offenlegung seitens der Betreiber aus sowie für die Berücksichtigung der betreffenden Informationen bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen; appelliert an die Kommission, zu prüfen, welche Art Rechtsvorschrift am besten geeignet ist, um eine solche Verpflichtung auf EU-Ebene einzuführen; |
|
40. |
ruft nach verstärkten Anstrengungen zur Entwicklung von Frackflüssigkeiten mit Additiven, die die geringstmögliche Toxizität und das niedrigstmögliche Umweltgefährdungspotenzial aufweisen; |
H. Boden, Luft und weitere Parameter
|
41. |
betont, dass die geologischen Eigenschaften einer Region ausschlaggebend für das Förderkonzept und –verfahren sind; befürwortet eine aktive und frühzeitige Einbeziehung der nationalen geografischen Institute sowie der betroffenen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften; spricht sich dafür aus, dass vor der Erteilung einer Genehmigung eine verpflichtende geologische Analyse der tiefen geologischen Schichten und des oberflächennahen Bereichs potenzieller Schiefergasformationen durchgeführt und Berichte über jedwede frühere oder gegenwärtige Bergbautätigkeiten in der Region vorgelegt werden müssen; plädiert ferner für die Anfertigung von Bohrungsprotokollen; |
|
42. |
nimmt zur Kenntnis, dass durch Abteufung mehrerer horizontal abgelenkter Bohrungen von einem Sondenplatz aus der Flächenverbrauch und die Beeinträchtigung der Landschaft sinken; |
|
43. |
befürwortet einen "grünen" Ausbau der Bohrung (Komplettierung) zur Senkung und womöglich zum Auffangen von Methanemissionen; |
|
44. |
weist darauf hin, dass Unfälle an den Bohrplätzen häufig auf ungeschultes Personal, Fahrlässigkeit oder Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind; |
|
45. |
empfiehlt die Aufstellung standardisierter Notfallpläne und die Einrichtung speziell geschulter Notfall-Teams; |
I. Einbeziehung der Öffentlichkeit und öffentliche Gesundheit
|
46. |
fordert eine gezielte Überwachung der Gesundheit der Menschen, die in der Nähe von Bohrplätzen wohnen; empfiehlt die Einrichtung einer regionalen Gesundheitsdatenbank; |
|
47. |
empfiehlt, dass die Information der Öffentlichkeit über Tätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung durch Gruppen lokaler und externer Experten sichergestellt wird, die in Kenntnis der lokalen ökologischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen eine objektive Betrachtung aller Nutzungsphasen unter Hervorhebung der wirtschaftlichen Vorteile wie auch der sozialen und ökologischen Risiken bieten können; |
|
48. |
ist der Auffassung, dass die Einbeziehung der Öffentlichkeit vor der Exploration im Wege der verpflichtenden Durchführung unterschiedlicher, effektiver, partizipativer Planungsinstrumente und -methoden und Anhörungen sichergestellt werden sollte; fordert auf, eine breitere Basis abhebende öffentliche Bildungsmaßnahmen, um Verständnis, Akzeptanz und Vertrauen der Öffentlichkeit mit Blick auf die Regulierung der Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung zu ermöglichen; |
J. Stillgelegte, verwaiste, fehlgeschlagene Bohrungen und Flowback-Abwassergruben
|
49. |
empfiehlt den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, in Anbetracht früherer Erfahrungen die Hinterlegung einer finanziellen Garantie in Höhe von 150 % der Kosten für die korrekte Verschließung und Versiegelung jedes Bohrlochs im Hinblick auf seine Außerbetriebnahme zu verlangen. Darin einzurechnen sind die Kosten für den gesamten Materialaufwand und die Expertentätigkeit für die Ausführung der Arbeiten und die Abschlussbewertung; |
|
50. |
fordert ferner die Hinterlegung finanzieller Garantien bei den lokalen Gebietskörperschaften zur Gewährleistung der bestmöglichen Verfahrensweisen bei den Bohrungs- und Frackingtätigkeiten. Diese Garantie muss hoch genug bemessen sein, um Sanierungsmaßnahmen auch dann sicherzustellen, wenn das betreffende Unternehmen nicht mehr besteht; |
|
51. |
verlangt, dass die Industrie finanzielle und weitere Vorkehrungen trifft, um bewährte Verfahrensweisen bei der Sanierung der Anlagen für die Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe sicherzustellen; |
|
52. |
fordert, dass die lokalen Gebietskörperschaften, die über die einschlägigen Zuständigkeiten verfügen, in den Gebieten, in denen Entwicklungstätigkeiten in Verbindung mit der Exploration und Förderung unkonventioneller Kohlenwasserstoffe stattfinden oder stattgefunden haben, mit den erforderlichen Ressourcen für eine Langzeit-Überwachung der Luft- und Grundwasserqualität ausgestattet werden; |
K. Verwaltungslast und Ressourcen der lokalen Gebietskörperschaften
|
53. |
stellt fest, dass die in mehreren Phasen ablaufende Entwicklung von Schiefergasformationen durch die notwendige Kontrolle der Einhaltung von Planungsvorschriften, Umweltüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen einen erhöhten Verwaltungsaufwand erfordern kann. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften über die dafür notwendigen Ressourcen verfügen; |
L. Soziale und wirtschaftliche Folgen für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
|
54. |
gibt zu bedenken, dass der auf lokalen und regionalen Gebietskörperschaften lastende finanzielle Druck, wirtschaftliche Interessen und die Aussicht auf eine partielle Energieunabhängigkeit dazu führen, dass die Analyse der sozialen Risiken heruntergespielt wird und eine unumkehrbare Entwicklung ihren Lauf nimmt; |
|
55. |
stellt eingedenk der Erfahrungen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften mit Auf- und Abschwungsphasen in der mineralgewinnenden Industrie Folgendes fest:
|
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Dr. Werner Zittel, Shale Gas — European Perspectives, Europäisches Parlament, 14. Mai 2013.
(2) http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/shale-gas/Documents/cee-shale-gas-2.pdf
(3) Europäisches Parlament:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110715ATT24183/20110715ATT24183DE.pdf
(4) Human health risk assessment of air emissions from development of unconventional natural gas resources, Lisa M. McKenzie, Roxana Z. Witter, Lee S. Newman, John L. Adgate, Colorado School of Public Health, University of Colorado, Anschutz Medical Campus, Aurora, Colorado, USA.
(5) http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
(6) IEA, Golden Rules for a Golden Age of Gas, S. 91.
(7) Methane Migration Data, Pennsylvania Department of Environmental Protection.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/30 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Grünbuch zu einer europäischen Strategie für Kunststoffabfälle in der Umwelt
2013/C 356/06
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
fordert die Europäische Kommission auf, bis 2020 ein Deponieverbot für Kunststoffe und hochentzündliche Abfälle zu erlassen sowie spezifische und ehrgeizige Ziele für die Vermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Kunststoffabfällen einzuführen, die in allen einschlägigen Richtlinien aufeinander abgestimmt werden und die Umweltgewichtung der Stoffe widerspiegeln sollten; Zwischenziele und Übergangszeiträume könnten eingeplant und mit den Mitgliedstaaten vereinbart werden; |
|
— |
ersucht die Europäische Kommission, die Finanzierung künftiger Infrastrukturen für ein wirksames Recycling von Kunststoffen zu erwägen und die Finanzierung für Deponien und Abfallverbrennung einzustellen; Anlagen für die energetische Verwertung sollten nur dann aus EU-Mitteln gefördert werden, wenn sie Teil eines schlüssigen Abfallbewirtschaftungskonzepts sind, das eine ausreichende Infrastruktur für die vorgeschalteten Stufen der Abfallhierarchie umfasst; |
|
— |
plädiert für die umfassende Anwendung des Verursacherprinzips und fordert die Europäische Kommission auf zu prüfen, wie die erweiterte Herstellerverantwortung in der EU am besten angewandt werden kann. Auf europäischer Ebene sollten ein Pfand auf bestimmte Kunststoffartikel und Artikel mit Kunststoffanteilen und eine Rücknahmeverpflichtung in Erwägung gezogen werden. Für Sperrmüll sollte eine verursacherbezogene Abfallgebührenerhebung („pay as you throw“) im Rahmen der von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften festgelegten Abfallsammlungsverfahren gefördert werden. Neben Anreizen für die Wiederverwendung sollte ein Verbot der kostenlosen Abgabe von Plastiktüten in Erwägung gezogen werden; |
|
— |
plädiert dafür, beim Produktdesign auf die Verwendung von wenigen einheitlichen und nicht mit anderen Materialien verbundenen Kunststoffen zu achten, und ferner durch eine deutliche Deklarierung der Kunststoffart auf Verpackungen und Produkten ihre Wiederverwendung und Wiederverwertung zu vereinfachen; spricht sich für einen verbindlichen Mindestanteil an recyceltem Material in künftigen Überprüfungen des Designs aus; |
|
— |
fordert eine internationale Einigung über ein Verbot der Nutzung zersetzbarer Mikrokugeln aus Kunststoff in Kosmetika und anderen Körperpflegeprodukten, um zu vermeiden, dass diese relativ neuartige Verschmutzungsquelle in die Nahrungsmittelkette gelangt; hält ein Verbot oxo-abbaubarer Kunststoffe für begründet, bis der Mehrwert dieser Produkte durch weitere Forschungsergebnisse gesichert ist. |
|
Berichterstatterin |
Linda GILLHAM, Mitglied des Bezirksrats von Runnymede (UK/EA) |
|
Referenzdokument |
Grünbuch zu einer europäischen Strategie für Kunststoffabfälle in der Umwelt COM(2013) 123 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
begrüßt das Grünbuch zu Kunststoffabfällen in der Umwelt. Eine optimale Abfallbewirtschaftung ist eine der größten Herausforderungen für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, sowohl in Bezug auf die Verringerung der Umweltbelastung durch ein vermehrtes Abfallaufkommen über die Schaffung und Finanzierung der Infrastruktur für die Abfallbehandlung und -entsorgung als auch in Bezug auf den Erhalt natürlicher Ressourcen; |
|
2. |
weist darauf hin, dass dennoch die Abfallvermeidung die höchste Priorität haben muss. Neben einer Optimierung der Abfallbewirtschaftung stellen umfassende und ambitionierte Strategien zur Vermeidung von Abfällen die größte Herausforderung dar; |
|
3. |
fordert in diesem Zusammenhang die umfassende Anwendung des Verursacherprinzips als eines der wirksamsten Verfahren für die Abfallvermeidung, das die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beim Erreichen ihrer Ziele im Abfallbereich unterstützen und gleichzeitig auch ihre finanzielle und organisatorische Belastung verringern könnte; |
|
4. |
ist sich bewusst, dass höhere Zielvorgaben für Abfallvermeidung, -sammlung und -recycling nur durch eine aktive Mitwirkung der Haushalte machbar sind. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften können den Bürgerinnen und Bürgern Informationen an die Hand geben und Anlagen bereitstellen, um einerseits ihre Verbrauchsgewohnheiten zu beeinflussen und um andererseits die Bandbreite und die Qualität der gesammelten Stoffe zu steigern. Hierfür müssen Kunststoffabfälle jedoch als potenziell wertvolle Ressource begriffen und anerkannt werden; |
|
5. |
macht darauf aufmerksam, dass nicht nur im Bereich der privaten Haushalte Kunststoffabfälle anfallen, sondern insbesondere auch die Industrie (z.B. der Fahrzeugbau), die Bauindustrie sowie andere gewerbliche Bereiche viel stärker in den Fokus genommen werden müssen, da diese Sektoren einen sehr hohen Kunststoffverbrauch haben; |
|
6. |
ist sich ferner der Unterschiede bei der Abfallbewirtschaftung unter den Mitgliedstaaten bewusst. Aus vielerlei Gründen, einschließlich des Widerstands der Öffentlichkeit, kommen in vielen Mitgliedstaaten Investitionen in Abfallentsorgungseinrichtungen nur langsam in Gang, mit langen Vorlaufzeiten bis zur tatsächlichen Einrichtung der Infrastruktur; |
|
7. |
bedauert die mangelnde oder schleppende strategische Planung im Rahmen der einzelnen Glieder der Abfallbewirtschaftungskette: Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling, Sammelsysteme, Behandlungsanlagen, Marktinitiativen. Sichere Märkte werden nur dann entstehen, wenn eine ausreichende Menge an Kunststoff-Rezyklat vorhanden ist; |
|
8. |
fordert die Europäische Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die bestehenden EU-Umweltvorschriften in allen 28 Mitgliedstaaten vollständig um- und durchgesetzt werden; stellt derzeit einen Mangel an Ressourcen für die Durchsetzung und Überwachung fest; |
|
9. |
begrüßt die Absicht, die Deponierichtlinie 2014 einer Überprüfung zu unterziehen; diese sollte auch ein Deponieverbot für Kunststoffe und hochentzündliche Abfälle bis 2020 einschließen. Der AdR erkennt an, dass die Abfallwirtschaft und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Zeit, Geldmittel und Sicherheit für Investitionen in eine geeignete Infrastruktur für Sammlung, Sortierung, Recycling und eine effiziente Endverarbeitung benötigen. Auch wenn im Rückstand befindliche Mitgliedstaaten eventuell einen Einführungszeitraum für ein Verbot benötigen, müssen alle Kunststoffabfälle, wie im Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa vorgesehen, als Ressource bewirtschaftet werden, um die 2020-Ziele zu erreichen; |
|
10. |
weist darauf hin, dass zwar in sieben Mitgliedstaaten weniger als 10 % der Abfälle deponiert werden, die Deponierate in elf Mitgliedstaaten jedoch bei über 60 % liegt. Bei der Abfallbewirtschaftung muss der spezifische Wert von Kunststoff durch bessere und effizientere Sammelsysteme anerkannt werden, um eine Kontaminierung weitestmöglich in Grenzen zu halten; |
|
11. |
fordert die Europäische Kommission auf, in künftigen Überprüfungen einen integrierten Ansatz für alle Kunststoffe zu entwickeln, der auch Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Altfahrzeuge und Verpackungsabfälle einschließt. Die Ziele der Abfallrahmenrichtlinie sind zu niedrig angesetzt und nicht speziell auf Kunststoffabfälle ausgerichtet; |
|
12. |
betont nachdrücklich, dass bei neuen Zielen für Kunststoff das Thema Tonnage überdacht werden sollte, da sie insbesondere bei sehr leichten Kunststofffolien zur Messung ungeeignet ist. Die Ziele sollten die jeweilige Umweltgewichtung der Stoffe widerspiegeln, um den Wert von Kunststoffen zu erhöhen, der im Vergleich zu schwereren wiederverwertbaren Stoffen häufig zu gering angesetzt wird; |
|
13. |
weist darauf hin, dass sich alle Mitgliedstaaten das Konzept der Energieerzeugung aus Abfällen als legitime Alternative zur Deponierung der nach Wiederverwertung und Recycling verbleibenden Restabfälle zu eigen gemacht haben; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Anlagen für die energetische Verwertung nur dann aus EU-Mitteln gefördert werden dürfen, wenn diese Teil eines schlüssigen Abfallbewirtschaftungskonzepts sind, das eine ausreichende vorgeschaltete Infrastruktur für die Sortierung, die Reinigung und die stoffliche Verwertung der gesammelten Abfälle umfasst. Da Kunststoffe als Brennstoff einen hohen Brennwert haben, müssen nach Ansicht des EWSA für Kunststoffe zudem materialspezifische Ziele für die stoffliche Verwertung auf der Grundlage der Verarbeitungskapazität aufgestellt werden, um die Nachfrage nach Brennstoff zu vermeiden, die zur Verbrennung wertvoller Ressourcen führen könnte; |
|
14. |
hält eine bessere Durchsetzung der bestehenden Ziele für erforderlich. Er unterstützt ferner neben der Abfallverlagerung weg von Deponien die Einführung verbindlicher, spezifischer und ehrgeiziger, gleichzeitig aber auch erreichbarer Ziele für die Vermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Kunststoffabfällen, da diese genauer messbar sind. Diese Ziele müssen in allen einschlägigen Richtlinien aufeinander abgestimmt werden. Zwischenziele und Übergangszeiträume könnten eingeplant und mit denjenigen Mitgliedstaaten und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften vereinbart werden, die bei den Abfallzielen keine zufriedenstellenden Fortschritte vorweisen können; |
|
15. |
plädiert dafür, dass diese Ziele im Einklang mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, der örtlichen Nähe und der Vorsorge festgelegt werden; |
|
16. |
ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen Kunststoffabfälle in der Abfallhierarchie nach oben bringen werden, und begrüßt die Forderung des Europäischen Parlaments nach einem Deponieverbot für alle recyclingfähigen Abfälle und Bioabfälle bis 2020, warnt jedoch vor der möglichen Gefahr eines zunehmenden Exports von Kunststoffmüll in außereuropäische Länder, wenn das Recycling von Kunststoffen in der EU nicht weiter ausgebaut wird; |
|
17. |
ruft zu mehr Recycling von Kunststoffen in allen Phasen auf, um eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Bereits beim Entwurf von Produkten sollte nicht nur an die Wiederverwertung am Ende des Lebenszyklus, sondern auch an eine sparsamere Nutzung der bei der Produktion eingesetzten Polymere sowie auf die Verwendung von wenigen einheitlichen und nicht mit anderen Materialien verbundenen Kunststoffen gedacht werden, um die Trennung für die Wiederverwertung zu vereinfachen; |
|
18. |
fordert die Europäische Kommission auf, ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen zu fördern, mit stärkeren Anreizen für Abfallvermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und einen höheren Anteil an recyceltem Kunststoff in neuen Produkten; |
|
19. |
ersucht die Europäische Kommission, die Finanzierung künftiger Infrastrukturen für ein wirksames Recycling von Kunststoffen zu erwägen und die Finanzierung für Deponien und Abfallverbrennung einzustellen, gleichzeitig aber den Markt für Kunststoff-Rezyklat zu unterstützen und so Arbeitsplätze zu schaffen; |
|
20. |
erkennt an, dass die EU ihre Abhängigkeit von Rohstoffen durch die Rückführung von Rohstoffen in den Wertstoffkreislauf verringern kann und dass die energetische Verwertung entsprechend der Abfallhierarchie eine ergänzende Option bleiben sollte, um das volle Potenzial des weg von der Deponie verlagerten Abfalls auszuschöpfen. Im Sinne des Grünbuchs sollte jedoch kein „Staubsauger-Effekt“ zugunsten der energetischen Verwertung ausgelöst werden; |
|
21. |
hält es für wichtig, dass die Abfallsammlung an der Haustür verpflichtend ist, aber auch so gestaltet sein sollte, dass Mülltrennung und die Verwertung recycelbarer Stoffe hoher Qualität unterstützt werden. Dies ist eine Frage der Subsidiarität, und während sich die Wiederverwertung von trockenen Abfällen aus gemischter Sammlung in einigen Mitgliedstaaten als sehr wirksam erwiesen hat, muss gleichzeitig anerkannt werden, dass in städtischen und ländlichen Gebieten und auch in den einzelnen Ländern unterschiedliche Sammelverfahren eingesetzt werden. Zwar eignet sich ein Einheitskonzept nicht, aber einige gute Gründe sprechen für eine freiwillige Rationalisierung und Standardisierung der Sammelverfahren; |
|
22. |
wiederholt seine Auffassung, dass es Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit regionaler Gebietskörperschaften bei Zentren für die Abfallbewirtschaftung und -behandlung für ähnliche Gebäude, d.h. Wohnhochhäuser, gibt, die für eine effiziente Bewirtschaftung der Abfallströme und eine optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Ressourcen sorgt; |
|
23. |
vertritt die Meinung, dass eine anspruchsvolle Verwertung durch die aktive Unterstützung des Markts für recycelten Kunststoff gefördert und umweltfreundliche Materialien propagiert werden müssten, damit weniger Kunststoffmaterial in die Umwelt gelangt; |
|
24. |
bedauert, dass die aktuelle Berichterstattung über Wiederverwertungsziele im Rahmen der Abfallrahmenrichtlinie auf der Sammlung und nicht auf dem tatsächlichen Recycling oder der energetischen Verwertung basiert. Die Begriffsbestimmungen müssen dringend geklärt werden, und für die Verwertungsleistung wird eine einheitliche Berechnungsmethode benötigt; |
|
25. |
nimmt zur Kenntnis, dass die Europäische Kommission bereits ein Förderprogramm für die zehn Mitgliedstaaten aufgelegt hat, die bei der Abfallpolitik am schlechtesten abschneiden; bedauert, dass 18 Mitgliedstaaten noch weit vom Erreichen der Ziele der Abfallrahmenrichtlinie entfernt sind; |
|
26. |
hält ein Bündel von Maßnahmen für erforderlich, da die Verlagerung von Abfällen weg von Deponien hin zum Recycling nicht mit einem einzigen Politikinstrument herbeizuführen sein wird. Recycling ist jedoch nicht immer eine gangbare Strategie, da das Recycling von Kunststoff technisch kompliziert und wirtschaftlich nicht immer gerechtfertigt ist, auch wenn aus Umweltgründen alles dafür spricht; |
|
27. |
sieht die EU in einer geeigneten Position, um global zum Vorreiter für ein Deponieverbot von Kunststoff zu werden; sie sollte sich um einen Austausch bewährter Verfahren der Abfallbewirtschaftung auf der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Ebene bemühen. Die EU sollte nachhaltige Initiativen fördern und sicherstellen, dass Recyclingunternehmen Wertstoffe nur in Recyclinganlagen schicken, die denselben Managementverpflichtungen unterliegen wie Anlagen in der EU. Makler sind keine Recyclingunternehmen, weswegen der AdR eine stärkere Überwachung der Anwendung der Verordnung über die Verbringung von Abfällen in europäischen Häfen fordert; |
|
28. |
bringt erneut seine Unterstützung für die Schaffung einer europäischen Plattform für Informationen zum Ausdruck, die den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften den Austausch von Informationen über die Abfallvermeidung und -bewirtschaftung innerhalb und außerhalb der EU ermöglichen würde; |
|
29. |
ist sich bewusst, dass Kunststoffe weltweit in Umlauf kommen, daher ist eine gute Design-Praxis in Bezug auf Wiederverwendung, Reparatur und Wiederverwendbarkeit über die Grenzen der EU hinaus wirksam und wird dazu beitragen, dass aus Gegenständen aus Kunststoff kein künftiger Müll im Meer wird; |
|
30. |
weist darauf hin, dass viele Konsumgüter, insbesondere Elektro- und Elektronikgeräte, außerhalb der EU hergestellt und aufgrund der hohen Arbeitskosten in der EU anschließend für die Zerlegung, Wiederverwertung oder Entsorgung wieder exportiert werden. Ausgehend vom Grundsatz der Abfallentsorgung im Nahbereich empfiehlt der AdR den Aufbau einer Infrastruktur für die Wiederverwertung und Wiederverwendung innerhalb eines EU-Rahmens, damit die Mitgliedstaaten die in der EU vor Ort vorhandene Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur wirksam nutzen können und unnötige Mehrfachinvestitionen vermieden werden. Auf diese Weise könnten Kunststoffabfälle in Nachbarländern behandelt werden, ohne dass in allen Mitgliedstaaten verschiedene Arten von Recyclinganlagen gebaut werden müssen, während die spezielle Infrastruktur für die Sonderbehandlung bestimmter Abfallarten in der gesamten EU geplant werden könnte, was eine überflüssige Häufung gleicher Anlagen vermeiden würde. Der AdR hält das Vorhandensein und die Durchsetzung geeigneter Grenzkontrollen bezüglich der Verbringung von Abfällen für erforderlich; |
|
31. |
sieht zwar freiwillige Maßnahmen als eine Ergänzung zu Rechtsvorschriften, jedoch werden einige rechtliche Regelungen erforderlich sein, um einen wirksamen, effizienten, sicheren und nachhaltigen Rahmen für Abfälle zu schaffen; ist der Ansicht, dass die Europäische Kommission Maßnahmen erwägen sollte, um die Verbraucher und Haushalte zu informieren und Verhaltensänderungen zu bewirken, bevor Steuern oder Verbote eingesetzt werden; |
|
32. |
fordert die Europäische Kommission auf zu prüfen, wie die erweiterte Verantwortung von Herstellern und Importeuren insbesondere in Bezug auf Kunststoffabfälle, für deren Behandlung häufig die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zuständig sind, in der EU besser angewandt werden kann. Durch eine bessere Anwendung dieser Verantwortung könnten Produkte auf den Markt gebracht werden, die weniger Kunststoffabfälle bzw. solche Kunststoffabfälle erzeugen, die leichter recycelbar sind. Auf europäischer Ebene sollten ein Pfand auf bestimmte Kunststoffartikel und Artikel mit Kunststoffanteilen und eine Rücknahmeverpflichtung am Ende des Lebenszyklus des Artikels angedacht werden, um die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften so von einer großen Last zu befreien; hält die Förderung von Rücknahmesystemen im Einzelhandel, in Schulen und am Arbeitsplatz für sinnvoll, da so größere Mengen der getrennten wertvollen Ressourcen zusammenkommen, was das Recycling wirtschaftlicher macht. Beispiele hierfür sind u.a. Mobiltelefone und Druckerpatronen; |
|
33. |
ist der Auffassung, dass eine verursacherbezogene Abfallgebührenerhebung („pay as you throw“) in den von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aufgestellten Verfahren für die Abfallsammlung auch für Sperrmüll gefördert werden sollte, gekoppelt mit Bewusstseinsbildung sowie verstärkter Kontrolle der Abfallwege, um zu verhindern, dass (Kunststoff-) Abfälle vermehrt außerhalb technisch entsprechend ausgerüsteter Anlagen, z.B. im Hausofen, verbrannt oder wild abgelagert werden; |
|
34. |
verweist auf die Möglichkeit, Pfand- und Rücknahmesysteme auf Einzelfallbasis zu entwickeln. Die Rücknahme von Getränkeflaschen und -behältnissen wird in einigen Mitgliedstaaten erfolgreich angewandt und liefert hochwertige Stoffe, die recycelt werden können. Dies könnte in ländlichen Gebieten, wo sich eine getrennte Sammlung nicht lohnt, eine wertvolle Alternative sein. Auch die Sammlung von Kunststoffen wie PET (Polyethylenterephthalat) kann von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften weiter gefördert werden, und zwar durch Pläne für ökologische Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen, außer wenn umweltfreundliche Alternativen zu PET-Flaschen zur Verfügung stehen; |
Ökodesign
|
35. |
hält das Produktdesign für den Schlüssel zur Verringerung von Abfällen. Der Schwerpunkt der Ökodesign-Richtlinie liegt derzeit auf dem Wasser- und Energieverbrauch, bei einer Überprüfung könnte jedoch der Anwendungsbereich auf weitere Kunststofferzeugnisse erweitert werden und dann auch Vorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Maßnahmen gegen die geplante Obsoleszenz, für die Reparaturfähigkeit und das Recycling mit Informationen für den Verbraucher bezüglich der Langlebigkeit eines Produkts einschließen (z.B. ein „Produktpass“ für ein Produkt). Die Produktgestaltung ist wichtig für die Verbraucher, aber auch für die Abfallbewirtschaftungsbehörden, die für die Behandlung der Produkte am Ende ihres Lebenszyklus verantwortlich sind. Ein gutes Design eines Produkts und der damit verbundenen Verpackung und Zerlegung wird der Wiederverwendbarkeit Rechnung tragen und diese verbessern; |
|
36. |
macht auf den Trend zu „Leichtgewichtverpackungen“ und die Einführung von Standbeuteln im Verpackungsdesign von Verkaufsverpackungen aufmerksam (wobei der Trend weg von Glas oder Metall hin zu Kunststoffen geht), was die Transportkosten und somit den CO2-Ausstoß verringert; weist jedoch auch darauf hin, dass sich — auch wenn hiervon alle profitieren — ein solcher Trend als sehr profitabel für die Hersteller erweisen, jedoch zu Lasten höherer Sammlungs- und Behandlungskosten für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften gehen könnte; |
|
37. |
hält in diesem Zusammenhang eine Reduzierung von Plastiksorten (Kunststoffzusammensetzung) für erforderlich, damit ein Einschmelzen von sortierten kompatiblen Kunststoffen ermöglicht wird. Hierzu gehört auch eine deutliche Deklarierung der Kunststoffart auf Verpackungen und Produkten, um das Sortieren zu erleichtern; zudem sollten in Kunststoffen keine POP (Persistent Organic Pollutants) und von der REACH-Verordnung gebannte Chemikalien enthalten sein; |
|
38. |
ist der Ansicht, dass Leitlinien für ein nachhaltiges Produktdesign über den gesamten Lebenszyklus, einschließlich der Behandlung am Ende des Lebenszyklus, dem Anwender den wahren Wert eines Gegenstands näher bringen und dazu beitragen werden, dass wertvolle Ressourcen nicht unnötig vergeudet werden; |
|
39. |
spricht sich für einen verbindlichen Mindestanteil an recyceltem Material in künftigen Überprüfungen des Designs aus, ist sich aber gleichzeitig der Notwendigkeit bewusst, dass für Gegenstände, die für Lebensmittel und Gesundheitszwecke genutzt werden, besondere Anforderungen an die Stoffe gelten müssen; |
|
40. |
fordert die schrittweise Abschaffung von gefährlichen Stoffen in Kunststoffen sowohl in neuen als auch in recycelten Erzeugnissen, um die mit ihrer Verwendung verbundenen Risiken zu verringern und ihre Recyclingfähigkeit zu erhöhen; unterstützt den Vorschlag aus dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, bis 2020 alle relevanten besonders besorgniserregenden Stoffe in die REACH-Kandidatenliste aufzunehmen, wodurch die einschlägigen Kunststoffzusatzstoffe erfasst würden; fordert in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit für Mikrokunststoffteilchen und Nanopartikel, die neuartige Probleme verursachen, die nicht unbedingt in der REACH-Verordnung behandelt werden; |
|
41. |
fordert in Bezug auf das Ökodesign besondere Aufmerksamkeit für 3-D-Drucker, deren Entwicklung erhebliche Auswirkungen auf die quantitative und qualitative Erzeugung von Kunststoffabfällen haben könnte; |
Einweg-Kunststoffe für den einmaligen Gebrauch
|
42. |
hält verschiedene Maßnahmen für den Umgang mit Wegwerf-/Einweg-Kunststofferzeugnissen für den einmaligen Gebrauch für erforderlich, darunter auch Bestimmungen, um ihren Einsatz zu verringern und den Einsatz von Mehrwegerzeugnissen zu fördern. Ohne jegliches Umweltbewusstsein- weggeworfene Plastiktüten und leere Getränkeflaschen aus Kunststoff sind das Sinnbild unserer Wegwerfgesellschaft und verschandeln unsere Umwelt. Neben Anreizen für die Wiederverwendung hat ein Verbot der kostenlosen Abgabe von Plastiktüten in verschiedenen Regionen positive Ergebnisse gezeitigt und sollte daher in Erwägung gezogen werden; |
|
43. |
ist der Überzeugung, dass freiwillige Initiativen auf der nationalen Ebene, einschließlich der Rücknahmeverpflichtung durch den Einzelhandel, dazu beitragen könnten, die Kosten für die Behandlung einiger Kunststoffabfälle von den Abfall- und Umweltbehörden auf die gesamte Wertschöpfungskette zu verteilen. Solche Maßnahmen müssen auch Programme zur Aufklärung der Verbraucher umfassen; |
|
44. |
vertritt die Auffassung, dass Rücknahmesysteme gefördert und auf andere, häufig besuchte Orte ausgeweitet werden könnten (Arbeitsplätze und Schulen betreiben oft vergleichbare kleine Systeme, über die sie eine wirtschaftliche Menge an Recyclingmaterial zusammenbekommen); |
Biologisch abbaubare Kunststoffe
|
45. |
ist besorgt, dass die Verbraucher durch den Begriff „biologisch abbaubar“ in die Irre geführt werden könnten, da diese Kunststoffe häufig nur bei hohen Temperaturen in industriellen Kompostieranlagen zersetzt werden können; |
|
46. |
hält es für wichtig, zwischen abbaubar, biologisch abbaubar und kompostierbar zu unterscheiden. Diese Begriffe werden häufig fälschlicherweise synonym verwendet. Ein Kunststoff kann abbaubar, aber nicht biologisch abbaubar bzw. nur kompostierbar sein; |
|
47. |
hält eine Vereinheitlichung und Vereinfachung für grundlegend bei der Kennzeichnung für die Verbraucher; ist jedoch besorgt, dass manche Informationen verwirrend oder irreführend sind und entfernt werden müssten. Informationen über geeignete Recyclingverfahren und den Anteil an recyceltem Material sollten leicht verständlich sein; |
|
48. |
ist ferner besorgt, dass der Begriff „biobasierte Kunststoffe“ für ein gutes ökologisches Gewissen sorgen könnte, obwohl die für die Herstellung verwendete Biomasse eventuell nicht nachhaltig ist oder mit der Landnutzung für Nahrungspflanzen konkurrieren könnte, und spricht sich für die Förderung und Unterstützung der Erforschung und Entwicklung von Biokunststoffen aus. Dabei soll grundlegend auf ökologisch verträgliches Design geachtet werden — u.a. betreffend Rohstoffe (möglichst aus Abfällen), betreffend Zusatzstoffe (umwelt- und gesundheitsverträglich), betreffend Reparierbarkeit (gut reparierbar), betreffend Verwertbarkeit, betreffend Zersetzbarkeit; |
|
49. |
fordert daher die umfassende Anwendung bestehender europäischer Standardnormen, z.B. EN 13432 und EN 14995, für Kompostierbarkeit (sowohl industriell als auch in Privathaushalten), biologische Abbaubarkeit und Abbaubarkeit in geeigneten Umgebungen wie Boden, Salz- und Süßwasser, Kläranlagen und der anaeroben Zersetzung mit dem Ziel, ein EU-weites Kennzeichnungssystem zu schaffen, mit dem diese Angaben eindeutig unterschieden werden können; |
|
50. |
fordert eine internationale Vereinbarung für ein Verbot der Nutzung zersetzbarer Mikrokugeln aus Kunststoff in Gesichtspeelings, Zahnpasta und anderen Körperpflegeprodukten, um zu vermeiden, dass diese relativ neuartige Verschmutzungsquelle in die Nahrungsmittelkette gelangt; |
|
51. |
gibt zu bedenken, dass „oxo-abbaubare“ Kunststoffe nur mit Hilfe eines Oxidationsmittels fragmentierbar und nicht biologisch abbaubar sind, wobei bei der Fragmentierung die Gefahr besteht, dass Mikro-Kunststoffpartikel in die Umwelt gelangen. Es wurde herausgefunden, dass oxo-abbaubare Kunststoffe, wenn sie in den Recyclingprozess gelangen, das recycelte Material kontaminieren und seine Qualität verschlechtern. Somit könnte auch für oxo-abbaubare Kunststoffe ein Verbot gefordert werden, bis der Mehrwert dieser Produkte durch weitere Forschungsergebnisse gesichert ist; |
Abfälle im Meer
|
52. |
teilt die im Grünbuch vertretene Auffassung, dass „ein Großteil der Abfälle in unserer Meeren und Ozeanen aus Kunststoff“ besteht und dies ein ernsthaftes weltweites Problem darstellt. Ist der Ansicht, dass die Verringerung der Menge der Kunststoffe, die in die Meeresumwelt gelangen, eine Priorität für alle am Lebenszyklus von Kunststoff beteiligten Akteure sein muss; |
|
53. |
sieht die Notwendigkeit weiterer Analysen, um die Quellen, den Transportweg und das Vorhandensein von Makro- und Mikrokunststoffabfällen in der Umwelt zu erforschen. Ferner müssen die Auswirkungen dieser mikroskopisch kleinen Teilchen auf die Flora und Fauna des Meeres erforscht werden; |
|
54. |
fordert eine intensivere Überwachung und Datenerhebung, um den Erfolg oder das Scheitern bestimmter Maßnahmen zu beurteilen und mögliche Lösungswege zu entwickeln; ist der Auffassung, dass ein spezielles Ziel für die Verringerung von Abfällen im Meer nur aufgestellt werden kann, wenn genaue Angaben zur Menge der derzeit im Meer vorhandenen Abfälle vorliegen; |
|
55. |
empfiehlt ein zweigleisiges Vorgehen:
Die land- bzw. küstengestützte Strategie stützt sich auf die oben dargelegten Maßnahmen, während die meeresgestützte Strategie von der besseren Durchsetzung des MARPOL-Übereinkommens (Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe) und anderer Übereinkommen abhängt; |
|
56. |
empfiehlt eine stärkere politische Koordinierung und Durchsetzung zwischen der EU und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (als der für die Sicherheit im Seeverkehr und die Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe zuständigen Organisation der Vereinten Nationen); |
|
57. |
erkennt die in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie aufgestellten Ziele für Abfälle im Meer an und weist darauf hin, dass alle neuen Ziele den bestehenden Zielen im Abfallbereich entsprechen sollten. Für Kunststoff könnten spezielle Ziele ins Auge gefasst werden, diese sollten jedoch INTELLIGENT und nicht rein auf eine Verringerung ausgerichtet sein. Die im Rahmen von MARPOL aufgestellten Regeln für Abfälle und Ressourcen müssen jetzt besser durchgesetzt werden; |
|
58. |
verweist auf die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Partner für die Sensibilisierung. Wissen über die Verbreitung von Kunststoffabfällen in Flüssen und Meeren ist eine Voraussetzung für die Beseitigung und die Verringerung des Ausmaßes des Problems. Dies kann die Förderung von Aufklärungsprogrammen in Schulen, die Anregung zu einem verantwortungsbewussten Verhalten in der Tourismusindustrie und Initiativen seitens der Kunststoffindustrie umfassen. Die Einführung von „Europäischen Umweltreinigungswochen“ oder ähnlichen Initiativen mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit würde auf das Problem aufmerksam machen; |
|
59. |
regt eine Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihren Partnern an, um hilfreiche „Umweltreinigungsinitiativen“ stärker zu fokussieren. Bei Küsten- und Strandreinigungstagen und in Abfallbehältern am Strand wird zwar nur ein kleiner Teil des Abfalls gesammelt, aber diese Maßnahmen tragen dazu bei, in den betroffenen Orten auf das Problem aufmerksam zu machen. Kampagnen der Fischereiwirtschaft wie „Fishing for Litter“, bei denen die Fischer an Tagen, an denen sie nicht zum Fischfang ausfahren, Abfall aus dem Meer fischen und diesen dann im nächsten Hafen und nicht nur in ihrem Heimathafen abladen und fachgerecht entsorgen können, könnten gefördert werden; der AdR unterstützt Pläne der Europäischen Kommission, 2014 einen europaweiten „Reinigungstag“ zu veranstalten, und bietet an, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei dieser Initiative zu prüfen; |
|
60. |
ist der Ansicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Kosten für Abfälle im Meer nicht allein tragen können, und fordert eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Mitgliedstaaten auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen und zwischen allen betroffenen Institutionen, den Wasserbehörden, Hafenbehörden und der Abfallwirtschaft, um kostenwirksame Wege zu finden, damit Kunststoffabfälle nicht in die Meeresumwelt gelangen; |
|
61. |
fordert einen Ausbau der Wissensgrundlage durch von der EU geförderte Programme wie LIFE+ oder EFRE zur Untersuchung der Auswirkungen von Kunststoffabfällen sowohl im Boden als auch in der Meeresumwelt; |
Schlussbemerkung
|
62. |
fordert alle an der Abfallbewirtschaftung beteiligten Akteure auf, gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Aufkommen und die Auswirkungen von Kunststoffen in der Umwelt sowie der Rohstoffeinsatz verringert werden, und das Potenzial von Kunststoff als wertvolle Ressource anzuerkennen. Dies ist eine Herausforderung, da Kunststoff kostengünstig und in zahlreichen Anwendungen vielseitig einsetzbar ist, durch seine Langlebigkeit aber ein dauerhaftes Problem schafft. Die weltweit zunehmende Konzentration von Kunststoffabfällen im Meer ist alarmierend, aber es wird auch erkannt, dass der größte Teil dieses unkontrollierten Eintrags seinen Ursprung an Land hat. Plastikmüll gehört nicht in die Umwelt, egal wo! |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/37 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel
2013/C 356/07
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
ist der Ansicht, dass die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels genauso relevant sein können wie die lokalen Folgen für einige europäische Städte und Regionen, und hält es deshalb für notwendig, den Fokus der Anpassungsstrategien über die EU hinaus zu erweitern; |
|
— |
erachtet grüne Infrastruktur als klassische „Low-regret-“ und „Low-cost“-Anpassungsoption, die die Resilienz urbaner Gebiete steigern kann; |
|
— |
zeigt sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft außerordentlich besorgt; |
|
— |
hält es für notwendig, in der Strategie mehr darauf zu achten, die Anpassung auf lokaler Ebene auszubauen, wo die Folgen am deutlichsten wahrgenommen und die ersten Gegenmaßnahmen ergriffen werden; |
|
— |
ist der Auffassung, dass die Finanzausstattung für die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene wichtig ist; |
|
— |
anerkennt die Bedeutung lokaler und regionaler Netze im Bereich der Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen und spricht sich für eine entsprechende finanzielle Unterstützung dieser Netzwerke durch EU-Mittel aus. Der AdR rät gleichwohl davon ab, neue Organisationen zu schaffen oder eine freiwillige Verpflichtung zur Durchführung von Anpassungsmaßnahmen einzuführen, wie in der Strategie empfohlen wird. Dies würde zu Doppelarbeit führen, die Beteiligten verwirren und könnte wertvolle Ressourcen vergeuden. Die Mittelausstattung des bestehenden Bürgermeisterkonvents sollte aufgestockt und das Gremium neu ausgerichtet werden als ein Netzwerk mit dem Schwerpunkt Klimapolitik in den beiden Bereichen Eindämmung und Anpassung; |
|
— |
stellt abschließend fest, dass sich die vorgeschlagene Überprüfung der Strategie im Jahr 2017 angesichts der gebotenen Eile nicht nur auf eventuelle Fortschritte der nationalen Anpassungsstrategien und auf die Frage konzentrieren sollte, ob künftig Rechtsvorschriften erforderlich seien, sondern dass zu diesem Zeitpunkt auch eine Reihe von Etappenzielen für die Umsetzung auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen erreicht sein sollte. Die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel sollte durch Orientierung und Unterstützung für die Gebietskörperschaften wie für die Mitgliedstaaten für das Erreichen dieser Etappenziele flankiert werden. |
|
Berichterstatter |
Neil SWANNICK (UK/SPE), Mitglied des Stadtrates von Manchester |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Eine EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel COM(2013) 216 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
geht davon aus, dass das für 2015 erwartete Klimaschutzübereinkommen nicht nur Maßnahmen zur Eindämmung, sondern auch zur Anpassung beinhalten wird. Wenn dieses Übereinkommen gerecht sein soll, ist die Entwicklung von Klimaresilienz — insbesondere der ärmsten und schutzbedürftigsten Länder der Welt — von ganz entscheidender Bedeutung; |
|
2. |
betont, dass die Eindämmung des Klimawandels der beste Weg zur Behandlung und Vorbeugung zahlreicher zentraler Herausforderungen ist. Je intensivere und ehrgeizigere Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ergriffen werden, desto weniger Anpassungsmaßnahmen werden erforderlich sein; |
|
3. |
stellt fest, dass die Welt mit einer CO2-Konzentration von nunmehr 400 ppm (Teile pro einer Million Teile Luft) eine gefährliche Schwelle überschritten hat; |
|
4. |
fordert die Verhandlungsführer der EU auf, sich ambitionierter für den Abschluss eines Übereinkommens im Jahr 2015 einzusetzen, das unmissverständlich auch die Umstellung des globalen Energiesystems umfasst, und dafür auch um internationale Unterstützung zu werben; |
|
5. |
ist sich voll und ganz bewusst, dass viele Entwicklungsländer von einer schleichenden Entwicklung des Klimawandels, wie einem Anstieg des Meeresspiegels und steigenden Temperaturen, betroffen sind, die die Gefahren extremer Wetterereignisse weiter verschärfen und die Chancen für eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene erheblich schmälern; |
|
6. |
betont, dass Wasserressourcen unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind und dass das diesbezügliche Ressourcenmanagement auch Auswirkungen auf Ökosysteme, die pflanzliche und tierische Erzeugung, sozioökonomische Aktivtäten und die menschliche Gesundheit hat; |
|
7. |
fordert den Rat und die Kommission auf, den AdR nicht nur an den Arbeiten zur Eindämmung des Klimawandels, sondern auch an den technischen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm von Nairobi zu beteiligen, das sich mit der vom Ökosystem ausgehenden Anpassung und der biologischen Vielfalt befasst; |
Anpassung und Resilienz
|
8. |
begrüßt den Verweis auf Resilienz im Rahmen der EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und deren übergreifendes Ziel, den Aufbau eines „klimaresilienten Europas“ zu fördern. Der AdR ist der Auffassung, dass es sinnvoll ist, die Anpassung an den Klimawandel als einen Aspekt der Resilienz einzustufen. Eine Stadt kann sich von einem (klimatisch oder anderweitig bedingten) systemischen Schock erholen, wenn sie über hohe Resilienz verfügt; bei niedriger Resilienz kann sie jedoch ernsthaft geschwächt werden; |
|
9. |
erachtet es für grundlegend, Verbindungen zwischen der Anpassung an den Klimawandel, dem Katastrophenrisikomanagement und den für das Notfallmanagement zuständigen Gemeinschaften zu schaffen; |
|
10. |
ist der Auffassung, dass Anpassung im Kontext der Resilienz
|
|
11. |
ist der Auffassung, dass negative Auswirkungen des Klimawandels selbst dort zu erwarten sind, wo starke Anpassungsmaßnahmen durchgeführt wurden und das Ziel der Begrenzung der globalen Erwärmung auf durchschnittlich 2 °C eingehalten wird. Die Entwicklung von Resilienz gegenüber solchen Ereignissen ist vorrangig, weshalb es angemessener ist, den Begriff „Klimaresilienz“ anstatt „Klimasicherung“ zu verwenden; |
|
12. |
ist der Ansicht, dass die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels genauso relevant sein können wie die lokalen Folgen für einige europäische Städte und Regionen aufgrund der Auswirkungen auf die globalen Logistik- und Lieferketten, Ernährungssicherheit und Migration (von Menschen, Flora, Fauna sowie die Ausbreitung von Krankheiten); hält es deshalb für notwendig, den Fokus der Anpassungsstrategien über die EU hinaus zu erweitern. Ebenso wie Entwicklung und Zusammenarbeit, Lebensmittel und Energie globale Aufgaben sind, muss dies angesichts der potenziellen Gefahren und des möglichen Nutzens für die EU auch für die Anpassung gelten; |
|
13. |
stellt fest, dass sich die Forschung auch den Auswirkungen des Klimawandels auf das Kulturerbe widmet, und macht sich dafür stark, dass Anpassungsstrategien auch die Bewertung der Vulnerabilität von Kulturgütern wie Gebäuden, Kunstwerken und Archiven sowie ihre Exposition gegenüber extremen Wettereignissen und Umweltverschmutzung beinhalten sollten; |
|
14. |
erachtet grüne Infrastruktur als klassische „Low-regret-“ und „Low-cost“-Anpassungsoption, die die Resilienz urbaner Gebiete dank Senkung der Oberflächentemperaturen und des Regenwasserabflusses steigern kann. Ein auf natürlichen und urbanen Systemen basierender Ansatz ist wichtig: z.B. Verwaltungsgrenzen überschreitende Umweltkorridore, die die klimabedingte Migration von Wildtieren erleichtern. Deshalb ist es sinnvoll, Ökosysteme oder grüne Infrastruktur als „kritische“ Infrastrukturen zu fördern; |
|
15. |
ist der Ansicht, dass gesunde Ökosysteme und große Biodiversität die Resilienz der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften gegen den Klimawandel erhöhen werden, und betont, dass diese Systeme selbst auch durch den Klimawandel bedroht sind. Dies sollte in der EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, den nationalen Anpassungsstrategien und den EU-Programmen stärker berücksichtigt werden; |
Anpassung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
|
16. |
begrüßt die in der EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel gezogene Verbindung zwischen der Anpassung an extreme Wetterereignisse und Gefahren des Klimawandels und der Wahrung des wirtschaftlichen Wohlstands Europas in der Zukunft, weist aber darauf hin, dass Maßnahmen, die die Anpassung fördern, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, nicht zu Lasten des sozialen Wohlergehens und der Gesundheit gehen dürfen; |
|
17. |
sieht die erheblichen unmittelbaren Kosten im Zusammenhang mit den Gefahren von Wetter und Klima, z.B. bei Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen. Deshalb sollten Anpassungsmaßnahmen, die sowohl die Nachrüstung bestehender Anlagen als auch die Berücksichtigung der Resilienz bei künftigen Maßnahmen — im Bereich Bahnstrecken und Wohnungsbau — umfassen, gefördert werden; |
|
18. |
stellt fest, dass Versicherungsunternehmen zu der Auffassung gelangen können, dass Flächen, Gebäude und Infrastrukturen einer Stadt oder einer Region nicht ausreichend gegen die Gefahren des Klimawandels geschützt sind. Dies kann die Versicherbarkeit einschränken oder zu höheren Deckungskosten führen. Gebiete mit solchen Problemen könnten Schwierigkeiten beim Erreichen ihrer Wachstumsziele haben, und einige städtische Gebiete könnten nicht mehr versicherbar werden. Es ist deshalb zu begrüßen, dass sich die Kommission mit dem vorlegten Grünbuch „Versicherung gegen Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen“ dieser Thematik annehmen wird; |
|
19. |
hält es für wichtig, die durch den Klimawandel verursachten Kosten zu beziffern, damit der Wert der vorausschauenden Maßnahmen verglichen werden kann. Dies würde die wirtschaftlichen Chancen der Anpassung und die vermiedenen Kosten verdeutlichen. Der sog. Stern-Report hat die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels bereits analysiert. Weitere Forschung in diesem Bereich sollte angeregt werden, um die Entwicklung einer wirtschaftlichen Perspektive für die Einbindung von Anpassungsbelangen in die politischen und strategischen Maßnahmen zu fördern; |
|
20. |
tritt ein für einen Lebenszyklusansatz bei der Kosten-Nutzen-Analyse von Kapital zur Gewährleistung einer langfristigen Amortisierung von Investitionen in die Klimaresilienz. Es sollte zur Auflage gemacht werden, dass bei Bilanzen und Risikoregistern die wirtschaftlichen, umweltspezifischen und sozialen Auswirkungen derjenigen Maßnahmen und Kapitalinvestitionen berücksichtigt werden, die den Klimawandel außen vor lassen; |
|
21. |
misst dem Risiko, das Wetterextreme und Klimawandel bezüglich der Unterbrechung von Infrastrukturnetzen und -systemen bergen, eine zentrale Bedeutung für Anpassungsstrategien bei. Wetter- oder Klimarisiken, wie der Ausfall eines Umspannwerkes oder einer Serverzentrale, können mittelbare Auswirkungen haben oder Kettenreaktionen auslösen, die viele Wirtschaftsbranchen und Dienstleistungen in Mitleidenschaft ziehen; |
|
22. |
stellt fest, dass die Verbindungen zwischen sozioökonomischen Systemen, Klimawandel und Infrastrukturen zu Veränderungen der Reisepräferenzen oder Energieverbrauchsgewohnheiten führen können, was sich erheblich auf Nachfrage und Angebot von Infrastrukturdiensten auswirkt; |
|
23. |
zeigt sich über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft außerordentlich besorgt und fordert daher, dass mit den einschlägigen europäischen Politiken auch auf die Stärkung der Klimaresilienz dieser wesentlichen primären Produktionsbereiche und der Ökosysteme, die sie überhaupt erst ermöglichen, abgezielt wird; |
Zielwert für die Anpassung
|
24. |
stellt fest, dass bezüglich der künftigen atmosphärischen Konzentration von Treibhausgasen und des entsprechenden Temperaturanstiegs und der Folgen Unsicherheit besteht. Die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel zielt auf die Anpassung an die Auswirkungen einer weltweiten Erwärmung um 2 °C ab. Die Wissenschaft geht jedoch ebenso wie der Vierte Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) (1) davon aus, dass bei der gegenwärtigen atmosphärischen CO2-Konzentration (wenn sie lediglich unverändert bleibt) eine Erwärmung um mehr als 2 °C erfolgen wird. Nach dem Vorsorgeprinzip treten wir deshalb dafür ein, Maßnahmen für die Anpassung an einen höheren prognostizierten Temperaturanstieg zu ergreifen; |
Vulnerabilität gegenüber Extremwetter und Klimawandel-Risiken
|
25. |
begrüßt, dass in der Strategie auf Vulnerabilität als einem wichtigen Element für das Verständnis des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen verwiesen wird; vorrangiges Ziel der Anpassung ist es, die Vulnerabilität von Rezeptoren (wie Menschen, Infrastrukturen und Wirtschaftsbranchen) für die Risiken von Extremwetter und Klimawandel zu senken; |
|
26. |
vertritt einen auf Vulnerabilität ausgerichteten Anpassungsansatz, da
|
|
27. |
erachtet es für die EU-Strategie von Vorteil, wenn Begriffe wie Risiko, Vulnerabilität, Exposition und Resilienz erklärt und grundlegend definiert würden; |
Multi-Level-Governance
|
28. |
stellt fest, dass sich die Strategie darauf konzentriert, den Aspekt der Anpassung in die Maßnahmen der EU zu integrieren und bei der Entwicklung nationaler Anpassungsstrategien aufzugreifen. Weniger wird indes darauf geachtet, dass die Mitgliedstaaten bei der regionalen und lokalen Verankerung der Anpassung unterstützt werden müssen; |
|
29. |
unterstreicht, dass die Bedeutung der Entscheidungsfindung in einem Mehrebenensystem (Multi-Level-Governance) bei Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel explizit anerkannt werden muss. Dadurch würde Folgendes begünstigt:
|
|
30. |
ist der Auffassung, dass nationale Strategien zwar einen Überblick über die Auswirkungen und Risiken von hoher Warte bieten, indes verständlicherweise häufig die für die regionale und lokale Ebene relevanten Einblicke und Fragen missen lassen; |
|
31. |
betont, dass nationale Anpassungsstrategien Steuerungsmöglichkeiten zur Unterstützung regionaler und lokaler Anpassungsprozesse vorsehen sollten. Die Mitgliedstaaten sollten in Partnerschaft mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsstrategien auf regionaler und lokaler Ebene überwachen. Die EU sollte dabei Orientierung bieten, wie solche Aufgaben ausgeführt werden können; |
|
32. |
die Mitgliedstaaten sollten dazu angehalten werden, Netze einzurichten, die Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringen, um an der Erarbeitung von Anpassungsstrategien über räumliche Ebenen hinweg mitzuarbeiten; |
|
33. |
hält regionale Anpassungsstrategien am besten dafür geeignet, Hintergrundinformationen zu bieten, maßgebliche Ressourcen auszuweisen und Anleitung für lokale Maßnahmen zu geben. Die Regionen und Kommunen können auch die vorherrschenden Auswirkungen des Klimawandels verdeutlichen, die häufig aufgrund geographischer Besonderheiten wie Insellage, Berggebiete, städtische Ballungsgebiete und Küstenzonen regionalspezifisch sind; |
|
34. |
stellt fest, dass die Steuerungsstrukturen zur lokalen Umsetzung von Strategien je nach Mitgliedstaat verschieden sind. Einige, aber nicht alle verfügen über einschlägige regionale Planungsstrukturen. Er tritt indes dafür ein, dass auf jeden Fall Formen subnationaler Anpassungssteuerungsmechanismen notwendig sind, um diesbezügliche Investitionen, Gesetze und Maßnahmen der Mitgliedstaaten an die lokale Ebene weiterzugeben; |
|
35. |
hält es für notwendig, in der Strategie mehr darauf zu achten, die Anpassung auf lokaler Ebene auszubauen, wo die Folgen am deutlichsten wahrgenommen und die ersten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der Erfolg der EU-Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wird sich daran messen lassen, in welchem Maße Anpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene entwickelt und umgesetzt wurden, um die Risiken von Extremwetter und Klimawandel zu verringern; |
|
36. |
unterstreicht, dass Anpassungsmaßnahmen für die Städte von entscheidender Bedeutung sind, da die Mehrheit der Unionsbürger in Städten lebt. In den Städten verschärfen sich die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. aufgrund des urbanen Wärmeinseleffekts), sie beinhalten gefährdete Rezeptoren und sind Knotenpunkte für Wirtschaft und Kultur; |
|
37. |
betont, dass Anpassungsmaßnahmen insbesondere in Bereiche wie Raumplanung aufgenommen werden sollten, die für die Sicherung langfristiger Veränderungen in Landschaft und bebauter Umwelt wichtig sind; |
Regionale und lokale Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen
|
38. |
begrüßt, dass mindestens 20 % der Mittel des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 für steigende Klimaschutzausgaben vorgesehen werden und dass die Anpassung in Finanzierungen, Maßnahmen und Forschungsprogramme auf Unionsebene einschließlich der Programme Horizont 2020, Life+ und zur Entwicklung des ländlichen Raums aufgenommen wird; |
|
39. |
stellt fest, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip letztlich die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, die Aufnahme der Anpassung in die regionale und lokale Politik und Praxis zu fördern; |
|
40. |
gibt zu bedenken, dass das Niveau der Anpassung zwischen Mitgliedstaaten, Regionen und Städten variieren wird aufgrund des unterschiedlichen Ausmaßes der Klimawandel-Risiken, der Vulnerabilität gegenüber diesen Gefahren und der Anpassungsfähigkeit. Dadurch wird wiederum ihre Fähigkeit zur Anpassung an und zur Reaktion auf Extremwetter und Klimawandel beeinflusst; |
|
41. |
tritt dafür ein, „Anpassungstypologien“ zu entwickeln, die die Konzeption von Strategien für die kommunale Ebene erleichtern. Es lassen sich leichter Netze aus Haupttypen von Städten mit ähnlichen Anpassungsbedürfnissen bilden, wenn Ähnlichkeiten unter den Städten, wie aktuelle oder prognostizierte Klimarisiken und sozioökonomische Merkmale, ausgemacht werden. Die Bildung von Städtetypen würde eine effektivere Planung von Anpassungsstrategien und -maßnahmen, Mittelzuweisung, Orientierungshilfen und die Schaffung lernorientierter Netze ermöglichen. Er stellt fest, dass bereits einige freiwillige Vereinigungen bestehen, die unterstützt werden sollten; |
|
42. |
weist darauf hin, dass angesichts der unterschiedlichen Erfordernisse und Kapazitäten bezüglich der Anpassung wie z.B. verschiedene Governancestrukturen, unterschiedlicher Zugang zu Ressourcen und unterschiedliche biophysische Gegebenheiten, die die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungslösungen beeinflussen, der Begriff „bewährte Verfahren“ irreführend ist. Da Verfahrensweisen in diesem Zusammenhang nicht ohne Weiteres übertragbar sind, ist der Begriff „gute Praxis“ vorzuziehen; |
|
43. |
erachtet den Aufbau von Anpassungskapazitäten als eine wichtige Grundlage für die Entwicklung und Durchführung von Anpassungslösungen. Daher ist es von zentraler Bedeutung, Knotenpunkte auf einzelstaatlicher und subnationaler Ebene einzurichten, die beim Aufbau von Anpassungskapazitäten helfen, Weiterbildung anbieten und den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Städten und Regionen fördern; |
|
44. |
unterstreicht die Bedeutung der Umwelterziehung und –kommunikation und die Schlüsselrolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaft in diesem Zusammenhang; betont, dass die Kommunikation — besonders über den Klimawandel — den lokalen Zielgruppen und Gegebenheiten angepasst sein muss und entsprechende Kommunikations- und Bildungsmaßnahmen finanziell unterstützt werden sollten; |
|
45. |
ist der Auffassung, dass die Finanzausstattung für die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene wichtig ist. Es muss klargestellt werden, woher die umfangreichen Mittel, die für Fortschritte bei den Anpassungsmaßnahmen nötig sind, stammen sollen, zumal hinter den Einkünften aus Versteigerungen im Rahmen des EU-EHS ein Fragezeichen steht. Insbesondere ist es notwendig, die Anpassung bei der Nutzung von Strukturfonds wie dem EFRE im kommenden Planungszeitraum zu berücksichtigen, ohne jedoch die erforderlichen Mittel für die Eindämmung des Klimawandels zu kürzen; |
|
46. |
anerkennt die Bedeutung lokaler und regionaler Netze im Bereich der Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen und spricht sich für eine entsprechende finanzielle Unterstützung dieser Netzwerke durch EU-Mittel aus. Der AdR rät gleichwohl davon ab, neue Organisationen zu schaffen oder eine freiwillige Verpflichtung zur Durchführung von Anpassungsmaßnahmen einzuführen, wie in der Strategie empfohlen wird. Dies würde zu Doppelarbeit führen, die Beteiligten verwirren und könnte wertvolle Ressourcen vergeuden. Die Mittelausstattung des bestehenden Bürgermeisterkonvents sollte aufgestockt und das Gremium neu ausgerichtet werden als ein Netzwerk mit dem Schwerpunkt Klimapolitik in den beiden Bereichen Eindämmung und Anpassung; |
|
47. |
betont, dass die EU-Anpassungsstrategie eher proaktiv statt reaktiv sein muss: bei der Entwicklung und Durchführung von Anpassungsmaßnahmen ist sowohl auf Strategien zur Senkung langfristiger Risiken als auch zur Förderung der Reaktionsbereitschaft und -kapazitäten mit Blick auf gegenwärtige Wetter- und Klimaextreme zu achten; |
Anpassung und Eindämmung — Synergien und Konflikte
|
48. |
sieht Anpassung und Eindämmung als wesentliche Elemente einer integrierten Klimaschutzstrategie. Die Anpassung an aktuelle und unvermeidliche künftige extreme Wetterereignisse und Klimawandelfolgen ist zwar von zentraler Bedeutung, sollte indes nicht an die Stelle der Eindämmung treten. In der im Kontext der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen getroffenen Vereinbarung von Cancún wird betont, dass die Akteure Anpassung und Eindämmung gleichrangig vorantreiben sollten. Gleichwohl variiert die Art und Weise der Mittelzuteilung auf subnationaler Ebene; |
|
49. |
unterstreicht, dass in den nächsten Jahrzehnten ein entscheidender Aspekt der Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und der Lebensqualität in Europa darin liegen wird, die Gesellschaften und Wirtschaftssysteme dazu anzuhalten, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Außerdem müssen die Maßnahmen zur deutlichen Verringerung der Emissionen schädlicher Treibhausgase, die für den Klimawandel verantwortlich sind, schnellstmöglich ausgebaut werden; |
|
50. |
gibt zu bedenken, dass Anpassung und Eindämmung zwar prinzipiell eng miteinander verknüpft sind, aber integrierte Maßnahmen zur Anpassung und Eindämmung zum gegenwärtigen Zeitpunkt selten sind, und dass entsprechend in Politik, Praxis und Forschung dringend Synergien ausgemacht und gefördert werden müssen. Darüber hinaus müssen alle Maßnahmen der Europäischen Union zu diesen beiden Zielen beitragen; |
|
51. |
verweist auf die Vorteile von Maßnahmen, die sowohl auf Eindämmung als auch auf Anpassung abzielen. Andernfalls könnten erhebliche Nachteile durch konträre Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen entstehen, wie z.B. mechanische Kühlung aufgrund höherer Gebäudetemperaturen, die zu erhöhten Treibhausgasemissionen führt; |
|
52. |
stellt abschließend fest, dass sich die vorgeschlagene Überprüfung der Strategie im Jahr 2017 angesichts der gebotenen Eile nicht nur auf eventuelle Fortschritte der nationalen Anpassungsstrategien und auf die Frage konzentrieren sollte, ob künftig Rechtsvorschriften erforderlich seien, sondern dass zu diesem Zeitpunkt auch eine Reihe von Etappenzielen für die Umsetzung auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen erreicht sein sollte. Dafür sollte wenn möglich auch der Anzeiger für die Anpassungsvorsorge eingesetzt werden, und die EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel sollte durch Orientierung und Unterstützung für die Gebietskörperschaften wie für die Mitgliedstaaten für das Erreichen dieser Etappenziele flankiert werden. |
|
53. |
ist der Ansicht, dass die Vorschläge der Europäischen Kommission in der EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang stehen. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-Weltklimarat),Vierter Sachstandsbericht.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/43 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Grüne Infrastruktur — Aufwertung des europäischen Naturkapitals
2013/C 356/08
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
hebt die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Festlegung und Umsetzung der Initiative hervor und fordert sie auf, in allen einschlägigen Politikbereichen und insbesondere über ihre Raum- und Stadtplanungskompetenz im Hinblick auf die Planung und Organisation einer grünen Infrastruktur aktiv zu werden; unterstreicht, dass der Schlüssel zum Erfolg bei der Umsetzung einer grünen Infrastruktur darin besteht, dass die Grundsätze der Multi-Level-Governance wirksam angewandt werden und sich alle Akteure und Interessenträger beteiligen; |
|
— |
fordert die Kommission auf, so bald wie möglich konkrete Umsetzungsleitfäden für die Einbeziehung der grünen Infrastruktur in die verschiedenen EU-Politikbereiche zu erstellen; fordert zusätzliche technische Daten zur grünen Infrastruktur in Städten; spricht sich dafür aus, die grüne Infrastruktur in den europäischen Referenzrahmen für nachhaltige Städte sowie in das künftige Stadtentwicklungsnetz aufzunehmen; |
|
— |
hebt hervor, dass die Modalitäten für die Integration der grünen Infrastruktur sowie ihr Vorrang dringend in den Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Finanzierungsprogrammen festzulegen sind, denn diese werden derzeit für die Kohäsions- und Strukturfonds 2014-2020 ausgearbeitet; |
|
— |
fordert die Kommission dazu auf, die Forderungen nach Vermeidung von Nettoverlusten an Artenvielfalt und Ökosystemleistungen in EU-Recht umzusetzen; ruft die Kommission dazu auf, die Finanzierungsmaßnahmen der EU weiterhin und stärker als bisher an die Erfüllung von Umweltschutzauflagen und den Schutz der Artenvielfalt zu knüpfen; schlägt vor, zusätzlich zu diesem Finanzierungsinstrument einen bestimmten Prozentsatz aller EU-Mittel für die Finanzierung grauer Infrastruktur in einen Biodiversitätsfonds einzuzahlen; |
|
— |
begrüßt die Ankündigung, dass sich die Kommission gemeinsam mit der EIB bis 2014 bemühen wird, eine spezielle EU-Finanzierungsfazilität für Projektträger zu gründen, die grüne Infrastruktur-Projekte entwickeln wollen; spricht sich dafür aus, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an dessen Festlegung beteiligt werden; |
|
— |
ist sehr erfreut über das Projekt TEN-G und spricht sich dafür aus, dass TEN-G im gleichen Maße wie die Verkehrs-, Energie-, Informationstechnologie- und Kommunikationsnetze als im Interesse der Gemeinschaft anerkannt wird, und ruft die Kommission dazu auf, die Möglichkeiten einer europäischen Rechtsetzung in diesem Bereich zu sondieren. |
|
Berichterstatterin |
Annabelle JAEGER (FR/SPE), Mitglied des Regionalrates von Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) — Aufwertung des europäischen Naturkapitals COM(2013) 249 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Allgemeine Bemerkungen
|
1. |
begrüßt nachdrücklich die Mitteilung der Kommission „Grüne Infrastruktur (GI) — Aufwertung des europäischen Naturkapitals“, die einer entsprechenden Strategie der EU zu dem Thema vorausgeht. Er sieht die darin enthaltenen Vorschläge als eminent wichtig an für die Erreichung der europäischen Ziele, die bis 2020 für folgende Bereiche gesteckt wurden: effiziente Ressourcennutzung, sozialer und regionaler Zusammenhalt, nachhaltiges und intelligentes Wachstum, Attraktivität, Erhöhung der Artenvielfalt und der Qualität der Landschaft, Schutz vor Naturgefahren, Verwirklichung eines nachhaltigen Stadtmodells, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort in kleinen und mittleren Unternehmen, Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung und Bekämpfung von Ungleichheit; die Vorschläge leisten zudem einen Beitrag zu den Zielen der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2020 und stehen im Einklang mit der Vogelschutzrichtlinie, der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und der Konnektivität der Natura-2000-Gebiete (1); |
|
2. |
erwartet, dass mit der künftigen Entwicklung grüner Infrastruktur in der EU dazu beigetragen wird, Ziel 2 der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 zu erreichen, das die Wiederherstellung von mindestens 15 % der bereits geschädigten Ökosysteme bis 2020 vorsieht; ferner soll ein Beitrag dazu geleistet werden, in ganz Europa und nicht nur in den durch das Natura-2000-Netz erfassten Gebieten den Verlust an Artenvielfalt und Ökosystemen aufzuhalten bzw. Artenvielfalt und Ökosysteme wiederherzustellen; |
|
3. |
ist zudem der Ansicht, dass der Schutz der biologischen Vielfalt in den verschiedenen Strategien und Programmen, die bislang auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene durchgeführt wurden, noch nicht ausreicht, um der Gefährdung der Artenvielfalt gerecht zu werden; stellt fest, dass Einigkeit darüber besteht, dass die Produktions- und Verbrauchsmuster in der Gesellschaft geändert werden müssen, da diese durch die Zerstörung und Fragmentierung natürlicher Lebensräume und durch vielfältige Umweltverschmutzungen die Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt sind und andernfalls die erneuerten Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 ins Leere laufen würden; |
|
4. |
hebt daher die zentrale Rolle der Kommission als Impulsgeber für eine auf grüner Infrastruktur basierte Querschnittsstrategie hervor. Die Gelegenheit, alle europäischen Akteure — nationale, lokale und regionale Regierungen, Unternehmen, Forscher, Verbände und Bürger — zu einem Interessenausgleich zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Biosphäre zusammenzubringen, ist so günstig wie nie zuvor; |
|
5. |
zeigt sich angetan von der vorgeschlagenen Definition, die sowohl den Gedanken der Konnektivität von Arten und Lebensräumen umfasst als auch die Qualität dieser Räume einschließlich des städtischen Raumes unabhängig von ihrer Größe, die außerordentliche Artenvielfalt in geschützten Lebensräumen ebenso wie in gewöhnlichen Lebensräumen, natürliche Lösungen ebenso wie naturbasierte, menschengemachte Lösungen; würde sich aber wünschen, dass diese Definition in den zu veröffentlichenden Umsetzungsleitlinien um die Begriffe „Durchlässigkeit“ und „Aufnahmefähigkeit für Lebewesen“ erweitert und präzisiert würde. Daher sollte der Nutzung und Schaffung ökologischer und funktionaler Vernetzungen unabhängig von der Größe besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden; |
|
6. |
begrüßt, dass die zahlreichen positiven wirtschaftlichen, umweltbezogenen, dem Schutz vor Gefahren dienenden und sozialen Aspekte funktionierender Ökosysteme anerkannt werden, und hebt hervor, dass diese Dimension der Nützlichkeit für die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, die dem Menschen zugutekommen, stets zur Verstärkung der ethischen Dimension der Erhaltung der Natur und der biologischen Vielfalt berücksichtigt werden sollte; |
|
7. |
weist darauf hin, dass zum einen das Konzept der grünen Infrastruktur naturgemäß die Grenzen der Verwaltungen und Regionen überschreitet und zum anderen, dass die Weiterentwicklung, Erhaltung oder Gefährdung dieses Konzepts in allererster Linie von der Politik der Raumplanung und der Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Kommunen abhängig ist; |
|
8. |
begrüßt und unterstützt den umfassenden Ansatz, eine grüne Infrastruktur fest in den Kontext einer Abmilderung des Klimawandels und der Anpassung daran zu verankern. Er hebt die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Festlegung und Umsetzung einer solchen Strategie hervor; |
|
9. |
ist der Auffassung, dass der Schutz, der Ausbau und die Erhaltung einer grünen Infrastruktur mittel- und langfristig deutlich kostengünstiger ist als eine graue Infrastruktur, deren Gesamtkosten auch die heute von der Gesellschaft mitgetragenen externen Kosten umfasst. Von der Natur inspirierte oder auf der Natur basierende Lösungen in Synergie mit der biologischen Vielfalt (Umwelttechnologie) sind weniger energieintensiv, weniger anspruchsvoll in Bezug auf Unterhalt und Pflege als konventionelle Lösungen und daher effizienter und nachhaltiger; |
|
10. |
weist drauf hin, dass die Vorbeugung einer Verschlechterung des Zustands der Ökosysteme und die Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme an allererster Stelle stehen müssen, denn Maßnahmen zur Behebung der Folgen eines durch menschliche Einwirkung aus den Fugen geratenen ökologischen Gleichgewichts sind immer kostspieliger, langwieriger und vor allem bezüglich ihrer Ergebnisse unsicherer; |
|
11. |
ist der Auffassung, dass eine ökonomische Bewertung der Ökosystemleistungen sich zwar im Rahmen bestimmter Kosten-Nutzen-Analysen zur Abwägung zwischen gegensätzlichen Zielen als nützlich erweisen kann, dass diese aber nicht ohne methodische Schwierigkeiten — und in bestimmten Zusammenhängen ungeeignet — sind und in ethischer Hinsicht auch Fragen aufwerfen. Daher ist hervorzuheben, dass zur Bewertung der Kosten des Rückgangs der Artenvielfalt auch eine andere Methode existiert, nämlich die Berechnung der Kosten für die Erhaltung des ökologischen Potenzials zur Wiederherstellung des Artenschwunds anhand der Berechnung der Investitionskosten, die notwendig sind, um den Zustand der Artenvielfalt im Hinblick auf eine dauerhafte Sicherstellung der Ökosystemleistungen zu erhalten oder zu verbessern. Der Ausschuss der Regionen spricht sich dafür aus, der letztgenannten Methode Vorrang einzuräumen; |
|
12. |
fordert alle Gemeinden und Regionen auf, in allen einschlägigen Politikbereichen und insbesondere über ihre Raum- und Stadtplanungskompetenz im Hinblick auf die Planung und Organisation einer grünen Infrastruktur aktiv zu werden; |
|
13. |
fordert die EU und die Mitgliedstaaten dazu auf, den Gemeinden und Regionen mit angemessenen personellen, technischen und finanziellen Mitteln zur Seite zu stehen (2); |
Landwirtschaft, Wälder, Böden und Land
|
14. |
ist der Ansicht, dass die Bekämpfung des Verlusts von Bodenfunktionen, der Intensivierung des Flächenverbrauchs und der Bodendegradation bei der Raum- und Stadtplanung absolute Priorität haben muss. Angesichts der Ausweitung von Städten muss auf einen „Null-Nettoverlust“ an natürlichen Lebensräumen, Wäldern und Agrarflächen geachtet werden; einige lokale und regionale Gebietskörperschaften haben die Konzepte der grünen Infrastruktur und der Vermeidung von Nettoverlusten in unterschiedlicher Form bereits in ihre Stadtplanung und die Raumplanung aufgenommen; |
|
15. |
weist zudem erneut darauf hin, dass er es begrüßen würde, wenn die Mitgliedstaaten die im Hinblick auf die Verabschiedung eines gemeinsamen europäischen Rechtsrahmens zum Schutz und zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Böden notwendige Debatte wiederaufnehmen würden, da ein solcher Rechtsrahmen ein unverzichtbares Instrument für die Bewältigung dieser äußerst wichtigen Aufgabe ist (3); |
|
16. |
erinnert an den Beitrag der Forstwirtschaft zur grünen Infrastruktur, die entweder aktiver Art (durch die Wiederherstellung von Netzen zusammenhängender Waldstücke oder durch ökologische Verwaltungspraktiken) oder passiver Art (durch Erhaltung von Waldrandgebieten) sein kann. Insbesondere in Regionen, in denen der Wald sehr stark zerstückelt und in Privatbesitz ist, sollten Waldbesitzerverbände eingerichtet werden, die sich mit den entsprechenden Fragen befassen, und müssen die Regionen und Kommunen im Hinblick auf eine grüne Infrastruktur mit Instrumenten zur Mobilisierung dieser privaten Akteure in folgenden Bereichen ausgestattet werden: Landnutzung, Weiterbildung, technische Unterstützung, gegenseitige Hilfe bis hin zur finanziellen Unterstützung; |
|
17. |
nimmt die von der EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik für 2014-2020 getroffenen Beschlüsse zur Kenntnis und wirft die Frage auf, ob sich in diesen Bereichen bis 2020 eine wirksame grüne Infrastruktur verwirkliche ließe. Der Ausschuss der Regionen bekräftigt, dass die zuständigen Behörden tätig werden müssen und im Hinblick auf die Erhaltung und Wiederherstellung der Artenvielfalt durch eine ökologische Gestaltung der Direktzahlungen in den ökologisch wertvollen Gebieten, durch den ELER-Fonds und damit verbunden eine kohärente ortsgebundene Ausrichtung von Agrarumweltmaßnahmen und eine entsprechenden Mittelausstattung die grüne Infrastruktur zu einer Leitlinie ihrer Handlungsinstrumente machen sollten; zugleich sollten die Behörden etwa durch Förderung der ökologischen Landwirtschaft und der Agro-Forstwirtschaft Mittel zur Wiederherstellung der Artenvielfalt in landwirtschaftlich genutzten Gebieten bereitstellen; |
|
18. |
ist im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft innerhalb einer grünen Infrastruktur der Auffassung, dass die Entwicklung biologischer Baustoffe für die Solidarität zwischen den ländlichen und den städtischen Regionen unerlässlich ist, da die Nutzung traditioneller Baumaterialien in der Stadt und für die graue Infrastruktur eine erhebliche Belastung für die ländliche Umwelt wie auch für die Meeresumwelt darstellt. Die Verwendung von Holz und anderen Materialien, die Nebenerzeugnisse der Landwirtschaft sind oder neben den üblichen Kulturen produziert werden (Stroh, Hanf, Leinen, Wolle u.ä.) sollte zugunsten lokaler Interessenträger gefördert werden. Darum vertritt der AdR die Ansicht, dass die Dynamik vor Ort unterstützt werden muss, insbesondere durch Beihilfen zur Strukturierung der Lieferketten, durch Investitionen in die industrielle Verarbeitung, aber auch durch eine Strukturierung des Marktes über vorbildhafte öffentliche Aufträge oder durch Förderung von Verbrauchern, die lokale Produkte verwenden. Zur Bestimmung der technischen Eigenschaften dieser Materialien sowie ihrer Produktionsbedingungen im Hinblick auf die Wahrung der Ökosysteme sollten zudem Forschungsprogramme entwickelt werden. Nicht zuletzt müssen auch die Verbraucher durch eine entsprechende Kennzeichnung über die Herkunft und die Herstellungsbedingungen der Materialien informiert werden; |
Gemeinsame Verantwortung aller Regierungsebenen
|
19. |
unterstreicht, dass der Schlüssel zum Erfolg bei der Umsetzung einer grünen Infrastruktur darin besteht, dass alle Regierungsebenen zusammenarbeiten, die Grundsätze der Multi-Level-Governance wirksam angewandt werden und sich alle Akteure, alle Interessenträger und die breite Öffentlichkeit auf lokaler Ebene an ihrer Konzipierung und Umsetzung beteiligen; |
|
20. |
spricht sich für partizipative Vorgehensweisen aus, durch die an der Basis die notwendigen und ergänzenden Initiativen entstehen und die von den Akteuren, die unmittelbar an der Raumplanung und Raumnutzung beteiligt sind, also der örtlichen Bevölkerung (4), angenommen werden; |
Eine neue Bürgerschaft
|
21. |
weist auf die sehr nachdrückliche Forderung der Bevölkerung nach Natur in der Stadt hin, die sowohl einem Bedürfnis nach Natur verschiedenster Art entspricht (Raum zur Entspannung und für Freizeitaktivitäten, für gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten, Landschafts- und Verschönerungselemente, wilde Natur usw.) als auch dem damit verbundenen Wunsch nach Wohlbefinden, die aber auch im Zusammenhang steht mit der Gesundheit der Stadtbewohner sowie der Bekämpfung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit; von entsprechenden Lösungen profitieren naturgemäß am meisten die jüngsten in der Bevölkerung, aber auch ältere und benachteiligte Menschen; |
|
22. |
beobachtet mit Interesse die Initiativen von Bürgern im Zusammenhang mit grüner Infrastruktur, insbesondere im städtischen und stadtnahen Raum (gemeinsame Erfassung der Artenvielfalt, Beteiligung an der Ausweisung neuer städtischer Räume für biologische Vielfalt, Nutzbarmachung brachliegender Flächen oder ungenutzter Gelände, Kollektivgärten usw.), denn die Vernetzung zwischen diesen Räumen durch Wege, die für nichtmotorisierte Fortbewegungsarten geeignet sind, ist entscheidend, um die Lebensqualität in den Städten zu heben; |
Potenzial für Innovationen und neue Berufszweige
|
23. |
weist darauf hin, dass die grüne Infrastruktur Forschungs- und Innovationspotenzial birgt und damit auch Entwicklungsmöglichkeiten für Planungsbüros bietet, etwa durch die Begrünung von Wänden und Dächern oder ökologische Sanierung; macht jedoch darauf aufmerksam, dass die Vorteile der grünen Infrastruktur, etwa im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel, von der Qualität ihrer Umsetzung abhängen. Gefördert werden sollten lediglich funktionelle Lösungen, die an den Klimawandel und die biologische Vielfalt angepasst sind; |
|
24. |
unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Risiken, die mit Innovationen durch Finanzierungsinstrumente verbunden sind (wie etwa die Praxis der Risikoteilung), zu reduzieren und unterstützt die Förderung von Projekten, die aus öffentlichen und privaten Fonds finanziert werden; |
|
25. |
beobachtet mit Interesse die Entstehung neuer Berufe im Zusammenhang mit der grünen Infrastruktur, wie etwa der des Umwelttechnikers für die Sanierung, Erhaltung und Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme, und unterstreicht, dass auch die mittelbar betroffenen oder abgeleiteten Berufszweige berücksichtigt werden müssen (Erzeugung von Pflanzen, landwirtschaftliche Produktionsketten usw.). Die Regionen und Kommunen, die für die wirtschaftliche Entwicklung Sorge tragen müssen, sollten diese für die Schaffung von Arbeitsplätzen wichtige Dynamik begleiten und unterstützen; |
|
26. |
ist der Meinung, dass die grüne Infrastruktur auf Ökosystemen und von Menschen geschaffenen Räumen beruht und dass diese beiden Systeme sich aufgrund ihrer biogeografischen Voraussetzungen und ihrer Geschichte sehr stark voneinander unterscheiden. Die grüne Infrastruktur ist daher ein Wirtschaftsfaktor, der Arbeitsplätze vor Ort schafft, die nicht verlagert werden können. In diesem Zusammenhang weist der AdR darauf hin, dass das EU-Recht für die öffentliche Auftragsvergabe derzeit überarbeitet wird und dass der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments (EP) am 11. Januar 2013 klargestellt hat, dass das Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots für die zuständigen Behörden bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ausschlaggebend sein sollte. Der AdR unterstützt die Haltung des EP dahingehend, dass neben dem Preis bzw. den Kosten auch qualitative, ökologische oder soziale Kriterien herangezogen werden sollten. Insbesondere ist auf soziale und ökologische Eigenschaften sowie auf den innovativen Charakter, wie etwa das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines nahegelegenen Marktes zu achten; |
Handlungsbereiche
|
27. |
fordert die Kommission auf, so bald wie möglich praktische, genaue und konkrete Umsetzungsleitfäden für die Einbeziehung der grünen Infrastruktur in die verschiedenen EU-Politikbereiche zu erstellen, und schlägt vor, dass die Regionen und Kommunen, die bereits eine grüne Infrastruktur fördern, in die Erarbeitung dieser Leitfäden einbezogen werden, damit sie zusammen mit der Kommission die spezifisch lokalen Ausprägungen dieser Leitfäden mit genaueren Angaben zu den Biotopen sowie besserer Ortskenntnis erarbeiten können; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit dem Leitfaden „Guide to multi-benefit cohesion policy investments in nature and green infrastructure“ bereits erste Leitlinien vorliegen (5); |
|
28. |
fordert zusätzliche technische Daten zur grünen Infrastruktur in Städten, da mithilfe dieser Daten Projekte im Rahmen der neuen Strukturfondsmaßnahmen angestoßen werden könnten, die 5 % der Mittel für Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung vorsehen; |
|
29. |
spricht sich dafür aus, die grüne Infrastruktur in den europäischen Referenzrahmen für nachhaltige Städte (6) sowie in das im Rahmen der Kohäsionspolitik 2014-2020 vorgesehene künftige Stadtentwicklungsnetz aufzunehmen; |
|
30. |
ruft dazu auf, bei der bevorstehenden Überarbeitung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme als zusätzliches Kriterium zur Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit dieser Umweltauswirkungen auch auf die grüne Infrastruktur zu verweisen; |
|
31. |
hebt hervor, dass graue Infrastruktur, die nach Prüfung aller alternativen Lösungen auf der Grundlage grüner Infrastruktur als unerlässlich angesehen wird, so konzipiert sein muss, dass Umweltbeeinträchtigungen weitestgehend vermieden bzw. reduziert werden. Zudem müssen verbindlich Maßnahmen vorgeschrieben werden, die als Ausgleich für Bodenverbrauch und Schädigung von Ökosystemen anerkannt sind (7). Der Ausschuss der Regionen fordert die Kommission dazu auf, diese Forderungen unter Berücksichtigung der Arbeit der Europäischen Kommission zur Maßnahme 7b) der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 Vermeidung von Nettoverlusten an Ökosystemen und Ökosystemleistungen in EU-Recht umzusetzen; |
Monitoring und Evaluierung
|
32. |
begrüßt den Vorschlag, 2017 eine Überprüfung der Fortschritte im Bereich der grünen Infrastruktur vorzunehmen, und weist auf die Bereitschaft der Regionen und Kommunen hin, hierzu einen Beitrag zu leisten, indem sie die vor Ort bestehenden Beobachtungsstellen zur biologischen Vielfalt, zur Wirtschaftstätigkeit, zur Gesundheit, zur sozialen Ungleichheit usw. für eine Erfassung relevanter Daten auf europäischer Ebene bereitstellen; |
|
33. |
wirft die Frage nach der Messung der Wirksamkeit der grünen Infrastruktur auf und hebt hervor, dass die Entwicklung eines Systems vorangetrieben werden sollte, anhand dessen sich rasch beurteilen lässt, inwieweit ein Ökosystem intakt ist; dieses System sollte für die betroffenen Interessenträger leicht anwendbar und verständlich sein, damit diese zum einen die Wirksamkeit beurteilen, zum anderen aber auch einen Vergleich zur grauen Infrastruktur anstellen können; |
|
34. |
ist der Ansicht, dass eine umfassende Bewertung der grauen Infrastruktur im Hinblick auf ihre Beziehungen zur natürlichen Umwelt ermöglicht werden muss, und unterstützt die Arbeit der Kommission zur Kartierung und Bewertung von Ökosystemen und Ökosystemleistungen in Europa (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Europe); er besteht zudem darauf, dass die Entwicklung von Methoden sowie Mess- und Recheninstrumenten unterstützt wird, mit deren Hilfe sich auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse das gesamte Verhältnis der Wirtschaftsaktivitäten und Produkte zur natürlichen Umwelt und zu den Ökosystemdienstleistungen transparent beschreiben ließe; |
Kommunikation, Sensibilisierung und Aufklärung
|
35. |
empfiehlt eine ambitionierte Kommunikationskampagne der EU in Zusammenarbeit mit den anderen Regierungsebenen, die insbesondere von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften (8), aber auch von anderen lokalen Akteuren (Verbänden, Unternehmen usw.) mitgetragen werden sollte. Im Mittelpunkt dieser Kampagne könnten der dreifache Nutzen der grünen Infrastruktur (ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nutzen) und die bewährten Verfahren in den Mitgliedstaaten stehen; |
|
36. |
weist erneut darauf hin, dass bewährte Verfahren in stärkerem Maße Anwendung finden sollten. Zusammen mit anderen Institutionen und Verbänden sowie den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die bereits entsprechende Informationen zusammentragen, sollte die Kommission weiterhin erfolgreiche Beispiele aufzeigen, bekanntmachen und nutzen. Hierzu könnten eine Austauschplattform, aber auch regelmäßige Treffen und Schulungen dienen, die die Regionen und Kommunen, denen bei der Sensibilisierung für grüne Infrastruktur eine zentrale Rolle zukommt, mit Unterstützung der Kommission ausrichten können; |
|
37. |
fordert die Kommission dazu auf, die Elemente der grünen Infrastruktur, d.h. Räume (Naturparks in ländlichen, stadtnahen und städtischen Gebieten usw.) und Erzeugnisse (Materialien, Gebäude usw.) in die bestehenden oder geplanten Programme zur europäischen Umweltkennzeichnung aufzunehmen; |
Finanzierung
|
38. |
erkennt zwar an, dass Querfinanzierungen von Nutzen sind, um die einzelnen Politikbereiche für das Thema der Artenvielfalt zu mobilisieren, hebt aber hervor, dass die Bereitstellung solcher Finanzmittel aus verschiedenen Gründen mit Schwierigkeiten verbunden ist, die von unterschiedlichen Bezeichnungen für die verschiedenen Finanzinstrumente bis hin zu komplexen Finanzierungstechniken reichen; er fordert daher genaue Anleitungen für deren Handhabung; |
|
39. |
hebt hervor, dass die Modalitäten für die Integration der grünen Infrastruktur sowie ihr Vorrang dringend in den Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Finanzierungsprogrammen festzulegen sind, denn diese werden derzeit für die Kohäsions- und Strukturfonds 2014-2020 ausgearbeitet. So können die zuständigen Behörden ihre Verantwortung für die entsprechende Finanzierung in vollem Umfang wahrnehmen; fordert die zuständigen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften auf, die in den operationellen Programmen vorgeschlagenen Möglichkeiten einer Finanzierung ortsspezifischer grüner Infrastruktur aufzugreifen und im Hinblick auf deren erfolgreiche Umsetzung in den notwendigen bereichsübergreifenden Kapazitätsaufbau, die Kofinanzierung und die Bildung von Netzwerken zu investieren; |
|
40. |
bekräftigt die Notwendigkeit eines Finanzierungsinstruments für grüne Infrastruktur-Projekte und begrüßt ausdrücklich die entsprechende Ankündigung in der Mitteilung, dass sich die Kommission gemeinsam mit der EIB bis 2014 bemühen wird, eine spezielle EU-Finanzierungsfazilität für Projektträger zu gründen, die grüne Infrastruktur-Projekte entwickeln wollen. Der AdR spricht sich dafür aus, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an dessen Festlegung beteiligt werden; |
|
41. |
schlägt vor, zusätzlich zu diesem Finanzierungsinstrument einen bestimmten Prozentsatz aller EU-Mittel für die Finanzierung grauer Infrastruktur in einen Biodiversitätsfonds einzuzahlen; dieser Fonds würde in denjenigen Mitgliedstaaten, in denen die graue Infrastruktur geplant ist, als Kapitalaufstockung zur Schaffung grüner Infrastruktur bereitgestellt; |
|
42. |
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Kommunen auf, auf allen Finanzierungsebenen weiterhin wirkungsvoll für die Streichung biodiversitätsschädlicher Subventionen und Finanzierungssysteme zu sorgen; |
|
43. |
ruft die Kommission dazu auf, die Finanzierungsmaßnahmen der EU weiterhin und stärker als bisher an die Erfüllung von Umweltschutzauflagen (9) und den Schutz der Artenvielfalt (10) zu knüpfen, damit die Wirkung aller von der EU finanzierten Projekte auf die grüne Infrastruktur und die biologische Vielfalt abgeschätzt wird und die Höhe der EU-Förderung entsprechend angepasst werden kann; |
|
44. |
fordert die Kommission dazu auf, in ihrer Halbzeitbilanz der Strukturfonds 2014-2020 und der Fazilität „Connecting Europe“ weitere Maßnahmen im Rahmen der grünen Infrastruktur festzulegen und hervorzuheben; |
Die Initiative TEN-G
|
45. |
ist sehr erfreut über das Projekt TEN-G und ruft dazu auf, in allen vorangehenden Studien die regionalen und lokalen Aspekte der grünen Infrastruktur von europäischer Dimension zu berücksichtigen, damit sowohl die Kohärenz als auch die Wirkungseffizienz bei der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme und damit der Erhaltung der Artenvielfalt, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und die größtmögliche Akzeptanz und Mitwirkung durch die Bürger und Interessenträger gewährleistet ist; |
|
46. |
spricht sich dafür aus, dass TEN-G im gleichen Maße wie die Verkehrs-, Energie-, Informationstechnologie- und Kommunikationsnetze als im Interesse der Gemeinschaft anerkannt wird, und ruft die Kommission dazu auf, die Möglichkeiten einer europäischen Rechtsetzung in diesem Bereich zu sondieren; |
Grenzüberschreitende und gesamteuropäische Aufgaben
|
47. |
ermuntert die Regionen und Kommunen im Sinne der Kohärenz der grünen Infrastruktur zur Zusammenarbeit an gemeinsamen ökologischen Netzen und fordert die Europäische Kommission dazu auf, diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit in ein Gesamtsystem auf EU-Ebene zu integrieren; |
|
48. |
ruft dazu auf, den Ansatz der europäischen grünen Infrastruktur über die europäischen Grenzen hinaus auszudehnen, indem die EU-Nachbarschaftsinstrumente für Investitionen in grüne Infrastruktur in ländlichen und städtischen Gebieten aufgestockt werden. Bestehende Initiativen wie das Smaragd-Netzwerk, das Programm „Mensch und Biosphäre“ sowie das Gesamteuropäische ökologische Netz (PEEN) könnten hierzu einen Beitrag leisten; |
Subsidiarität
|
49. |
ist der Ansicht, dass die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Integration der grünen Infrastruktur in andere europäische Politikbereiche sowie die vorgeschlagene Unterstützung der anderen Regierungsebenen bei der Entwicklung einer entsprechenden eigenen Politik mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang stehen. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) CdR 22/2009 fin., CdR 112/2010 fin.
(2) CdR 22/2009 fin, CdR 112/2010 fin.
(3) CdR 112/2010 fin.
(4) CdR 112/2010 fin.
(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/guide_multi_benefit_nature.pdf
(6) „Reference Framework for Sustainable European Cities“ (RFSC), eine gemeinsame Initiative der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und der europäischen Verbände der lokalen Regierungen. Siehe http://www.rfsc-community.eu/
(7) Im Hinblick auf die Erreichung des Ziels eines Null-Nettoverlusts.
(8) CdR 112/2010 fin.
(9) CdR 22/2009 fin, CdR 218/2009 fin.
(10) IEEP, Dezember 2012: Background Study towards biodiversity proofing of the EU budget.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/49 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Raumfahrtindustriepolitik der EU
2013/C 356/09
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
weist auf relevante Aspekte hin, die im Kontext der entstehenden EU-Raumfahrtpolitik zu regeln sind: Industrienormen sowie Fragen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb und der kommerziellen Nutzung der Satellitenkommunikationsinfrastruktur; |
|
— |
stimmt zu, dass eine nachfrageorientierte politische Ausrichtung für den EU-Raumfahrtsektor die Position der Nutzer stärken soll, aber nicht auf Verbrauchersubventionen reduziert werden darf; |
|
— |
fordert die Kommission auf, Kriterien für den öffentlichen Nutzen hinsichtlich der Zuständigkeiten und Erfordernisse der Behörden festzulegen, die bei der Bewertung der Nutzernachfrage zugrunde gelegt werden; |
|
— |
weist darauf hin, dass eine enge Beziehung zwischen der lokalen/regionalen Ebene, die die einzelnen Industriezweige bei ihren ersten Schritten begleitet und unterstützt, und der nationalen/EU-Ebene ein wichtiger Aspekt der EU-Industriepolitik sein sollte; |
|
— |
verweist auf den durch die bewährten Verfahren der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erbrachten Nachweis, dass die nachgelagerten Copernicus/GMES-Dienstleistungen den Erfordernissen der öffentlichen Politik entsprechen und ihre Nützlichkeit für öffentliche politische Zielsetzungen unter Beweis gestellt haben; |
|
— |
schlägt vor, dass Dienstleistungen und Anwendungen, die auf der Grundlage von Weltraumtechnologie entwickelt werden, aus den Strukturfonds kofinanziert werden können, sofern bei den Fondsverantwortlichen der entsprechende politische Wille und das entsprechende Bewusstsein vorhanden sind. Ein derartiger Mechanismus wurde bereits unter dem Finanzrahmen 2007-2013 genutzt, wobei nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Kohäsionsfonds/dem EFRE einer neuen Priorität zugewiesen wurden: satellitengestütztes Breitbandinternet für abgelegene Regionen; |
|
— |
ist der Meinung, dass die operationelle Phase entscheidend für den wirtschaftlichen Durchbruch neuer technischer Entwicklungen ist, jedoch finanzielle Unterstützung zur Deckung der bei der Übernahme neuer Technologien durch die verschiedensten Nutzer anfallenden Anlaufkosten erfordern wird. |
|
Berichterstatter: |
Adam STRUZIK (PL/EVP), Marschall der Woiwodschaft Masowien |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Raumfahrtindustriepolitik der EU: Entfaltung des Wachstumspotenzials im Raumfahrtsektor COM(2013) 108 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
begrüßt die Kommissionsmitteilung, in der die Bedeutung der EU-Raumfahrtindustriepolitik klar herausgestellt wird; |
Vorbemerkungen
|
2. |
unterstreicht, dass der Raumfahrtsektor ein Schlüsselelement der Europa-2020-Strategie und deren Leitinitiativen — insbesondere zur Innovationsunion und zur Industriepolitik — ist. Die Weltraumtechnologie ist von besonderer Bedeutung für wissensbasierte Wirtschaft: Sie beeinflusst die künftige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und gibt die Instrumente für die Lösung anderer dringender Probleme am Boden an die Hand. Ein Spin-off-Effekt der Weltraumtechnologie kann als eine Erfahrung oder Veränderung im Zuge von Weltraumaktivitäten definiert werden, die anschließend nutzbringend auf andere Kontexte übertragen wird, wo sie weiteren wirtschaftlichen Wert schafft; |
|
3. |
hält fest, dass gemäß der Bewertung der ESA für die nachgelagerten Wertschöpfungssektoren von weltraumgestützten Anwendungen der europäische Markt im Vergleich zum Weltmarkt kleiner und im privaten Segment weniger spezialisiert ist. Im Gegensatz zu anderen Raumfahrtnationen legt die Rüstungsindustrie auch keine ersten Standards und Aktivitäten fest. Weltweit sind die meisten Unternehmen in mehreren Marktsegmenten und über die gesamte Wertschöpfungskette tätig. In Europa sind kaum Akteure zu finden, die die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Insgesamt gesehen ist die Spezialisierung in Europa (wo der Schwerpunkt auf speziellen Satellitennavigationsanwendungen liegt) etwas weniger ausgeprägt als weltweit; |
|
4. |
ist sich sehr wohl der wichtigsten grundsätzlichen Fragen für den Raumfahrtsektor der EU bewusst; dazu gehören die Marktorganisation, die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, die Grundsätze für die Auftragsvergabe, der Zugang zu Daten, öffentliche Einrichtungen in ihrer Funktion als Kunden sowie der Regelungsrahmen. |
|
5. |
erkennt an, dass die EU-Raumfahrtindustrie generell erhebliche Auswirkungen auf den wissenschaftlichen und technologischen Status Europas hat. Dazu zählen u.a. die Anreize für Wissenschafts- und Technologiebasis der EU sowie die weitreichenderen Effekte der Weltraumtechnologie auf die Wirtschaft im Allgemeinen; |
|
6. |
stimmt mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Mai 2013 zum Thema „Raumfahrtindustriepolitik der EU — Entfaltung des Wachstumspotenzials im Raumfahrtsektor“ überein, dass „im Interesse einer breiten und ausgewogenen industriellen Basis die Beteiligung von KMU […] an der Lieferkette eine wesentliche Komponente der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie darstellt“, und schließt sich seiner Aufforderung an die Adresse der Kommission an, die Notwendigkeit neuer innovativer Finanzinstrumente eingehender zu prüfen; |
|
7. |
vertritt die Auffassung, dass es aus Sicht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften besonders wichtig ist, die Nutzung weltraumgestützter Anwendungen im Rahmen der EU-Politik zu fördern; die EU sollte daher entsprechende Unterstützungsmaßnahmen konzipieren, um die Entwicklung und Einführung weltraumgestützter Anwendungen bei öffentlichen wie auch privaten Nutzern zu fördern, insbesondere bei lokalen Gebietskörperschaften und im KMU-Sektor, und zwar in Verbindung mit Maßnahmen zur Innovationsförderung; |
A. Ziele und Maßnahmen der Raumfahrtindustriepolitik
|
8. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass die Raumfahrtindustrie für die EU und ihre Bürger extrem wichtig ist, und sieht ebenso wie die Kommission die großen Herausforderungen, vor denen die EU-Raumfahrtindustrie angesichts der Entwicklungen in den von aufstrebenden Weltraummächten (wie China oder Indien) steht. Wie in der Mitteilung festgestellt wird, ist dies auf unzureichende Finanzierung und nicht etwa auf mangelnde Wirtschaftlichkeit des europäischen Raumfahrtsektors zurückzuführen. |
|
9. |
ist der Ansicht, dass zu einem Zeitpunkt, zu dem die EU und ihre Mitgliedstaaten mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, der Schwerpunkt der EU-Raumfahrtindustriepolitik auf der Schaffung der Grundlagen für einen künftigen Aufschwung in diesem Sektor sowie der Beseitigung eventueller diesbezüglicher Hindernisse liegen müsste. Der Ausschuss unterstützt daher uneingeschränkt die in der Mitteilung beschriebenen Ziele: Schaffung eines Regelungsrahmens, Weiterentwicklung einer wettbewerbsfähigen industriellen Basis, Förderung der Wirtschaftlichkeit, Entwicklung der Märkte für Raumfahrtanwendungen sowie Sicherstellung der technologischen Eigenständigkeit und eines unabhängigen Zugangs zum Weltraum; |
|
10. |
teilt die Auffassung, dass für eine wirksame Steuerung der Raumfahrtaktivitäten in Europa eine Vereinbarung zwischen den wichtigsten Interessenträgern — Europäische Kommission, ESA und Mitgliedstaaten — erforderlich ist, gibt allerdings zu bedenken, dass aus politischer Sicht eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik die Zusammenarbeit zwischen den militärischen Sektoren der Mitgliedstaaten erleichtern würde, wovon auch die zivile Raumfahrt profitieren würde; |
|
11. |
erkennt die Marktergebnisse des europäischen Raumfahrtsektors insbesondere im Bereich der Satellitenkommunikation an und unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit dieses Segments auf dem Weltmarkt zu erhalten. Unter diesem Blickwinkel befürwortet der Ausschuss nachdrücklich die Initiative, den europäischen Betreibern den Zugang zu Radiofrequenzkanälen zu garantieren. Dies ist für die Regionen von Bedeutung, da die Satellitenkommunikation das Schließen der Breitbandlücke in dünn besiedelten Gebieten ermöglicht; |
|
12. |
ist sich der Bedeutung der technologischen Eigenständigkeit des europäischen Raumfahrtsektors bewusst und mit den Lösungsvorschlägen einverstanden, als da sind Austausch mit anderen Sektoren, Lancierung von Aufforderungen zur Einreichung von Projekten im Rahmen des Horizont-2020-Programms und Investitionen in die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für die Raumfahrtindustrie; |
|
13. |
fragt sich allerdings, ob die verfügbaren Finanzmittel (z.B. im Rahmen von Horizont 2020) ausreichen würden, um signifikante Fortschritte in Richtung technologische Eigenständigkeit zu erzielen. Er fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, einen detaillierten Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie dieses Ziel erreicht werden soll; |
|
14. |
schlägt in Bezug auf die qualifizierten Arbeitskräfte vor, dass die Priorität zunächst auf der Suche in den neuen Mitgliedstaaten liegen sollte, die ausnahmslos ihr Interesse und ihren Ehrgeiz bekundet haben, sich dem Kreis der Raumfahrtnationen anzuschließen, und die überdies einen hohen Bildungsstand in Ingenieur- und Naturwissenschaften vorzuweisen haben; |
|
15. |
befürwortet nachdrücklich die Entwicklung des Marktes für weltraumgestützte Anwendungen und Dienste und stellt fest, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei diesem Prozess eine grundlegende Rolle spielen können; |
|
16. |
möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften wichtige Endnutzer von weltraumgestützten Diensten sind. Um das Potenzial der weltraumgestützten Dienste voll auszuschöpfen, sollten ihre Vorteile den Gebietskörperschaften als potenziellen Nutzern stärker bewusst gemacht werden. Es ist ein intensiverer Dialog zwischen Dienstleistungsanbietern und Endnutzern erforderlich; |
|
17. |
ist überdies der Auffassung, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften innerhalb ihres Gebiets die verschiedenen am Innovationsdreieck beteiligten Wirtschaftsteilnehmer und Akteure zusammenbringen. Die Gebietskörperschaften sind für die Innovations- und KMU-Programme verantwortlich, die mit der Raumfahrt verknüpft werden und so einen strategischen Beitrag zur Verbesserung des Raumfahrtmarktes leisten könnten; |
|
18. |
stellt außerdem fest, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aufgrund ihrer Bürgernähe ganz speziellen Zugang zu den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen innerhalb ihres Gebiets haben und deshalb optimal geeignet sind, um die Menschen über die Vorteile weltraumgestützter Dienste zu informieren; vor diesem Hintergrund kommt Netzwerken lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, wie z.B. dem Netzwerk NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies), eine besondere Bedeutung zu; |
B. Allgemeine lokale und regionale Anliegen
|
19. |
vertritt aus der Sicht der Regionen, die zu den Hauptnutzern von Satellitenanwendungen wie insbesondere Copernicus/GMES-Dienstleistungen und -Produkten zählen, die Auffassung, dass eine Raumfahrtindustriepolitik der EU die technologische Innovation fördern und die diesbezüglichen Hindernisse beseitigen sollte. Der Erfolg der EU-Raumfahrtpolitik wird an Faktoren wie Wachstum, Kostenvermeidung, branchenübergreifenden Spill-over-Effekten sowie hochwertigen, produktiven Beschäftigungsmöglichkeiten gemessen werden; |
|
20. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass die Förderung der nachfrageseitigen Innovation die wichtigste Herausforderung ist, die die EU-Raumfahrtpolitik bewältigen muss, damit die innerhalb der Rahmenprogramme bereits in die Raumfahrt investierten Mittel den Regionen und den Bürgern der EU wirtschaftlichen Nutzen bringen; |
|
21. |
stimmt zu, dass eine nachfrageorientierte politische Ausrichtung für den EU-Raumfahrtsektor die Position der Nutzer stärken soll, aber nicht auf Verbrauchersubventionen reduziert werden darf; |
|
22. |
fordert die Kommission auf, Kriterien für den öffentlichen Nutzen hinsichtlich der Zuständigkeiten und Erfordernisse der Behörden festzulegen, die bei der Bewertung der Nutzernachfrage zugrunde gelegt werden; |
|
23. |
merkt unter dem regionalen Blickwinkel an, dass die lokalen und regionalen Endnutzer die Dienstleistungen und Produkte von Copernicus nur dann in Anspruch nehmen werden, wenn aus ihrer Sicht klare wirtschaftliche Gründe dafür sprechen; |
|
24. |
empfiehlt, dass die Kommission sich mit der Frage der Finanzierungsmechanismen für derzeitige und potenzielle Nutzer beschäftigt, die von der EU und ihren Mitgliedstaaten bereitgestellt werden könnten, sobald die Dienste betriebsbereit sind. In Europa ist die Erdbeobachtung wie überall auf der Welt eine öffentliche Infrastruktur, und die Verfolgung des öffentlichen Interesses bedeutet Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln für Forschung und Entwicklung sowie für die Einführung und den Betrieb von Diensten; |
|
25. |
ist der Meinung, dass die operationelle Phase entscheidend für den wirtschaftlichen Durchbruch neuer technischer Entwicklungen ist, jedoch finanzielle Unterstützung zur Deckung der bei der Übernahme neuer Technologien durch die verschiedensten Nutzer anfallenden Anlaufkosten erfordern wird; |
|
26. |
geht davon aus, dass Nutzer wie beispielsweise die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und KMU weiterhin Anreize und Unterstützung seitens der EU und der Mitgliedstaaten benötigen werden, und merkt an, dass auch die ESA in die Unterstützung für die Nutzer eingebunden werden könnte; |
|
27. |
verweist auf den durch die bewährten Verfahren der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erbrachten Nachweis, dass die nachgelagerten Copernicus/GMES-Dienstleistungen den Erfordernissen der öffentlichen Politik entsprechen und ihre Nützlichkeit für öffentliche politische Zielsetzungen unter Beweis gestellt haben; |
|
28. |
schlägt vor, dass Dienstleistungen und Anwendungen, die auf der Grundlage von Weltraumtechnologie entwickelt werden, aus den Strukturfonds kofinanziert werden können, sofern bei den Fondsverantwortlichen der entsprechende politische Wille und das entsprechende Bewusstsein vorhanden sind. Ein derartiger Mechanismus wurde bereits unter dem Finanzrahmen 2007-2013 genutzt, wobei nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Kohäsionsfonds/dem EFRE einer neuen Priorität zugewiesen wurden: satellitengestütztes Breitbandinternet für abgelegene Regionen; |
C. Lösung der Probleme dieses Sektors
|
29. |
hält fest, dass der Raumfahrtsektor durch lange Entwicklungszyklen gekennzeichnet ist. Dies erhöht die Marktrisiken, da das Marktpotenzial für neue Anwendungen lange im Voraus bewertet werden muss. Infolge dessen ist es für die Raumfahrtunternehmen schwierig, Investoren zu gewinnen. Außerdem ist aufgrund der langen Betriebsdauer von Raumfahrtressourcen (10-15 Jahre bei Telekommunikationssatelliten) der Markt starken zyklischen Schwankungen unterworfen, und eine rasche Anpassung an die sich verändernden Nachfragebedingungen ist sehr schwierig; |
|
30. |
nimmt zur Kenntnis, dass im vorgelagerten Bereich hohe Fixkosten infolge massiver FuE-Investitionen und langer Entwicklungszeiten sowie das geringe Marktvolumen Skaleneffekte verhindern, was eine Tendenz zur Konzentration (z.B. bei den Trägersystemen) fördert. Andererseits sind im nachgelagerten Bereich große Skaleneffekte möglich, wodurch größere Märkte wirtschaftlich rentabler werden. Angesichts derartiger Herausforderungen kann die zentrale Rolle der Regierungen in der europäischen Raumfahrtindustrie nicht ignoriert werden; |
|
31. |
betont, dass es für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten absolut unverzichtbar ist, in Abstimmung mit der ESA unverzüglich die notwendigen politischen, rechtlichen und technischen Entscheidungen für die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel zu treffen, um den unabhängigen Zugang zum Weltraum zu gewährleisten, die gegenwärtig entwickelten oder geplanten Weltraumsysteme fertigzustellen und FuE sowie die Entwicklung innovativer weltraumgestützter Dienstleistungen und Anwendungen zu fördern; |
|
32. |
nimmt zur Kenntnis, dass die Raumfahrtindustrie, obgleich von strategischer Bedeutung, im Vergleich zu anderen Industriesektoren in der EU immer noch keine große Rolle in den einzelnen Volkswirtschaften spielt, und dringt darauf, im Rahmen der künftigen EU-Raumfahrtindustriepolitik eine größere Unabhängigkeit der EU von der Versorgung mit strategischen Komponenten aus Drittländern sicherzustellen; |
|
33. |
ermutigt die ESA, durch die Bereitstellung von Finanzmitteln für Durchführbarkeitsstudien, Marktanalysen und Prototypen auch weiterhin Organisationen zu unterstützen, die an der Übertragung von Weltraumtechnologie auf andere Wirtschaftszweige interessiert sind. Unterstützung für Start-up-Unternehmen steht über Gründerzentren sowie als „Anreiz“ (bzw. Anschubfinanzierung) über das ESA-Büro für Technologietransfer (Technology Transfer Programme Office, TTPO) zur Verfügung. Der Ausschuss fordert außerdem einen Dialog, durch den den Akteuren auf lokaler und regionaler Ebene mehr Möglichkeiten eröffnet werden könnten; |
|
34. |
vertritt den Standpunkt, dass die EU die „intelligente Spezialisierung“ fördern und das Zusammenspiel zwischen ihren Regional- und Innovationsförderprogrammen verbessern muss, um gegenüber ihren internationalen Konkurrenten nicht an Boden zu verlieren; |
|
35. |
stimmt den Schlussfolgerungen des Rates zu, dass die Einbindung der Regionen als maßgebliche Akteure in die EU-Innovationspolitik ein Schlüsselelement der intelligenten Spezialisierung ist, das auch dem Forschungssektor helfen kann, das enorme finanzielle Potenzial der EU-Regionalfonds zu erschließen. Aus Sicht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften besonders wichtig ist die Entwicklung der Geschäftsmodelle und die Verbesserung der unternehmerischen Fähigkeiten, die in KMU im Bereich von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erdbeobachtung vorhanden sind; |
|
36. |
fordert koordinierte politische Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten, um den europäischen Erdbeobachtungssektor sowohl angebots- als auch nachfrageseitig beschleunigt zur Reife zu entwickeln. Die jüngste Konsolidierungswelle ist ein Zeichen, dass sich die Industrie auf die nächste Phase vorbereitet. Dies ist der richtige Zeitpunkt für maßgebliche Nutzergruppen wie z.B. Regierungen, sich für großmaßstäbliche Erdbeobachtungsanwendungen zu entscheiden. Wenn es den Regierungen gelingt, die Nachfrage im EU-Kontext zu bündeln, wird dies zum einen die Nachfrage steigern und zum andern Standardisierung (sowie Skalenerträge für die Industrie) ermöglichen; |
D. Auswirkungen auf den Raumfahrtsektor
|
37. |
stellt fest, dass verschiedene Technologie-Spinoffs aus dem Raumfahrtsektor im Bereich Biowissenschaften derzeit in der EU nicht genügend genutzt werden und dass durch die Festlegung einer gezielten Spinoff-Strategie (unter umfassenderer Beteiligung von Vertretern anderer Industriezweige) zu Beginn eines Raumfahrtprogramms EU-weit enorme Vorteile realisiert werden könnten; |
|
38. |
unterstreicht die Bedeutung der Satellitentechnologie im Raumfahrtsektor der EU und hält fest, dass grob gerechnet zwei Drittel aller verkauften Satelliten für Telekommunikationsanwendungen bestimmt sind. Im Kontext der EU-Raumfahrtindustriepolitik ist es daher wichtig, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass dieser Markt zyklischen Schwankungen unterliegt, die vor allem Veränderungen bei der Nachfrage nach GEO-Telekommunikationssatelliten und den entsprechenden Raketenstartdiensten widerspiegeln; |
|
39. |
merkt an, dass Mobiltelefone, das Internet, Kreditkarten, Mautsysteme, Fernsehen und Wettervorhersagen nur einige Beispiele für gänzlich oder teilweise satellitengestützte Funktionen des täglichen Lebens sind. Weitere, strategisch bedeutsamere Funktionen sind u.a. die Landwirtschaft, die Überwachung von Meeres- und Windströmungen, Navigationsdienste für die Schiff- und Luftfahrt sowie die Überwachung von Notfällen, Verschmutzung, Klimaveränderungen und der Umwelt; |
|
40. |
stellt außerdem fest, dass der Zuwachs privater Akteure in der Raumfahrtindustrie dazu beigetragen hat, dass weltraumgestützte Technologien und Dienstleistungen erschwinglicher und zugänglicher geworden sind, was es Ländern ohne eigene nationale Raumfahrtprogramme und Entwicklungsländern erlaubt hat, von bestimmten durch die Raumfahrt ermöglichten Vorteilen zu profitieren; |
|
41. |
erkennt an, dass das EU-Rahmenprogramm (RP7) erheblich zur Innovationsförderung bei Galileo/EGNOS und den zugehörigen Dienstleistungen beigetragen hat, wobei allerdings möglicherweise bedauert werden könnte, das innerhalb des RP7 der Schwerpunkt auf dem nachgelagerten Bereich lag und den Anwendungen nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde; |
E. Künftiger Ansatz für die Raumfahrtindustriepolitik der EU
|
42. |
fragt sich, ob die bisherige Schwerpunktsetzung auf die Bereiche Arbeitsmarkt, Infrastruktur und Einhaltung der Wettbewerbsregeln (mit anderen Worten auf der Qualität der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen) ausreicht oder ob stattdessen die Fähigkeit zur Herstellung exportfähiger Güter und Dienstleistungen in den Fokus gerückt werden sollte; |
|
43. |
begrüßt, dass die Programme GALILEO und Copernicus im mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 der EU Berücksichtigung gefunden haben; |
|
44. |
macht darauf aufmerksam, dass die EU — obwohl Forschung und Entwicklung sowie Spitzentechnologie im Mittelpunkt ihrer Strategie für den Zeitraum 2014-2020 stehen — ihren Wettbewerbsvorsprung in diesem Bereich gegenüber den rasch aufholenden Schwellenländern wie Indien, China und Brasilien verlieren könnte, wenn die FuE-Budgets der Mitgliedstaaten hinter den in der Lissabon-Strategie festgelegten Zielvorgaben zurückbleiben; |
|
45. |
weist darauf hin, dass der Erfolg jeglicher Industriepolitik auch unauflöslich mit den makroökonomischen Trends in der EU und den einzelnen Volkswirtschaften verbunden ist; er fordert die Entwicklung einer forschungsintensiven Hightech-Industrieproduktion, wo der Wettbewerbsvorteil genutzt werden kann; |
|
46. |
hält die ausgewogene Umsetzung der Europa-2020-Strategie für wichtig; er fragt sich daher, ob die Wettbewerbsfähigkeit in innovativen Sektoren ausreicht, um Beschäftigung und Wachstum EU-weit zu verbessern, und fordert entsprechende Unterstützung für den gesamten Raumfahrtsektor im Sinne einer ausgewogeneren Verteilung großer, mittlerer und kleiner Unternehmen; |
|
47. |
erkennt an, dass die Europäische Kommission über die Instrumente (wie z.B. intelligente Spezialisierung) verfügt, um einen stärker geografisch orientierten Ansatz für die Industriepolitik in den Schlüsselsektoren zu gewährleisten, aber es bleibt noch viel zu tun, um einen ausreichenden Zugang zu Finanzierung aus nicht allzu risikoscheuen Quellen (Risikokapital) zu gewährleisten; |
|
48. |
weist darauf hin, dass eine enge Beziehung zwischen der lokalen/regionalen Ebene, die die einzelnen Industriezweige bei ihren ersten Schritten begleitet und unterstützt, und der nationalen/EU-Ebene ein wichtiger Aspekt der EU-Industriepolitik sein sollte; |
F. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
|
49. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass sich gemäß Artikel 4 Absatz 3 AEUV in den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt die Zuständigkeit der Union darauf erstreckt, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten daran hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. Die geteilten Zuständigkeiten werden gelten, bis die EU Sekundärrecht in diesen Bereichen setzt zu diesem Zeitpunkt müssen die nationalen Parlamente dann etwaige kollidierende nationale Rechtsvorschriften aufheben; |
|
50. |
nimmt zur Kenntnis, dass die zersplitterten und begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten, die für die Weltraumforschung zur Verfügung stehen, als eines der Haupthindernisse für den weiteren Ausbau der Weltraumaktivitäten betrachtet werden, und fordert daher eine bessere Koordinierung dieser Aktivitäten zwischen der EU, der ESA und ihren jeweiligen Mitgliedstaaten, damit Europa eine weltweite Führungsrolle im Raumfahrtsektor einnehmen kann. Wie wichtig die Beteiligung der EU an der Finanzierung der Weltraumforschung ist, wird durch die Tatsache belegt, dass es viele Weltraumforschungsaktivitäten ohne die Unterstützung der Kommission nicht geben würde. Entsprechende Maßnahmen der EU werden deshalb für unverzichtbar erachtet; |
|
51. |
ist der Ansicht, dass die in der Mitteilung vorgeschlagenen Maßnahmen notwendig sind, da bestimmte transnationale Aspekte dieser Thematik von den Mitgliedstaaten nicht zufriedenstellend geregelt werden können und weil die bestehenden EU-Maßnahmen wie auch die in diesem Rahmen geleistete Unterstützung nicht ausreichen, um die angestrebten Ziele zu verwirklichen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden aufgrund ihres Umfangs und ihrer Effizienz einen klaren Vorteil gegenüber isolierten Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene bringen — und dies hauptsächlich wegen der Skaleneffekte, weil umfassende Raumfahrtprogramme ein Investitionsvolumen erfordern, das sich die Mitgliedstaaten alleine nicht leisten können; |
|
52. |
hält außerdem fest, dass diese Initiative nicht Initiativen der Mitgliedstaaten ersetzen soll. Sie soll die auf deren Ebene durchgeführten Maßnahmen ergänzen und die Koordinierung dort ausbauen, wo dies zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele notwendig ist; |
|
53. |
hält die angeführten Argumente für klar, angemessen und überzeugend. Die in dieser Mitteilung vorgesehenen EU-Maßnahmen stehen daher im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip; |
|
54. |
stimmt bezüglich des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mit der Kommission darin überein, dass die EU in ihrer Rechtsetzungstätigkeit nicht über das erforderliche Maß hinausgehen sollte. Vorrang haben sollte die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die Koordinierung der einzelstaatlichen Maßnahmen oder die Ergänzung und Unterstützung derartiger Maßnahmen durch Leitlinien, Mechanismen für den Informationsaustausch usw. Zu den im Kontext der entstehenden EU-Raumfahrtpolitik zu regelnden Aspekten gehören Industrienormen sowie Fragen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb und der kommerziellen Nutzung der Satellitenkommunikationsinfrastruktur. |
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/55 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Cars 2020: Ein Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Automobilindustrie in Europa
2013/C 356/10
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
stellt fest, dass die Schwierigkeiten der Automobilindustrie in vielen Mitgliedstaaten mit strukturellen Ursachen zusammenhängen, die tiefgreifende Veränderungen erfordern; |
|
— |
betont die Wichtigkeit, alle Möglichkeiten auf Ebene der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auszuschöpfen. Hierzu zählen, abhängig von ihren innerstaatlich geregelten Kompetenzen, der Abbau bürokratischer Hürden, Beschleunigung von Bewilligungsverfahren, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Einrichtung von Kompetenz- und Innovationszentren und die Ausschreibung innovativer Projekte; |
|
— |
verweist auf die Möglichkeiten der Förderung von Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung oder die Einrichtung von Clustern. In einigen Regionen wurden Automobil-Cluster durch Einbeziehung von Bahnsystemen und Luftfahrt und sogar Fahrrädern — insbesondere E-Bikes und Pedelecs — zu „Mobilitäts-Clustern“ weiterentwickelt. Durch Diversifizierung in der Produktion konnte auch in Krisenzeiten eine kontinuierliche Auslastung der Betriebe erhalten werden. Gestützt wird dieser Trend vor allem durch die Nutzung von Synergieeffekten im Innovations- und Technologiebereich; |
|
— |
begrüßt nachdrücklich den Ansatz der Europäischen Kommission, eine hochrangige Expertengruppe einzusetzen, die die Beobachtung der Implementierung und Nachjustierung der Maßnahmen des Aktionsplans zur Aufgabe hat, und befürwortet die Einbindung des Ausschusses der Regionen in ihre Arbeit. |
|
Berichterstatter |
Christian BUCHMANN (AT/EVP), Landesrat in der Steiermärkischen Landesregierung |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — „CARS 2020: Ein Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Automobilindustrie in Europa” COM(2012) 636 final |
I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
|
1. |
Die Automobilindustrie steht für 12 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze in der EU sowie 28 Mrd. EUR an Investitionen in Forschung und Entwicklung (2009). Sie ist ein Wachstumsmultiplikator, der einen beträchtlichen, positiven Anteil an der Handelsbilanz der EU liefert. |
|
2. |
Die europäische Automobilindustrie steckt in einer schweren Krise, die sich noch zu verschärfen droht und Auswirkungen auf die gesamte europäische Wirtschaft hat. |
|
3. |
Während außereuropäische Märkte wie beispielweise die BRIC-Staaten boomen, stagniert die europäische Automobilnachfrage, wie die Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen in Europa deutlich zeigt. Die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge fiel im Januar 2013 um 8,7 % auf 885 159 und damit auf den niedrigsten Wert in einem Januar seit Beginn der Aufzeichnungen (1). |
|
4. |
Vom Potenzial ausländischer Märkte können bzw. konnten europäische Hersteller nur bedingt und in unterschiedlicher Weise profitieren. Während PSA, Peugeot, Citroën, Ford oder Fiat deutliche Einbußen verzeichnen, konnten die Premium-Anbieter BMW, Audi und Daimler anfänglich ihre Verkaufszahlen noch steigern. Für Massenhersteller, die ihre Klein- und Mittelklassewagen bisher vor allem in Europa verkauft haben, gestaltet sich die wirtschaftliche Situation zunehmend schwieriger. |
|
5. |
Eine Verbesserung der Lage für die kommenden drei Jahre wird von Experten nicht erwartet. Weitergehende Restrukturierungen, Stellenabbau und Werksschließungen sind im Automobilsektor zu erwarten. Gleichzeitig stellt sich die Frage des Umfangs möglicher Unterstützungen und der Intensivierung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten. |
II. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
6. |
stellt fest, dass die Schwierigkeiten der Automobilindustrie in vielen Mitgliedstaaten mit strukturellen Ursachen zusammenhängen, die tiefgreifende Veränderungen erfordern; |
|
7. |
betont, dass diese Veränderung von einem intensiven sozialen Dialog begleitet werden muss, um die Auswirkungen für die Betroffenen möglichst in Grenzen zu halten; |
|
8. |
begrüßt ausdrücklich die Kommissionsmitteilung CARS 2020, in welcher ein Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Automobilindustrie in Europa vorgeschlagen wird; |
|
9. |
teilt die Auffassung der Europäischen Kommission, dass diese Maßnahmen aufgrund der beschriebenen Ausgangssituation rasch umgesetzt werden müssen; |
|
10. |
weist darauf hin, dass die Automobilindustrie in Europa einen Beitrag zu einer langfristig nachhaltigen Gesellschaft leisten soll. In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen im Umwelt- und Klimabereich und auch der Verkehrssicherheit von großer Bedeutung sein; |
|
11. |
begrüßt nachdrücklich den Ansatz der Europäischen Kommission, eine hochrangige Expertengruppe einzusetzen, die die Beobachtung der Implementierung und Nachjustierung der Maßnahmen des Aktionsplans zur Aufgabe hat, und befürwortet die Einbindung des Ausschusses der Regionen in die Arbeit der hochrangigen Expertengruppe; |
|
12. |
vermisst mit großer Sorge die erforderliche Kohärenz in den Vorschlägen der Europäischen Kommission. Oft arbeiten die Generaldirektionen für Unternehmen, Klima, Umwelt, Beschäftigung, Binnenmarkt oder Handel aneinander vorbei, die Initiativen der verschiedenen Bereiche sind unzureichend aufeinander abgestimmt; |
|
13. |
verweist beispielhaft auf die Beschränkungen der Beihilfen für Großunternehmen und die derzeitige, sehr niedrige Schwelle für die Definition kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), wie bereits in der Stellungnahme des AdR zu Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2014-2020 (CDR2232-2012_00_00_TRA_AC) ausgeführt; |
|
14. |
betont in diesem Zusammenhang die große Bedeutung von flexiblen Instrumenten zur Unterstützung von Unternehmen in Schwierigkeiten und verweist diesbezüglich auf die Stellungnahme des AdR zu Leitlinien der EU für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (CDR240-2013_00_00_TRA_AC); |
|
15. |
erinnert daran, dass in dem im Juni 2012 angenommenen Abschlussbericht zu CARS 21 u.a. die Empfehlung enthalten war, europäische Leitlinien über finanzielle Anreize für die Förderung „sauberer Fahrzeuge“ aufzustellen; bedauert diesbezüglich, dass die Europäische Kommission Leitlinien über finanzielle Anreize nur in Form eines Arbeitspapiers und nicht in Form eines Legislativdokuments erarbeitet hat; bedauert ferner, dass dieses Arbeitspapier nur fünf unverbindliche „grundsätzliche Empfehlungen“ enthält und in Bezug auf die Auswirkungen der erheblichen Unterschiede bei den steuerlichen Anreizen auf das Funktionieren des Binnenmarkts vage bleibt; |
|
16. |
betont die Wichtigkeit, alle Möglichkeiten auf Ebene der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auszuschöpfen. Hierzu zählen, abhängig von ihren innerstaatlich geregelten Kompetenzen, der Abbau bürokratischer Hürden, Beschleunigung von Bewilligungsverfahren, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Einrichtung von Kompetenz- und Innovationszentren und die Ausschreibung innovativer Projekte; |
|
17. |
möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass als Initiative auf regionaler oder lokaler Ebene eine Zusammenarbeit bei gemeinsamen Testgeländen für die europäische Automobilindustrie ins Auge gefasst werden könnte. An solchen gemeinsamen Vorhaben können lokale und regionale Gebietskörperschaften, die Industrie, Forschungsakteure usw. beteiligt werden, sie verfügen über ein großes Potenzial, um die Gesamtentwicklungskosten der Automobilindustrie zu senken, und sie haben positive langfristige Effekte für die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt; |
|
18. |
stellt fest, dass der Schwerpunkt der Mitteilung auf verstärkten Bemühungen um die Energieeffizienz der Fahrzeuge liegt, während ein für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für die Umwelt besonders wichtiger Punkt außer Acht gelassen wird, nämlich die Energieeffizienz der Automobilmontage- und Zulieferbetriebe selbst, die als Aktionsbereich im Rahmen von Cars 2020 berücksichtigt werden sollte; |
INVESTITIONEN IN FUE
|
19. |
bestätigt die Europäische Kommission darin, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung eine zentrale Rolle für die künftige Entwicklung der europäischen Autoindustrie spielen, wie bereits auch in der Stellungnahme des AdR zu Horizont 2020 — Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (CdR 402/2011 fin) ausgeführt; |
|
20. |
weist u.a. auf die demografische Entwicklung hin, die die Notwendigkeit intensiver Bemühungen um Investitionen in Forschung und Entwicklung noch deutlicher hervortreten lässt. Eine immer älter werdende Bevölkerung mit neuen Bedürfnissen erfordert eine Anpassung von Technik und Funktionen in Fahrzeugen, die dem geänderten Bedarf einer immer älteren Bevölkerung als Nutzer von Fahrzeugen entsprechen. Effizientere, komfortablere, sicherere, leisere, besser vernetzte und benutzerfreundlichere Fahrzeuge können auf diese Weise zu einem modernen Wettbewerbsfaktor werden, der die europäische Automobilindustrie auf lange Sicht stärken kann; |
|
21. |
streicht heraus, dass insbesondere KMU als Innovatoren im Zulieferbereich sowie bei der Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie wahrnehmen. Die in CARS 2020 angesprochenen Unterstützungen seitens der europäischen Ebene wären gerade hier äußerst wichtig; |
|
22. |
verweist auf die Erfahrungen aus den Forschungsrahmenprogrammen der letzten Jahre, nach welchen KMU trotz Verbesserungsbemühungen der Europäischen Kommission nach wie vor nur in geringem Ausmaß von den Fördermitteln der europäischen Forschungsprogramme profitieren. Ursächlich dafür sind der hohe bürokratische Aufwand, die langen Vorlaufzeiten, aber auch die insgesamt zu geringe Mitteldotierung und die daraus folgende geringe Anzahl an geförderten Projekten; |
|
23. |
unterstützt die Europäische Kommission in ihren Vorschlägen zur Vereinfachung der Projektförderung in Horizont 2020 und fordert das EP auf, die vorgelegten Vorschläge zur Entbürokratisierung entsprechend mitzutragen, um auch den Kontrollaufwand zu verringern; |
|
24. |
bedauert, dass die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Mitteldotierung von Horizont 2020 nicht aufgegriffen wurden; |
DIE ROLLE DER STRUKTURFONDS
|
25. |
plädiert für eine optimale Nutzung der Strukturfonds durch die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im Rahmen der beihilfenrechtlichen Möglichkeiten; |
|
26. |
verweist auf die in den Strukturfonds bestehenden Möglichkeiten; dazu zählen beispielsweise die Förderung von Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung oder die Einrichtung von Clustern. In einigen Regionen wurden Automobil-Cluster durch Einbeziehung von Bahnsystemen und Luftfahrt und sogar Fahrrädern — insbesondere E-Bikes und Pedelecs — zu „Mobilitäts-Clustern“ weiterentwickelt. Durch Diversifizierung in der Produktion konnte auch in Krisenzeiten eine kontinuierliche Auslastung der Betriebe erhalten werden. Gestützt wird dieser Trend vor allem durch die Nutzung von Synergieeffekten im Innovations- und Technologiebereich; |
QUALIFIKATION
|
27. |
unterstreicht die auch in der Mitteilung CARS 2020 angesprochenen Probleme der Aus- und Weiterbildung, des demografischen Wandels, des Facharbeitermangels sowie des spürbaren Mangels an jungen Absolventen von technischen Universitäten; |
|
28. |
betont die Notwendigkeit einer sinnvollen Verwendung von ESF-Mitteln zur weiterführenden Qualifizierung von Arbeitnehmern, die noch nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die Programmierung des Einsatzes von ESF-Mitteln liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Dadurch soll die Berücksichtigung spezifischer Entwicklungserfordernisse der jeweiligen Region sichergestellt werden; |
|
29. |
unterschreibt in diesem Zusammenhang die Forderung des Europäischen Parlaments an die Europäische Kommission, einen Vorschlag für einen Rechtsakt über Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und Management von Umstrukturierungen zu unterbreiten; |
|
30. |
fordert eine ausreichende Dotierung und flexible Ausgestaltung des EGF zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Globalisierung auf europäische Unternehmen bzw. deren Arbeitnehmer; |
|
31. |
verweist auf die positiven Erfahrungen mit frühzeitiger Ausbildung von Jugendlichen im dualen Ausbildungssystem, in dem Unternehmen benötigte Facharbeiter selbst ausbilden und Jugendliche nach der Ausbildung gute Chancen auf sofortige Beschäftigung haben; |
|
32. |
unterstützt gezielte Maßnahmen, um technische Berufe für Frauen attraktiv zu machen. Europaweit liegt die Quote der Absolventinnen von technischen Universitäten unter 10 %. Erfahrungen in einzelnen Regionen haben gezeigt, dass Frauen speziell in der FuE eine besonders wertvolle Sensibilität einbringen und in der Automobilentwicklung besonders geschätzt werden. Darüber hinaus stellen Frauen mit mehr als 50 % die stärkste Käuferschicht; |
|
33. |
ruft auf zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen dem Berufsbildungssystem und der Wirtschaft, da er darin eine Chance für die bessere Abstimmung der Ausbildungspläne auf die Bedürfnisse eines sich wandelnden Marktes sieht; |
ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE UND NOTWENDIGE INFRASTRUKTUR
|
34. |
fordert die Industrie auf, die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien weiter zu intensivieren und alltagstaugliche Lösungen auf dem Markt zu bringen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, aber auch um den Technologievorsprung ökonomisch (Senkung der Treibstoffkosten, Handelsbilanz, Beschäftigung in der Biokraftstoffgewinnung usw.) und vom Standpunkt der Energieeinsparung nutzen zu können. Dies inkludiert auch Verfahren und Technologien zur Lagerung und Speicherung von neuen Energieressourcen; |
|
35. |
schlägt einen intensiven Informationsaustausch unter allen Mitgliedstaaten über erfolgreiche Praktiken in der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungssystem und der Wirtschaft vor, damit alle Regionen davon profitieren; |
|
36. |
fordert in diesem Zusammenhang, die Entwicklung unterschiedlicher Technologien durch eine genaue Zielvorgabe voranzutreiben und keine Alternative auszuschließen. Abhängig vom Anwendungszweck haben einzelne Technologien jeweilige Stärken und auch Schwächen. Gleichzeitig sollte bei der Regulierung des Einsatzes alternativer Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen die Gesamtenergiebilanz inklusive des Energieverbrauchs bei der Herstellung des Kraftstoffs beachtet werden; |
|
37. |
betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Bereitstellung entsprechender Infrastruktur, ohne die eine Markterschließung erschwert wird. Gemeinsam sollten deshalb Anstrengungen unternommen werden, alternative Kraftstoffe zu forcieren und die dafür notwendige Infrastruktur zu schaffen. Dazu werden spezielle Koordinierungsgremien zwischen der Branche und den für Planung und Infrastrukturen Verantwortlichen eingesetzt. Die Entwicklung dieser Infrastrukturen sollte sich auf vorherige Studien und integrierte Mobilitätspläne stützen, mit denen bezüglich der einzelnen Verkehrsmittel und der Anforderungen der betreffenden Region oder lokalen Gebietskörperschaft verschiedene Optionen geprüft werden können; |
|
38. |
fordert dazu auf, europäische Leitlinien über finanzielle Anreize für „saubere Fahrzeuge“ auszuarbeiten und dabei verfügbare objektive Daten wie etwa CO2-Emissionswerte zugrunde zu legen; |
|
39. |
begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative der Europäischen Kommission Saubere Energie für den Verkehr und verweist auf die einschlägige Stellungnahme des AdR (CDR28-2013_00_00_TRA_AC); |
|
40. |
stellt fest, dass im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe innovative Lösungen existieren. Alternative Antriebstechniken können gerade im städtischen Bereich durch Investitionen der öffentlichen Hand besonders unterstützt werden (Flottenumstellung); |
|
41. |
verweist auf viele erfolgreiche Beispiele aus Regionen und Kommunen, wo mit einem Mix aus Förderung für Elektrofahrzeuge, Parkraumbewirtschaftung, Infrastruktur (Ladestationen) neue Wege beschritten werden; |
LEBENSZYKLUSBETRACHTUNG UND RECYCLING
|
42. |
verweist auf die EU-Richtlinie 2000/53/EG vom 18. September 2000, in der festgelegt wird, dass ab 2015, 95 % des Gewichts eines Automobils einer Wiederverwertung zugeführt werden müssen. Damit können der Ressourcenverbrauch durch Nutzung von Verwertungsressourcen reduziert und die Importabhängigkeit von Rohstofflieferanten herabgesetzt werden. Gleichzeitig wird das prozessorientierte Recycling die Basis für eine kontinuierliche Wertschöpfung und schafft qualifizierte Arbeitsplätze in Europas Regionen; |
|
43. |
betont, dass die konsequente Lebenszyklusbetrachtung bereits beim Design eines Automobils beginnt und auch alle umweltrelevanten Auswirkungen im Produktionsprozess umfasst, inklusive der Betriebsphase und am Ende auch das Recycling bzw. die Aufbereitung zur späteren Wiederverwertung; |
|
44. |
weist darauf hin, dass die ganzheitliche Betrachtung vor allem große Chancen bei der Entwicklung von neuen nachhaltigen Materialien und Werkstoffen bringt und hilft, die CO2-Ziele, die in der EU-Strategie 2020 verankert sind, zu erreichen; |
|
45. |
unterstreicht, dass durch den Export von mehr als 75 % der Altfahrzeuge am Ende des Produktlebenszyklus ein enormes Ressourcenpotenzial verloren geht und für neue Fahrzeuge daher neue Erst-Ressourcen verwendet werden müssen, die aus Asien zugekauft werden (seltene Erden); |
|
46. |
betont die wichtige Funktion von Recycling in diesem Zusammenhang zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der Verringerung der Abhängigkeit von Rohstofflieferanten; |
|
47. |
fordert deshalb stärkere gemeinsame Anstrengungen, um Altfahrzeuge verstärkt als Ressourcen zu nutzen. Ziele sollten die Schaffung einer klaren Regelung zur Recycling-Verpflichtung und Forcierung der Entwicklung von nachhaltigen Materialien sein; |
|
48. |
fordert eine stärkere Beachtung des Gebrauchtwagenmarkts sowie eine Studie des Verbraucherverhaltens während des Beschlussfassungsprozesses hinsichtlich der Bewertung der Automobilindustrie und hiermit verbundener Themen; |
|
49. |
bedauert, dass der Gebrauchtwagenmarkt im Aktionsplan nur in einem einzigen Absatz erwähnt wird, und weist auf die vielen Altfahrzeuge als Kennzeichen für die östlichen EU-Mitgliedstaaten hin. Der dortige alte Fahrzeugbestand ist bedingt durch die Tatsache, dass Gebrauchtwagen billiger sind, durch die gemessen am Einkommensdurchschnitt hohen Preise für Neuwagen sowie durch den Rückgang des Lebensstandards. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Daten laut ACEA — European Automobile Manufacturers' Association:
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_car_registrations_-8.7_in_january_2013 [21.2.2013].
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/60 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Das Paket der EU zu Sozialinvestitionen
2013/C 356/11
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
begrüßt den von der Kommission vorgeschlagenen strategischen Ansatz, um über das Sozialinvestitionspaket der Förderung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt zu stärken, um den individuellen Wohlstand zu fördern, die Wirtschaft anzukurbeln und die EU dabei zu unterstützen, gestärkt, solidarischer und wettbewerbsfähiger aus der aktuellen Krise hervorzugehen; |
|
— |
bedauert, dass die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Sozialinvestitionspaket der Kommission vernachlässigt wird, da sie die sozialen Probleme aus erster Hand kennen und einen entscheidenden Beitrag zur Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen zu deren Lösung leisten; |
|
— |
weist darauf hin, dass viele lokale und regionale Gebietskörperschaften bereits erfolgreiche Programme für die Bewältigung der im Sozialinvestitionspaket genannten Herausforderungen entwickeln und umsetzen. Daher sollte der Austausch bewährter Verfahren von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften untereinander gefördert werden; |
|
— |
fordert die EU auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu erwägen, einen europäischen Rahmen für den sozialen Wohnungsbau aufzustellen, da der soziale Wohnungsbau eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Obdachlosigkeitsproblematik sowie für die Umsetzung der von der Kommission geforderten Wohnungsbaumaßnahmen und präventiven Obdachlosigkeitsstrategien spielt; |
|
— |
weist daher darauf hin, dass der ESF dem realen Bedarf der Bürger stärker Rechnung tragen und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften mehr Flexibilität lassen sollte, Ziele auf der lokalen Ebene festzulegen; |
|
— |
fordert die Kommission ferner auf, einen konkreten Plan für die Umsetzung des Sozialinvestitionspakets vorzulegen. Dieser sollte Mechanismen für Monitoring, Koordinierung, zwischenstaatlichen Austausch und gegenseitiges Lernen in Bezug auf thematische Schwerpunkte wie etwa Jugendarbeitslosigkeit, Bildung, Obdachlosigkeit, Kinderarmut sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen und hilfsbedürftigen Personen enthalten. |
|
Berichterstatter |
Ahmed ABOUTALEB (NL/SPE), Bürgermeister von Rotterdam |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt — einschließlich Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014-2020 COM(2013) 83 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Hintergrund und Anlass für die Erarbeitung einer Stellungnahme
|
1. |
begrüßt den von der Kommission vorgeschlagenen strategischen Ansatz, um über das Sozialinvestitionspaket der Förderung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt zu stärken, um den individuellen Wohlstand zu fördern, die Wirtschaft anzukurbeln und die EU dabei zu unterstützen, gestärkt, solidarischer und wettbewerbsfähiger aus der aktuellen Krise hervorzugehen; |
|
2. |
verweist auf seine Stellungnahme zur aktiven Einbeziehung (2008/C 257/01), in der die Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als grundlegender Akteure für Maßnahmen für die aktive Einbeziehung hervorgehoben wurde; |
|
3. |
ist der Ansicht, dass nachhaltiges Wachstum, ausgeglichene Haushalte und der soziale Zusammenhalt nur erreicht werden können, wenn mehr getan wird, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und den Sozialschutz und die soziale Inklusion zu verbessern. Dies muss seinen Widerhall umfassend im Europäischen Semester finden, indem für die Aufnahme von insbesondere mit guten Arbeitsplätzen und dem Abbau von Ungleichgewichten verbundenen Zielen in die Überwachungs- und Koordinierungsmechanismen gesorgt und auf diese Weise Ausgewogenheit zwischen wirtschaftlichen und sozialen Zielen angestrebt wird und die Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt fortgesetzt werden, um das wirtschaftliche und soziale Gefälle zwischen den Regionen zu verringern; |
|
4. |
macht darauf aufmerksam, dass die Probleme in Bezug auf Armut und soziale Ausgrenzung in städtischen Gebieten, wo 80 % der europäischen Bevölkerung leben und 85 % des EU-BIP erzeugt werden, absolut betrachtet besonders groß sind, während ländliche Gebiete aufgrund einer geringeren Einkommenshöhe und einer geringeren Bevölkerungsdichte relativ gesehen große soziale Probleme haben. In städtischen Gebieten ballen sich diese sozialen Probleme in bestimmten Stadtvierteln und führen so, unabhängig vom Wohlstand einer Stadt, zur Schaffung sozialer Brennpunkte; |
Allgemeine Bemerkungen
|
5. |
unterstreicht, dass bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, wie in der EU-Charta der Grundrechte festgeschrieben, für alle Bürger ein gleichberechtigter Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sichergestellt werden muss, so etwa zu Wohnraum, Bildung, medizinischer Versorgung, Beschäftigung und Zugang zu sozialen Diensten. Eine wesentliche Voraussetzung ist hier Solidarität zwischen Bürgern aller Gesellschaftsschichten. Für die Verteilung dieser Grundversorgungsleistungen ist ein umfassender, sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht ausgerichteter Ansatz erforderlich, bei dem die Bürger im Mittelpunkt der Lösungsfindung stehen; |
|
6. |
fordert ein klares Bekenntnis aller EU-Institutionen zur Beteiligung der Bürger an allen Phasen der Politikgestaltung, von der Planung bis zur Umsetzung. Insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt ist es äußerst wichtig, dass wir das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen wiederherstellen, indem wir zeigen, dass auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürger eingegangen wird. Außerdem werden wir durch die Lösungssuche auf der lokalen Ebene und die Nutzung der Energie, der Handlungsbereitschaft und des Wissens der Bürger über den tatsächlichen lokalen Bedarf besser realistische und wirksame Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen finden können. Durch Investitionen in Gemeinschaften auf der (sub)lokalen Ebene wird ein stabiles Umfeld in den Stadtvierteln geschaffen, was sich positiv auf die Wahrnehmung der Sicherheit auswirkt; |
|
7. |
begrüßt, dass die Kommission anerkennt, dass die Beschäftigungs- und Sozialpolitik vornehmlich Aufgabe der Mitgliedstaaten und der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist, und somit das Subsidiaritätsprinzip achtet; |
|
8. |
schließt sich der Auffassung der Kommission an, dass bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit der Schwerpunkt insbesondere stärker auf Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Senkung der Arbeitslosigkeit, zur Förderung des lebenslangen Lernens, der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Chancengleichheit sowie auf weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikationen und Beschäftigungsmöglichkeiten gelegt werden muss. Zu diesen Maßnahmen zählen ferner die Ermöglichung der Mobilität von Arbeitnehmern und die Bereitstellung von Mikrokrediten für diejenigen, die ein Unternehmen gründen oder erweitern möchten; |
|
9. |
bedauert, dass die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Sozialinvestitionspaket der Kommission vernachlässigt wird. Ob als Wohnort, Arbeitsplatz, Stätten des Lernens oder bei der Betreuung von Menschen mit Behinderungen und hilfsbedürftigen Personen: die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften haben einen großen Einfluss auf das Leben der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger Europas. Auf der Ebene der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften werden die meisten sozialen Dienstleistungen erbracht und ein Großteil der Sozialleistungen gezahlt; |
|
10. |
vertritt die Auffassung, dass die vom Europäischen Parlament und von der Europäischen Kommission geforderte Umsetzung integrierter Strategien zur aktiven Inklusion von einem stärkeren Mitspracherecht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei Entscheidungen profitieren wird. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften verfügen über direkt vor Ort gesammeltes Wissen über soziale Probleme und sind wesentliche Akteure bei der Koordinierung und Umsetzung von Gegenmaßnahmen. Erfahrung mit der Bewältigung von sozialen Problemen ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Verwirklichung der Europa-2020-Ziele. Daher muss den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine wesentliche Rolle im Europäischen Semester sowie in den Verhandlungen über nationale Reformprogramme und bei deren Umsetzung zuerkannt werden; |
|
11. |
betont, dass sich Arbeit lohnen muss, was bedeutet, dass ein angemessener Mindestlohn und eine gute Qualität der Arbeitsplätze gewährleistet sein müssen. Wenn jemand (vorübergehend bzw. noch nicht) in der Lage ist, zu arbeiten, sollte für ein angemessenes Auskommen mit gleichberechtigtem Zugang zu grundlegenden präventiven, qualifizierenden und aktivierenden Diensten gesorgt werden. Der AdR fordert die Europäische Kommission daher auf, sich der Umsetzung der Empfehlung des Rates aus dem Jahr 1992 zum Mindesteinkommen anzunehmen; |
|
12. |
weist darauf hin, dass sich die lokalen Gebietskörperschaften die Energie jedes Einzelnen, der Zivilgesellschaft und aller Unternehmen, die in städtischen Gebieten leben bzw. tätig sind, zunutze machen müssen. Der Innovationsgeist sozialer Unternehmer, die neue Lösungen für die Nachfrage nach Leistungen und Infrastrukturen anbieten können, sollte gefördert werden. Die Regionen und Städte sollten sich um einen partizipativen Gestaltungsprozess bemühen, indem produktive Partnerschaften mit dem Privatsektor und zivilgesellschaftlichen Gruppen gebildet werden, während gleichzeitig eine echte und umfassende Bürgerbeteiligung an allen Phasen der sozialen Innovation (Ideen-, Planungs-, Pilot-, Entwicklungs- und Umsetzungsphase) gefördert wird; |
|
13. |
vertritt die Ansicht, dass auf der lokalen und regionalen Ebene die Beteiligung aller Aufenthaltsberechtigten bei Maßnahmen für die soziale Inklusion und Integration von entscheidender Bedeutung ist; macht darauf aufmerksam, dass durch den Zustrom von Einwanderern aufgrund EU-interner Mobilität Anpassungsprobleme entstehen für öffentliche Dienste und die Versorgung der Bürger mit Wohnraum, Arbeit und Bildungsmaßnahmen. Die grundlegenden Integrationsanforderungen für EU-Bürger unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von denjenigen für andere Einwanderer. Auch sie müssen mit einer neuen Sprache, neuen Institutionen und gelegentlich auch anderen gesellschaftlichen Normen zurechtkommen; |
|
14. |
bedauert, dass die Kommission den Initiativbericht des Europäischen Parlaments zu einem Pakt für soziale Investitionen (25.7.2012, 2012/2003 INI), in dem eine bessere Steuerung bezüglich der Umsetzung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 gefordert wurde, nur zum Teil aufgreift und keine zusätzlichen Mittel vorschlägt. Das Sozialinvestitionspaket sollte über an die Mitgliedstaaten gerichtete politische Empfehlungen und die Ankündigung einiger weniger Gesetzgebungsinitiativen hinausgehen. Gerade in Krisenzeiten sollte versucht werden, Beschäftigungs- und Sozialinvestitionsprogramme in den EU-Haushalt und die Haushalte der Mitgliedstaaten aufzunehmen; |
|
15. |
nimmt zur Kenntnis, dass das Sozialinvestitionspaket umfassende Informationen über soziale Tendenzen in Europa enthält. Die verwendeten Daten und Informationen stützen sich auf nationale oder regionale Tendenzen und Statistiken. Solchermaßen aggregierte Informationen geben ein nur unzureichendes Bild der Herausforderungen auf der lokalen Ebene bzw. der verschiedenartigen sozialen Bedürfnisse und der Deprivation zwischen der Ebene der Städte, Regionen oder Staaten wieder. Die Sammlung von Daten über funktionierende und auch nichtfunktionierende Lösungen auf der lokalen Ebene ist grundlegend wichtig, um sicherzustellen, dass die durchgeführten Maßnahmen geeignet sind, um die sozialpolitischen Ziele wirksam und effizient zu erreichen. Der AdR fordert die europäischen Institutionen auf, Daten und Informationen zu sozialen Tendenzen auf der lokalen und regionalen Ebene zu sammeln und die in regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und insbesondere in Großstädten durchgeführten Maßnahmen für die soziale Inklusion zu prüfen und zu evaluieren; |
|
16. |
verweist auf die anhaltenden Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, die bei Angehörigen von mehrfach benachteiligten Gruppen (z.B. Frau und Alleinerzieherin) noch verstärkt zu finden sind, und begrüßt, dass die Europäische Kommission sich dieser besonderen Herausforderung bewusst ist und ihr die entsprechende Aufmerksamkeit widmen will; |
|
17. |
hält die Mitteilung jedoch insofern für einen möglichen Wendepunkt, als die Sozialpolitik hierin als Investition in die Gesellschaft und nicht als Kosten für Marktversagen definiert wird. Durch eine solche Umschreibung der Sozialpolitik könnte ein Umdenken in der Politik weg von korrektiven Maßnahmen hin zu präventiven Maßnahmen angestoßen werden, wodurch Probleme wie soziale Ausgrenzung bereits im Ansatz angegangen werden können und Hilfsbedürftigkeit durch die Förderung der persönlichen Autonomie und aktives Altern hinausgezögert werden kann; |
|
18. |
begrüßt, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 27./28. Juni 2013 die Notwendigkeit erkannt hat, die soziale Dimension der WWU zu stärken. Die Herausforderung liegt hierbei darin, die EU mit den Instrumenten auszustatten, die sie braucht, um das Potenzial einer tatsächlichen wirtschaftlichen Konvergenz und sozialen Fortschritts für alle Mitgliedstaaten auf lange Sicht zu sichern, statt sich auf interne Abwertungsmechanismen zu verlassen, die einzig gegen asymmetrische Schocks vorgehen; sieht daher der für Anfang Oktober 2013 geplanten Mitteilung der Kommission zur sozialen Dimension der WWU mit Interesse entgehen; |
|
19. |
ist der Ansicht, dass die soziale Dimension der WWU, wie vom Europäischen Parlament vorgeschlagen (1), auf einem „Pakt für soziale Investitionen“ nach Vorbild des Euro-Plus-Paktes aufbauen könnte. Auf diese Weise würden Ziele für soziale Investitionen festgelegt, die die Mitgliedstaaten tätigen müssten, um die beschäftigungs-, sozial- und bildungspolitischen Ziele der Europa-2020-Strategie zu erreichen. Der Pakt für soziale Investitionen sollte ferner durch einen Anzeiger für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik ergänzt werden, der gemäß Artikel 148 AEUV eingeführt und unter die Verantwortung des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) gestellt wird, um beschäftigungs- und sozialpolitische Ungleichgewichte aufzuspüren, die die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden könnten; |
|
20. |
fordert die Europäische Kommission auf, die Machbarkeit eines Systems der Arbeitslosenversicherung der Europäischen Union näher zu untersuchen, das als Stabilisator auf Ebene der WWU eingesetzt werden könnte; |
|
21. |
begrüßt den Hinweis in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (2), dass „Möglichkeiten, die der bestehende haushaltspolitische Rahmen der Union bietet, um den Bedarf an produktiven öffentlichen Investitionen mit den Zielen der Haushaltsdisziplin in Einklang zu bringen“, im Rahmen der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes „in vollem Umfang“ genutzt werden sollten; geht daher davon aus, dass die Kommission das Thema der Qualität der öffentlichen Ausgaben weiterverfolgen wird, u.a. durch die Trennung von laufenden Ausgaben und Investitionen bei der Berechnung des Haushaltsdefizits, um zu vermeiden, dass Investitionen mit langfristigen Nettogewinnen auf der Sollseite verbucht werden; |
Empfehlungen
|
22. |
betont, dass die formelle und/oder informelle Bildung im Mittelpunkt des Sozialinvestitionspakets stehen sollte. Ungleichheit beim Zugang zu Bildung — insbesondere zu hochwertiger Bildung, die junge Menschen auf Beschäftigungsmöglichkeiten in einer inklusiven Informationsgesellschaft vorbereitet und sie mit den erforderlichen Fähigkeiten für ihr Engagement als aktive Bürgerinnen und Bürger in komplexen demokratischen Gesellschaften ausstattet — ist eine große Hürde für die Verringerung der Armut und die Stärkung des Wirtschaftswachstums. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Bereitschaft zeigen, in die Bildung, das lebenslange Lernen und die Ausbildung aller Altersgruppen zu investieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die frühkindliche Erziehung und den Zugang zur Hochschulbildung, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen, die innerbetriebliche Ausbildung und besondere Ausbildungen für Sektoren mit einem Arbeitskräftemangel (z.B. im Gesundheitsbereich und bei sauberen Technologien, IKT) sowie auf die Senkung der Schulabbrecherquote zu legen ist; |
|
23. |
begrüßt den Schwerpunkt, den die Kommission auf die allgemeine und berufliche Bildung legt, und vertritt die Auffassung, dass der beruflichen Bildung und ihrer Qualität größere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, und zwar mithilfe konkreter Maßnahmen sowohl in der Orientierungsphase als auch im Rahmen der allgemeinen und beruflichen Bildung. Die Wirtschaft der EU braucht mehr Handwerker, Ingenieure und Techniker, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Das Interesse an der beruflichen Bildung in der EU nimmt bedauerlicherweise immer weiter ab, obwohl sie großes Potenzial für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft bietet; |
|
24. |
unterstreicht, dass die kontinuierliche und lebenslange berufliche Bildung angemessen gewürdigt werden muss. Die Europäische Union sollte ausreichende langfristige Maßnahmen bereitstellen und über den Europäischen Sozialfonds (ESF) für eine angemessene finanzielle Ausstattung sorgen, um das Niveau der beruflichen Bildung zu verbessern; |
|
25. |
weist darauf hin, dass neben der energischen Fokussierung auf die Angebotsseite der Beschäftigungsfähigkeit auch die Nachfrageseite des Arbeitsmarkts stärker berücksichtigt werden muss. Unbestreitbar trifft die Arbeitslosigkeit vor allem gering qualifizierte Arbeitskräfte und für freie Arbeitsplätze ist ein sehr hohes Qualifikationsniveau erforderlich, daher müssen in dieser Phase der Krise nachfrageorientierte Maßnahmen angebotsorientierte Instrumente ergänzen, die über eine Deregulierung des Arbeitsmarkts hinausgehen, die Arbeitskosten senken und Arbeitslosen Anreize bieten, eine schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Geringqualifizierte und Arbeitslose sollten besser qualifiziert werden, indem ihnen die entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung gestellt werden; |
|
26. |
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, sich um eine bessere Antizipierung des künftigen Kompetenzbedarfs, eine Verringerung der Diskrepanz zwischen dem Qualifikationsangebot und dem Bedarf des Arbeitsmarkts und die Überbrückung der Kluft zwischen der Welt der Bildung und der Arbeitswelt zu bemühen. Insbesondere in den untersten Arbeitsmarktsegmenten muss die Erwerbsbeteiligung auf flexible und unbürokratische Art angeregt werden. In den Niederlanden haben z.B. die Regierung, Unternehmen und Bildungseinrichtungen den „Technologiepakt“ unterzeichnet, mit dem die Verbindung zwischen Bildung und Arbeitsmarkt im Technologiebereich gestärkt und dadurch dem Fachkräftemangel im technischen Bereich entgegengewirkt werden soll. Der Technologiepakt wurde zwar auf nationaler Ebene vereinbart, besteht aber zu einem großen Teil aus Maßnahmen, die über einen regionalen und sektoralen Ansatz durchgeführt werden, wobei auf bereits vorhandene Strukturen zurückgegriffen wird, z.B. die verschiedenen lokalen Wissenszentren „kenniswerkplaatsen“ für die Talentförderung, lebenswerte Städte und Gesundheit in Rotterdam; |
|
27. |
betont, dass das gesamte Arbeitskräftepotenzial bestmöglich genutzt werden muss. Für Menschen am Rand des Arbeitsmarkts können Fördermaßnahmen eingeführt werden, die in die Zuständigkeit der nationalen und/oder regionalen Behörden fallen; |
|
28. |
empfiehlt, die drei bestehenden Pfeiler des von der Kommission vorgeschlagenen Ansatzes — ausreichende Einkommenssicherung, aktive Eingliederung und Sozialdienstleistungen hoher Qualität — um die (soziale) Teilhabe zu ergänzen, um die aktive Einbeziehung der arbeitsmarktfernsten Personen zu verbessern. Soziale Teilhabe und Inklusion müssen die Schlüssel für das Erreichen unserer sozialpolitischen Ziele sowie für den Aufbau und den Erhalt unserer Wohlfahrtsstaaten sein. Den Bürgern sollte Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden, damit sie ihr volles Potenzial entfalten und ihre Fertigkeiten und Kompetenzen umfassend zum Einsatz bringen und weiterentwickeln können, wobei wirtschaftliche Eigenständigkeit das Ziel sein muss; |
|
29. |
erbittet eine nähere Erläuterung, was genau mit Konditionalität beim Zugang zu Sozialleistungen gemeint ist. Konditionalität kann akzeptabel sein, wenn soziale Transferleistungen vorgesehen sind, um den Einzelnen sowohl Unterstützung als auch Anreize für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bzw. eine Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahme zu bieten; |
|
30. |
begrüßt vor dem Hintergrund, dass Schätzungen zufolge ca. 56 Mio. Menschen in der EU im Alter über 15 Jahren kein Bankkonto haben, den Vorschlag der Kommission, allen Bürgern in der Europäischen Union das Recht auf ein Basiskonto zu geben; |
|
31. |
begrüßt die Absicht der Kommission, die Nutzung neuer Finanzierungsinstrumente und insbesondere der sozialen Rendite und von Social Impact Bonds zu prüfen, um die Hebelwirkung öffentlicher Sozialinvestitionen zu verstärken; fordert die Kommission auf, detailliertere Vorschläge zu diesem Thema vorzulegen und die Vergaberichtlinien der EU „sozialrenditesicher“ zu machen; unterstützt in diesem Zusammenhang die vorgeschlagene Einführung eines EU-Sparkontos, das der EU zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Beschäftigungs- und Wachstumsziele der Europa-2020-Strategie auf der lokalen und regionalen Ebene an die Hand geben könnte; |
|
32. |
unterstreicht, dass sich die Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen Gebietskörperschaften die Vielfalt ihrer Bürger zunutze machen sollten. Eine inklusive Kultur, in der man gefahrlos einzigartig sein und über diese Vielfalt mit anderen in Kontakt treten kann, ist eine Grundvoraussetzung für Innovation; |
|
33. |
weist darauf hin, dass viele lokale und regionale Gebietskörperschaften bereits erfolgreiche Programme für die Bewältigung der im Sozialinvestitionspaket genannten Herausforderungen entwickeln und umsetzen. Beispiele hierfür sind u.a. zentrale Anlaufstellen (Jugendbüros), regionale Jugend- und Familienzentren, Wohnungsbaumaßnahmen und präventive Obdachlosigkeitsstrategien, Strategien für soziale Rendite, Social Impact Bonds, talent houses, kinderfreundliche Nachbarschaften und umfassende Einbindung. Daher sollte der Austausch bewährter Verfahren von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften untereinander gefördert werden. Durch Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen lokalen Gebietskörperschaften können diese auf einen größeren Ressourcen- und Erfahrungsschatz zurückgreifen, und gleichzeitig wird die weitgehende Beteiligung ihrer Partner aus den unterschiedlichsten Bereichen an der Entwicklung gefördert. Diese Erfahrung sollte beim Aufbau der im Sozialinvestitionspaket angeregten Wissensbank sowie bei der Förderung eines solchen Austauschs im Rahmen des EU-Programms für sozialen Wandel und soziale Integration (PSCI) berücksichtigt werden; |
|
34. |
macht darauf aufmerksam, dass sowohl über den Europäischen Integrationsfonds (EIF) als auch über den ESF Integrationsprogramme finanziert werden. Zu oft jedoch wurde der Umfang der Dienstleistungserbringung durch die Finanzierungsquelle eingeschränkt. Es ist darauf hinzuweisen, dass im nächsten Haushaltsplanungszeitraum angesichts der immer weiter zunehmenden Mobilität in der EU Mittel für die Förderung mobiler EU-Bürger vorgesehen werden sollten, wobei Prioritäten aus beiden Fonds zusammengelegt und ein Finanzierungsprogramm für alle ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit geschaffen werden sollte. Diese neuen Mittel könnten für die Aufnahme von EU-Bürgern in Sprach- und Orientierungskurse genutzt werden, in enger Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie NGO und insbesondere dem Privatsektor. Die Kommission sollte ihren Einfluss geltend machen und einige lokale und regionale Gebietskörperschaften in den Entsendeländern auffordern, den ESF und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für umfassende Investitionen in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer Bevölkerung zu nutzen; |
|
35. |
ist sich bewusst, dass die Migration innerhalb von und zwischen Mitgliedstaaten für Einzelne einen Ausweg aus der Wirtschaftskrise darstellt; umfangreiche und langfristige Sozialinvestitionen in den Regionen und Gemeinden, die ihre jeweiligen regionalen und lokalen Besonderheiten am besten kennen, können jedoch eine nachhaltigere Reaktion auf die Krise sein, indem der Druck auf Einzelne verringert wird, ihre Heimat, Familie und ihre Umgebung wegen der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu verlassen. Außerdem können mangelnde Sprachkenntnisse die Migrationsmöglichkeiten in einen anderen Mitgliedstaat auf der Arbeitssuche oder zu Bildungszwecken usw. schmälern; u.U. muss der Fremdsprachenunterricht neuerlich gefördert werden, um kurzfristig Migration zu unterstützen, bis langfristigere Lösungen gefunden wurden. Zudem wird hierdurch auch die soziale Inklusion gefördert; |
|
36. |
unterstützt die Auffassung der Kommission bezüglich der lokalen Folgen des demografischen Wandels und der Bevölkerungsalterung, die neue Anforderungen an die soziale Infrastruktur und die Zugänglichkeit öffentlicher Bereiche stellen. Die zunehmende Altersarmut macht tragfähige Sozialsysteme und soziale Leistungen erforderlich, die für alle zugänglich und erschwinglich sein müssen. Das auf Unterstützung ausgerichtete Modell muss überwunden werden in dem Anliegen der Einführung eines präventiven Systems, mit dem die funktionelle Eigenständigkeit und relationale Integration der Bevölkerung länger erhalten werden kann. Besonders zu berücksichtigen ist hier die Förderung von Aktivität und Gesundheit der Europäerinnen und Europäer im Alter, wobei statt auf einen institutionellen Ansatz auf ein auf die Menschen ausgerichtetes, gemeindenahes Konzept gesetzt werden sollte; |
|
37. |
bedauert, dass in dem Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen „Long-Term Care in Ageing Societies“ (Langzeitpflege in alternden Gesellschaften) das Thema Armut, soziale Ausgrenzung und menschenwürdiges Einkommen für ältere Menschen nicht zur Sprache kommt, das jedoch wiederum zu einem größeren Bedarf an Langzeitpflege führen könnte. Ferner vermisst der AdR eine eingehende Analyse dazu, wie Investitionen in die Langzeitpflege über die Strukturfonds gefördert werden könnten; |
|
38. |
hält es für erforderlich, mit dem Sozialinvestitionspaket auch die Rolle der Sozialwirtschaft stärker anzuerkennen — dies vor dem Hintergrund, dass es in der EU 2 Mio. Sozialunternehmen gibt (d.h. 10 % aller europäischen Unternehmen) und dass diese Unternehmen 11 Mio. entgeltliche Mitarbeiter beschäftigen (was 6 % der Erwerbsbevölkerung der EU entspricht); wiederholt daher seine Forderung nach einem Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft, das im März 2013 auch vom Europäischen Parlament empfohlen wurde; |
|
39. |
unterstreicht die Bedeutung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheits- und dem Sozialbereich sowie zwischen formellen und informellen örtlichen Netzwerken. Die verschiedenen Arten von Nachbarschaftshilfe müssen näher erforscht werden, wie auch die ergänzende Rolle der Unterstützung durch Freiwillige, Fachkräfte und Nachbarn. Fachkräfte sollten sich stärker mit ihrem lokalen Umfeld identifizieren, in dem ihre kooperative und vermittelnde Rolle Nachbarschaftshilfe und Freiwilligentätigkeit stärken kann. Dieser neue Ansatz bei der Steuerung, der in einigen europäischen Städten erfolgreich eingesetzt wird, sollte durch Instrumente auf europäischer Ebene gefördert werden, um bewährte Verfahren in ganz Europa zu verbreiten. Als geeignete Methode erscheint die Einführung von Systemen, bei denen sowohl Informationen über die Bürger (sozialer und gesundheitlicher Werdegang) bereitgestellt als auch Informationen über verfügbare Ressourcen und Dienste (Katalog bzw. Palette an Dienstleistungen und Ressourcen, anwendbare Innovationstechnologien wie moderne Fernbetreuungssysteme, Fernüberwachung usw.) zugänglich gemacht werden; |
|
40. |
fordert die EU auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu erwägen, einen europäischen Rahmen für den sozialen Wohnungsbau aufzustellen, wie ihn der AdR in seiner Stellungnahme vom Oktober 2011 und das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 11. Juni 2013 gefordert haben. Zwar unterliegt der soziale Wohnungsbau nicht ausdrücklich der EU-Kompetenz, viele EU-Politiken (Wettbewerbspolitik, Binnenmarkt, Strukturfonds, Energieeffizienzpolitik, Umweltnormen usw.) haben jedoch unmittelbare Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau. Daher wird ein Rahmen für die Koordinierung benötigt, um die Einhaltung der Grundrechte und Kohärenz zwischen den EU-Politiken mit Einfluss auf den Wohnungsbau sicherzustellen. Der AdR erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die nationalen Behörden gemäß dem EU-Vertrag das Recht haben, über die Organisation des sozialen Wohnungsbaus und die Auswahlkriterien für Haushalte mit Anspruch auf eine Sozialwohnung frei zu entscheiden; ferner sieht der AdR im sozialen Wohnungsbau einen Schlüssel für den Zusammenhalt, weswegen dieser nicht nur benachteiligten Bevölkerungsgruppen vorbehalten werden sollte, um einen gesellschaftlichen Mix zu fördern; |
|
41. |
erinnert die Mitgliedstaaten und die Kommission daran, dass mit Investitionen in den sozialen Wohnungsbau als Grundlage für strategische soziale Investitionen einem drängenden sozialen Bedarf entsprochen werden kann. Ferner können so Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden, die nicht verlagert werden können, wodurch die Wirtschaft stabilisiert und so Immobilienblasen vermieden und der Klimawandel sowie Energiearmut bewältigt werden können. Ferner unterstreicht der AdR, dass der soziale Wohnungsbau eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Obdachlosigkeitsproblematik sowie für die Umsetzung der von der Kommission geforderten Wohnungsbaumaßnahmen und präventiven Obdachlosigkeitsstrategien spielt; |
|
42. |
begrüßt die Aufnahme der Obdachlosigkeit als thematischen Schwerpunkt in das Sozialinvestitionspaket sowie die Aufforderung an die Mitgliedstaaten, „die Obdachlosigkeit mittels umfassender Strategien zu bekämpfen, basierend auf Präventions- und Wohnungsbaumaßnahmen sowie der Überprüfung von Räumungsvorschriften und -praktiken, wobei die wichtigsten Ergebnisse der in diesem Paket enthaltenen Leitlinien für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit berücksichtigt werden sollten“. In diesem Zusammenhang fordert der AdR die Kommission auf, einen konkreten EU-Rahmen zur Unterstützung der Akteure und insbesondere der einschlägigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden für Fortschritte bei der Bewältigung der Obdachlosigkeitsproblematik zu schaffen und dabei die Initiativstellungnahme des Ausschusses der Regionen zu diesem Thema zu berücksichtigen; |
|
43. |
unterstreicht, dass für den Erfolg der sozialpolitischen Ziele eine Reform der Vorgehensweisen erforderlich ist, um die Qualität des Ergebnisses für die Begünstigten zu verbessern und Effizienz und Effektivität zu erreichen. Für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist soziale Innovation vonnöten und sollte in die Strukturfondsverordnungen aufgenommen werden, aber auch in HORIZONT 2020 eine prominente Rolle spielen und über das Programm für sozialen Wandel und Innovation wirksam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollten die Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie und insbesondere die Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung den Bezugsrahmen für eine wirksamere Erreichung der vorgesehen Ziele bilden; |
|
44. |
weist darauf hin, dass moderne Gesellschaften nicht nur für das Wirtschaftswachstum, sondern auch für soziales Wohlergehen und sozialen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie abhängen. Häufig jedoch ist die Interaktion zwischen Wissenschaft/Forschung und Gesellschaft/Bürgern unzureichend bzw. nicht gegeben. Bei der künftigen europäischen Forschungsfinanzierung muss daher darauf geachtet werden, dass nicht nur Ingenieurs-, sondern auch Sozial- und Geisteswissenschaften gefördert werden, um praktisch relevantes Wissen und Forschungsergebnisse über Probleme und die Lebensqualität in bestimmten Stadtvierteln und in dünn besiedelten Gebieten hervorzubringen und dieses Wissen unter den für die Stadt- und Raumplanungspolitik Verantwortlichen zu verbreiten. Insbesondere wird das neueste evaluative Forschungsdesign empfohlen, um systematisch Wissen über die Wirksamkeit politischer Interventionen aufzubauen, warum und für welche gesellschaftliche Gruppe bzw. unter welchen Voraussetzungen sie „funktionieren“; der AdR begrüßt die Initiativen der Kommission für die Förderung sozialer Innovation sowie ihre Bemühungen um den Austausch von Informationen über Erfahrungen mit Innovationen; |
|
45. |
macht darauf aufmerksam, dass die Regionalpolitik der EU die städtische Entwicklung seit 1989 fördert. Über ihre Strukturfonds investiert die Regionalpolitik in Projekte, die Good Governance auf der lokalen Ebene, eine nachhaltige städtische Umwelt, soziale Inklusion und Gleichberechtigung fördern, mit deren Hilfe städtische Gebiete saniert, das Wirtschaftswachstum angekurbelt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Angesichts der Bürgernähe der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Erfahrung bei der Ermittlung des lokalen Bedarfs und der Erwartungen sollte betont werden, dass die aktuelle Finanzierungsstruktur besser auf den Bedarf vor Ort abgestimmt werden sollte, damit die Städte und städtischen Gebiete mehr Verantwortung und eine führende Rolle bei der Koordinierung integrierter Ansätze auf der Ebene der Städte oder Metropolregionen übernehmen können. Um den territorialen Zusammenhalt und integrierte, gebietsorientierte Ansätze zu fördern, sollte die Koordinierung des ESF und des EFRE verbessert werden; |
|
46. |
begrüßt den Vorschlag, mindestens 20 % der ESF-Mittel in jedem Mitgliedstaat für die Förderung der sozialen Inklusion und die Armutsbekämpfung vorzusehen. Der AdR würde sich diesbezüglich noch weitere Zusagen wünschen, um sicherzustellen, dass die Mittel ordnungsgemäß verwaltet und auf die Unterstützung der Bedürftigsten ausgerichtet werden. Dies könnte bedeuten, dass die Mittel in den einzelnen Mitgliedstaaten auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren, die bestimmen, wo der Förderbedarf am größten ist (Armutsindikatoren, Pro-Kopf-BIP, Beschäftigung, Bildungsstand, Einwanderung usw.), vorgemerkt und nicht zentral, sondern regional verwaltet werden; |
|
47. |
fordert die unverzügliche Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für Jugendliche und betont das Erfordernis, die Programme der Jugendgarantie für junge Menschen im Alter bis zu 30 Jahren zu öffnen; begrüßt die Empfehlung der Kommission für eine Jugendgarantie, die ein frühzeitiges Tätigwerden zugunsten junger Menschen ermöglicht, die bei Bildung, Ausbildung oder Beschäftigung durch die Maschen zu fallen drohen; betont die wesentliche Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beim Umsetzungsprozess; bringt seine große Besorgnis über die unzureichende finanzielle Ausstattung der Beschäftigungsinitiative für Jugendliche für den gesamten kommenden Programmplanungszeitraum (6 Mrd. EUR) zum Ausdruck und fordert nachdrücklich, in den ersten Jahren des mehrjährigen Finanzrahmens einen erheblichen Teil der Mittel der neuen Haushaltslinie für die Beschäftigungsinitiative für Jugendliche vorzuziehen. Bei den NUTS-II-Förderkriterien sollten nicht nur das Kriterium einer Jugendarbeitslosigkeit von 25 %, sondern auch erhebliche regionale Abweichungen von der durchschnittlichen Jugendarbeitslosigkeitsquote auf nationaler Ebene berücksichtigt werden; |
|
48. |
weist daher darauf hin, dass der ESF dem realen Bedarf der Bürger stärker Rechnung tragen und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften mehr Flexibilität lassen sollte, Ziele auf der lokalen Ebene festzulegen. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten an der Festlegung der Prioritäten des ESF und an der Verwaltung der ESF-Mittel beteiligt werden. Mit Blick auf die Rechtsvorschriften sollte die Verordnung über den künftigen ESF bei der strategischen Steuerung des ESF eine größere Rolle für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften vorsehen. Ferner fordert der AdR die Einführung einer Verpflichtung für die ESF-Verwaltungsbehörden, den Nachweis zu erbringen, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der Gestaltung der Prioritäten der operationellen Programme und dem anschließenden strategischen Management des ESF beteiligt wurden; |
|
49. |
vertritt insbesondere unter Verweis auf seine früheren Stellungnahmen zur Stadtentwicklung der EU und sein Gipfeltreffen in Kopenhagen 2012 die Auffassung, dass es in Bezug auf die Programmplanung und Umsetzung verschiedene Optionen gibt, die eine praktische Beteiligung der Städte stärken würden: operationelle Programme mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Städten; Beteiligung von Städten als zwischengeschaltete Stellen und an den verschiedenen Gremien und Ausschüssen des ESF; sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden des ESF und den Städten bei der Gestaltung und Umsetzung der Programme. Für einige Großstädte könnten eigene operationelle Programme sinnvoll sein; |
|
50. |
fordert dazu auf, über den ESF innovative Dienstleistungsmodelle und über den neuen Rechtsrahmen die Entwicklung gemeindenaher Dienste zur Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zu fördern und zu finanzieren; |
|
51. |
stellt fest, dass der Haushalt für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) fünfmal so hoch ist wie die Mittelausstattung des ESF. Dies hat natürlich damit zu tun, dass die GAP schlichtweg eine gemeinsame EU-Politik ist, während die Finanzierung der Sozialpolitik weitgehend von den nationalen bzw. subnationalen Haushalten abhängt. Dieses Ungleichgewicht könnte von der Öffentlichkeit jedoch auch so ausgelegt werden, dass der Sozialpolitik der EU eine geringe Priorität beigemessen wird. Der AdR fordert daher, dass die neue Schwerpunktsetzung auf die Sozialpolitik der EU mit einer Aufstockung der ESF-Mittel einhergehen muss; |
|
52. |
begrüßt die von der Europäischen Kommission im Rahmen des neuen Programmplanungszeitraums für die Strukturfonds geplanten integrierten territorialen Investitionen für eine Konsolidierung der sozialen, wirtschaftlichen und physischen Entwicklung. Angesichts der zentralen Bedeutung der Städte für den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt muss die EU-Unterstützung deutlich über die vorgeschlagene Mindestquote von 5 % hinausgehen; |
|
53. |
weist darauf hin, dass die strengen EU-Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe und staatliche Beihilfen besser auf die Sozialpolitik abgestimmt werden sollten, so dass diese wirkungsvoller konzipiert und umgesetzt werden kann; fordert die Europäische Kommission im Sinne der konkreten Ausgestaltung dieser besseren Abstimmung auf, einen Vorschlag zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse auf der Grundlage von Artikel 14 AEUV vorzulegen; |
|
54. |
empfiehlt, das Dokument in enger Abstimmung mit den anderen Arbeitspapieren der Kommissionsdienststellen der Mitteilung umzusetzen, um so eine kohärente und wirksame Umsetzung sicherzustellen. Der AdR fordert die Kommission auf, hier ein ganzheitliches Konzept zu verfolgen und dabei lokale und regionale Gebietskörperschaften direkt einzubeziehen; |
|
55. |
fordert die Kommission ferner auf, einen konkreten Plan für die Umsetzung des Sozialinvestitionspakets vorzulegen. Dieser sollte Mechanismen für Monitoring, Koordinierung, zwischenstaatlichen Austausch und gegenseitiges Lernen in Bezug auf thematische Schwerpunkte wie etwa Jugendarbeitslosigkeit, Bildung, Obdachlosigkeit, Kinderarmut sowie Betreuung von Menschen mit Behinderungen und hilfsbedürftigen Personen enthalten. Im Rahmen des Europäischen Semesters sollten die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Erstellung der Jahreswachstumsberichte konsultiert und stärker am Monitoring beteiligt werden. Die Mitgliedstaaten sollten dazu angehalten werden, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften intensiver zu konsultieren, zu informieren und an der Beschlussfassung zu beteiligen, da viele soziale Investitionen in den Kernaufgabenbereich lokaler und regionaler Gebietskörperschaften fallen. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Entschließung vom 20. November 2012 zu einem Pakt für soziale Investitionen als Reaktion auf die Krise.
(2) Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 13./14. Dezember 2012, Kapitel I „Wirtschaftspolitik“, Punkt 2.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/68 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Aktionsplan Unternehmertum 2020
2013/C 356/12
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
erkennt die Bedeutung des Aktionsplans an, weist aber auch darauf hin, dass die Maßnahmen im Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung der Vorgaben des Plans von den Behörden auf supranationaler, nationaler und vor allem regionaler und lokaler Ebene koordiniert werden müssen; |
|
— |
weist nachdrücklich darauf hin, dass die Einbeziehung lokaler und regionaler Gebietskörperschaften und Interessenträger in die Umsetzung des Aktionsplans insofern von entscheidender Bedeutung ist, als die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Regierungsebene mit der größten Nähe zu den KMU und zu Einrichtungen der Unternehmensförderung sind und zudem die meisten KMU etablierte Akteure auf regionalen und lokalen Märkten sind; |
|
— |
betont, dass die Auszeichnung „Unternehmerregion Europas“ (EER), die der Ausschuss der Regionen seit 2010 verleiht, als Maßstab für die Entwicklung und Umsetzung einer unternehmerfreundlichen Politik sowie für eine maßgeschneiderte KMU-Förderung und zukunftsorientierte Strategien dienen kann; |
|
— |
hebt hervor, dass der selbständigen Beschäftigung und der Unternehmensentwicklung, die allgemein als realistische und begrüßenswerte Alternativen angesehen werden sollten, größere Bedeutung beizumessen ist; hebt hervor, dass das soziale Unternehmertum als nützliche Alternative zu traditionellen Unternehmensformen mit oder ohne Erwerbszweck weiter gefördert werden sollte; |
|
— |
hebt hervor, dass Europa jungen Menschen das Unternehmertum als tragfähigen und vielversprechenden Berufsweg näherbringen und damit den Unternehmergeist beleben sollte; unterstreicht, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Aufgabe zukommt, Bildung zu fördern und dabei unternehmerische Aspekte einzubringen. |
|
Berichterstatter |
Pawel ADAMOWICZ (PL/EVP), Bürgermeister von Danzig/Gdańsk |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Aktionsplan Unternehmertum 2020: Den Unternehmergeist in Europa neu entfachen COM(2012) 795 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
begrüßt den Aktionsplan Unternehmertum 2020 der Europäischen Kommission, mit dem eine Kultur des Unternehmertums in Europa gefördert, bessere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen, hochwertige Dienste zur Unternehmensförderung bereitgestellt, Rollenmodelle entwickelt und spezifische Gruppen angesprochen werden sollen; |
|
2. |
spricht erneut seine umfassende Unterstützung für Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums und zur Beseitigung von Hindernissen für die Entwicklung von KMU aus und würdigt damit deren entscheidende Bedeutung für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union; |
|
3. |
betont, dass sich alle Behörden auf allen Ebenen um eine Rationalisierung ihrer Genehmigungs- und Kontrollverfahren sowie anderer behördlicher Maßnahmen bemühen sollten. Sie sollten einen vereinfachten Informationsaustausch, eine vereinheitlichte Terminologie und Betriebsablaufsysteme anstreben, über die automatisch Informationen aus anderen Systemen und Datenbanken abgerufen werden können; |
|
4. |
weist darauf hin, wie wichtig eine rasche Umsetzung der bereits gefassten Beschlüsse ist. Weitere theoretische Diskussionen würden nicht zur Entwicklung des Unternehmensumfeldes beitragen; |
|
5. |
betont, dass die jüngste Wirtschaftskrise für die kleinen und mittleren Unternehmer in Europa, insbesondere in abgelegenen Regionen mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden war und einen deutlichen Anstieg der Konkursfälle nach sich zog; |
|
6. |
erkennt an, dass ein angemessenes Unternehmensumfeld und ein intakter Binnenmarkt für den wirtschaftlichen Wiederaufschwung und das Wachstum Europas sowie für einen stärkeren sozialen Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung sind; |
|
7. |
unterstreicht, dass das regionale und lokale Unternehmensumfeld ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor ist. Es müssen daher Innovationskapazitäten aufgebaut und eine Mentalität gefördert werden, welche die offene Innovation begünstigen, zu deren Grundlagen die effektive Nutzung des von den verschiedenen Akteuren generierten Wissens, ein motivierender Dialog, gemeinsames Arbeiten und gemeinsames Schaffen von etwas Neuem gehören; |
|
8. |
sieht den Aktionsplan als notwendigen Schritt für die Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds innerhalb des Binnenmarktes an, der zur wirtschaftlichen Erholung in der ganzen EU beitragen kann; |
|
9. |
unterstützt die gewählten Prioritäten des Aktionsplans, die sich in drei Aktionsschwerpunkten niederschlagen (Ausbau der unternehmerischen Bildung, Schaffung des erforderlichen Unternehmensumfelds sowie Rollenvorbilder und Ansprechen einzelner Zielgruppen), und begrüßt die erwarteten Ergebnisse dieses Aktionsplans; |
|
10. |
hebt hervor, dass der selbständigen Beschäftigung und der Unternehmensentwicklung, die allgemein als realistische und begrüßenswerte Alternativen angesehen werden sollten, größere Bedeutung beizumessen ist. Sie sind unabdingbar für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, weshalb in diesen Fragen eine umfassende Unterstützung der verschiedenen Ebenen erforderlich ist; dies erfordert Maßnahmen auf allen Regierungsebenen zum spürbaren Abbau bürokratischer Hindernisse für selbständige Beschäftigte, für deren bessere soziale Absicherung und höhere Rentenansprüche sowie zum Abbau der Steuerlast; |
|
11. |
erkennt an, dass Frauen in der Unternehmerschaft mit einem Anteil von nur 30 % unterrepräsentiert sind und sich geschlechtsspezifische Fortbildung und Förderung beträchtlich auf die Erhöhung der Zahl der Unternehmerinnen auswirken, und fordert die Schaffung eigener Zentren für Unternehmerinnen; |
|
12. |
erneuert die Forderung an die Kommission, die er in seinen jüngsten Stellungnahmen zur Industriepolitik (1) und zu den staatlichen Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (2) bereits formuliert hat, nämlich sich mit dem Problem der Schwelleneffekte im Zusammenhang mit der Definition der Unternehmenskategorien zu befassen und die Definition des Begriffs KMU zu überprüfen. Konkret sollte die Kommission, „ihre Analysekapazitäten sowie das Instrumentarium für die Unterstützung der Unternehmen […] verfeinern. Dabei sollte sie die Möglichkeit prüfen, ebenso wie in der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie zwischen KMU und Großunternehmen eine neue Kategorie mittelgroßer Unternehmen mit 250 bis 750 Beschäftigten und weniger als 200 Mio. EUR Umsatz einzuführen. Der Ausschuss der Regionen fordert ferner, dass eine Berücksichtigung von Unternehmen mittlerer Größe erwogen wird, die aus wachsenden KMU hervorgegangen sind, 250 bis 5 000 Beschäftigte umfassen und den künftigen Reichtum Europas bilden. Diese neuen Kategorien von Unternehmen könnten einen entsprechend angepassten Fördersatz erhalten, der über dem der Großunternehmen und unter dem der KMU liegt“; |
|
13. |
unterstreicht, dass das Handwerk, das einen Teil der KMU ausmacht, als Grundlage der industriellen Entwicklung für das Wachstum der europäischen Wirtschaft eine wichtige Rolle gespielt hat und noch spielt und dass dessen spezifische Bedürfnisse insbesondere im Hinblick auf den Aufbau und die Förderung von Berufsbildungszentren stärker berücksichtigt werden sollten; |
|
14. |
betont ferner die besondere Bedeutung der Unternehmen, die sich im Bereich der Sozial- und Solidarwirtschaft herausbilden. Diese Unternehmen tragen zur Wirtschaftstätigkeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in benachteiligten Gebieten bei und nehmen Gemeinwohlaufgaben wahr, die eine differenzierte Behandlung rechtfertigen, insbesondere was die Regelung für die Beihilfeintensität betrifft; |
|
15. |
weist nachdrücklich darauf hin, dass sich der fortschreitende Rückgang der Industrie auf die Beschäftigung und den Wohlstand in Europa auswirken kann, weswegen die EU Strukturreformen anstoßen sollte, um insbesondere im Hinblick auf ihr industrielles Potenzial ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken; |
|
16. |
stimmt der Ansicht zu, dass die Rolle der Unternehmer in der Gesellschaft mehr Anerkennung verdient und deutlich gestärkt werden sollte; |
|
17. |
begrüßt den offenen und integrativen Ansatz des Aktionsplans, der eine weitgefasste Gruppe von Interessenträgern in den Blick nimmt und auf eine breite Palette bereits etablierter KMU, Jungunternehmer und potenzieller Unternehmer abzielt; |
|
18. |
bekennt sich zur Förderung des Unternehmergeists in Europa und zur vollständigen Umsetzung des Aktionsplans Unternehmertum 2020 und des Small Business Act für Europa auf lokaler und regionaler Ebene; |
|
19. |
zeigt sich enttäuscht darüber, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Aktionsplan nicht die ihnen gebührende Bedeutung beigemessen wird, obwohl ihnen bei der Umsetzung sämtlicher Ziele der drei Aktionsschwerpunkte des Aktionsplans eine unverzichtbar bedeutende Rolle zuerkannt wird; |
|
20. |
unterstreicht die große Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den zentralen Bereichen des Aktionsplans Unternehmertum 2020, nämlich allgemeine und berufliche Bildung, Bereitstellung transparenter Verwaltungspraktiken, Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds und Förderung des Unternehmertums; |
|
21. |
hebt hervor, dass zahlreiche wichtige Maßnahmen und Initiativen in Bereichen, die der Aktionsplan umfasst, bereits durch lokale und regionale Gebietskörperschaften in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wurden; |
|
22. |
ist enttäuscht, dass die Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften für die Umsetzung des Aktionsplans nicht ausreichend berücksichtigt wird und die regionale Dimension lediglich als Teil des horizontalen Netzwerks zur Unternehmensförderung Erwähnung findet; |
|
23. |
weist nachdrücklich darauf hin, dass die Einbeziehung lokaler und regionaler Gebietskörperschaften und Interessenträger in die Umsetzung des Aktionsplans insofern von entscheidender Bedeutung ist, als die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Regierungsebene mit der größten Nähe zu den KMU und zu Einrichtungen der Unternehmensförderung sind und zudem die meisten KMU etablierte Akteure auf regionalen und lokalen Märkten sind; |
|
24. |
hebt hervor, welche zentrale Rolle den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dabei zukommt, für die institutionelle und politische Dynamik zu sorgen, die Synergien und Kooperationen zwischen regional verankerten Akteuren befördert, etwa Handels- und Handwerkskammern, Berufsverbänden, Technologiezentren, Technologieparks, Gründerzentren, Universitäten, Clusterinitiativen u.a. — sie sind geeignete Partner, die KMU, Jungunternehmer, junge Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und andere bei ihren Vorhaben unterstützen können; |
|
25. |
betont, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Verantwortung für die Konzipierung regionaler Unternehmensstrategien tragen, die im Rahmen der nächsten Finanziellen Vorausschau, insbesondere durch die Strukturfonds, besser denn je unterstützt werden können; |
|
26. |
unterstreicht, dass für die Bereitstellung öffentlicher Waren und Dienstleistungen, Informationen, Fachkenntnisse und finanzieller Mittel für innovative KMU und neugegründete Unternehmen einschließlich Management-Entwicklung und Schulungen insbesondere in den Bereichen Finanzplanung, Strategie und Marketing für progressive Unternehmer ein stärkeres Engagement und mehr Unterstützung der öffentlichen Hand erforderlich sind; |
|
27. |
hält es für notwendig, eine Verbesserung des Ansatzes und der Verfahren vieler Banken zur Beurteilung des unternehmerischen Risikos sowie zur Finanzierung von Unternehmensgründungen und KMU herbeizuführen; bei fortgesetzter öffentlicher Unterstützung für Banken sollten diese Kriterien im Vordergrund stehen; |
|
28. |
betont, dass die Auszeichnung „Unternehmerregion Europas“ (EER), die der Ausschuss der Regionen seit 2010 verleiht, als Maßstab für die Entwicklung und Umsetzung einer unternehmerfreundlichen Politik sowie für eine maßgeschneiderte KMU-Förderung und zukunftsorientierte Strategien dienen kann. Mit der Auszeichnung „Unternehmerregion Europas“ kann auch die Entwicklung lokaler und regionaler SBA-Partnerschaften gefördert und damit ein Beitrag zur Umsetzung der Ziele des Aktionsplans und des Programms für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU (COSME) geleistet werden; |
|
29. |
würdigt die bedeutende Rolle der KMU als der wichtigsten Akteure für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in Europa (85 % der neuen Arbeitsplätze in der EU zwischen 2002 und 2010 wurden von KMU geschaffen) und hebt hervor, wie schwierig es für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist, die KMU zu erreichen, für die vielen verschiedenen Typen von KMU — v.a. Kleinstunternehmen — eine passende Unterstützung zu finden und optimale Fördermaßnahmen zur Verfügung zu stellen; |
|
30. |
erkennt an, dass der EU trotz der großen Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Beseitigung von Hindernissen für das Unternehmertum eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Verbesserung des Unternehmensumfeldes zukommt; |
|
31. |
erkennt die Bedeutung des Aktionsplans an, weist aber auch darauf hin, dass die Maßnahmen im Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung der Vorgaben des Plans von den Behörden auf supranationaler, nationaler und vor allem regionaler und lokaler Ebene koordiniert werden müssen; |
|
32. |
berücksichtigt die horizontale, bereichsübergreifende Natur der Projekte zur Förderung des Unternehmertums und unterstreicht zugleich die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Generaldirektionen der Europäischen Kommission; |
|
33. |
fordert die Europäische Kommission in Anbetracht der oben erwähnten Aspekte dazu auf sicherzustellen, dass sich die verschiedenen EU-Finanzierungsprogramme für Unternehmen, insbesondere COSME, die Strukturfonds und das Programm Horizont 2020 weitestgehend ergänzen und somit Synergien optimal genutzt und ineffiziente Überschneidungen vermieden werden; |
|
34. |
betont, das sich eine mögliche Doppelarbeit als ineffizient und ineffektiv erweisen könnte, und ruft daher dazu auf, die auf verschiedenen Regierungsebenen durchgeführten politischen Maßnahmen zu vereinheitlichen und zu koordinieren; |
|
35. |
fordert unter Berücksichtigung der Bedeutung des Problems ausführlichere Informationen über die spezifischen Finanzmittel, die zur Durchführung der verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen zugewiesen werden; |
|
36. |
bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass in der Mitteilung dem jeweils spezifischen Charakter der Unternehmenskultur und Ökosysteme in den europäischen Regionen nicht Rechnung getragen wird, und weist darauf hin, dass große Unterschiede insbesondere zwischen den alten und den neuen Mitgliedstaaten, zwischen städtischen und nicht-städtischen Gebieten sowie zwischen zentralen Regionen und Regionen in Randlage bestehen; |
|
37. |
ruft die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dazu auf, mehr Engagement bei der Förderung der Unternehmensdynamik zu zeigen und durch innovative Unternehmen in ihren Regionen nachhaltiges Wachstum voranzubringen; |
|
38. |
unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen zur praktischen Umsetzung unternehmerischen Entdeckens, wobei dies eine der Grundlagen für die Nutzung der Strukturfonds und der intelligenten Spezialisierung ist; |
|
39. |
fordert die regionale und lokale Ebene auf, ihre operativen Programme im Hinblick darauf vorausschauend zu entwickeln, dass diese passende Maßnahmen zur Unterstützung der Zielvorgaben des Aktionsplans enthalten, sowie dafür zu sorgen, dass Diversität und Gleichstellung der Geschlechter ihren Niederschlag in den Strukturfondspartnerschaften finden; |
|
40. |
betont, dass sich anhand der Auszeichnung „Unternehmerregion Europas“ (EER) des Ausschusses der Regionen gut zeigen lässt, dass Regionen in der Lage sind, vorausschauende Strategien unter besonderer Berücksichtigung des Unternehmertums und einer maßgeschneiderten Unterstützung für KMU zu entwickeln und somit bessere Lösungen für gemeinsame und regionsspezifische Probleme zu finden; |
|
41. |
hebt hervor, das alle mit dem Preis ausgezeichneten Regionen (2011-2013) zur Gestaltung ihrer regionalen Wirtschaftspolitik interessante neue Maßnahmen ins Leben gerufen oder bereits vorhandene ausgedehnt haben; |
|
42. |
fordert eine Entwicklung des EER-Netzwerkes unter Nutzung des wegweisenden COSME-Programms (2014-2020) der Europäischen Kommission als einem passenden Rahmen; |
|
43. |
ruft zur Umsetzung der in COSME (Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU) skizzierten Ziele auf: Erleichterung des Zugang zu Finanzmitteln für KMU, Schaffung eines unternehmerfreundlichen und wachstumsfördernden Umfelds, Förderung einer Kultur des Unternehmertums in Europa, Stärkung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen, Unterstützung der Auslandstätigkeit kleiner Unternehmen und Verbesserung ihres Marktzugangs; |
|
44. |
begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, die Verwaltung des COSME-Programms gegenüber den vorangehenden Programmen wie etwa CIP (2007-2013) zu vereinfachen, um die Verwaltungsausgaben zu reduzieren und den Schwerpunkt statt dessen auf die Bereitstellung besserer Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen zu legen; |
|
45. |
fordert, den Ausschuss der Regionen zu den künftigen Sitzungen des COSME-Verwaltungsausschusses einzuladen; |
|
46. |
hebt hervor, dass der Schwerpunkt des Aktionsplans auf dem allgemeinen politischen Rahmen liegen sollte, und ist enttäuscht, dass die Europäische Kommission das Problem des Unternehmertums hauptsächlich als ein quantitatives Problem ansieht (Anhebung der Zahl an Unternehmen); |
|
47. |
unterstreicht die Wichtigkeit von Maßnahmen, die für mehr Unternehmensneugründungen aus dem Umkreis der Universitäten oder anderer Bildungseinrichtungen sorgen. Das zentrale Instrument ist dabei die Entwicklung von Modellen auf der Grundlage von Vorbildern, sodass diese EU-weit nachgeahmt werden können; |
|
48. |
hebt hervor, dass innovative und wettbewerbsfähige Unternehmen für das Wirtschaftswachstum von zentraler Bedeutung sind; darüber hinaus sollten besonders weitergehende Bestrebungen nach Expansion auf den Weltmarkt und nach globaler Wettbewerbsfähigkeit angespornt werden. Die Förderung des Ausbaus effizienter Unternehmen ist unumgänglich, wenn es darum geht, dass Regionen mit Entwicklungsrückstand aufschließen oder ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit wahren sollen; |
|
49. |
ist besorgt darüber, dass aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren die Leiter zahlreicher Familienunternehmen das Rentenalter erreichen werden, oft ohne einen Nachfolger zu finden, was die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze gefährden kann; |
|
50. |
ist der Auffassung, dass zur Förderung der Internationalisierung von Unternehmen die Fremdsprachenkenntnisse sowohl von Unternehmern als auch von Studierenden und Schülern verbessert werden müssen; darüber hinaus muss das Wissen um die Möglichkeiten des gemeinsamen Marktes der EU sowie über das globale Marktumfeld gefördert werden; |
|
51. |
erinnert daran, dass auch die Übernahme des Meister-Lehrling-Lernmodells in Unternehmen durch EU-Finanzmittel unterstützt werden sollte. Der Wissenstransfer zwischen den Generationen schafft erheblichen Mehrwert, denn ältere Arbeitnehmer können Denkweisen und Know-how weitergeben, während die Jungen Ideen und Begeisterung einbringen. Das Meister-Lehrling-Modell funktioniert also in beide Richtungen (3); |
|
52. |
weist nachdrücklich darauf hin, dass die Unternehmensförderung auf lokaler und regionaler Ebene dahingehend ausgeweitet werden sollte, dass KMU das Potenzial des Binnenmarktes in vollem Umfang nutzen können; betont in diesem Zusammenhang, dass das Enterprise Europe Network seine Arbeit fortsetzen sollte; |
|
53. |
unterstreicht, dass andere regionale Akteure, wie etwa Einrichtungen der Unternehmensförderung, Universitäten, Technologietransferzentren, Cluster usw., ihre Tätigkeit im Rahmen der Regionalentwicklung im Hinblick auf eine bestmögliche Zusammenarbeit überprüfen sollten, damit die regionalen Unternehmen professionelle und umfassende Unterstützung zur Erschließung neuer Märkte erhalten; |
|
54. |
stimmt zu, dass die Regionen der EU unabhängig von einer engen Zusammenarbeit und Partnerschaften in der Lage sein müssen, ihr Wachstumspotenzial selbst zu bestimmen und Innovationen sowohl in Branchen mit hohem als auch in Branchen mit niedrigem Technologieniveau zu fördern und damit zum Beispiel Strategien für intelligente Spezialisierung entsprechend den spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Region zu entwickeln; |
|
55. |
ist sich darüber im Klaren, dass Schlüsseltechnologien (neue Materialien, Nanotechnologie, Mikro- und Nanoelektronik, Biotechnologie und Fotonik) in einigen europäischen Regionen zentrale Bedeutung für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zukommen könnte. Diese Branchen tragen unter anderen zum Übergang zu einer emissionsarmen und wissensbasierten Wirtschaft bei. Unternehmer, die sich mit Technologien dieser Art befassen, könnten einen bedeutenden Beitrag zur Lösung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme und zur Modernisierung der Industrie in der EU leisten; |
|
56. |
betont, dass neben dem traditionellen Unternehmertum auch Maßnahmen beschleunigt werden sollten, die wesentliche Anreize für das akademische Unternehmertum von Doktoranden und Promovierten in allen Mitgliedstaaten bieten; |
|
57. |
hebt hervor, dass die EU in den Bereichen des Aktionsplans unterstützende Zuständigkeit hat und dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung tragen muss; betont, dass der Aktionsplan eine freiwillige Regelung für die regionalen und lokalen Behörden vorsieht; |
|
58. |
erkennt an, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen gezielt auf Mängel der Politik und Marktversagen wie etwa Informationsungleichgewichte ausgerichtet sind, die nur auf EU-Ebene behoben werden können, und dass diese Maßnahmen daher den Bestimmungen des Vertrages von Lissabon entsprechen; |
|
59. |
bestätigt, dass der Aktionsplan dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt. Umfang und Reichweite der geplanten Maßnahmen sollen durch Gruppenfinanzierung und Multiplikatorwirkung spezifische Versäumnisse des Markes positiv beeinflussen; |
Förderung des Unternehmertums in Aus- und Weiterbildung
|
60. |
hebt hervor, dass Europa jungen Menschen das Unternehmertum als tragfähigen und vielversprechenden Berufsweg näherbringen und damit den Unternehmergeist beleben sollte; |
|
61. |
unterstreicht, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Aufgabe zukommt, Bildung zu fördern und dabei unternehmerische Aspekte einzubringen; |
|
62. |
weist darauf hin, dass die Möglichkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zur Förderung des Unternehmertums anerkannt werden sollten; |
|
63. |
fordert die Ausbildungsorganisationen und Bildungssysteme der lokalen und regionalen Ebene dazu auf, mehr auf spezifische Zielgruppen zugeschnittene formale und nicht-formale Lernmöglichkeiten für unternehmerische Bildung und Unternehmensentwicklung zur Verfügung zu stellen; |
|
64. |
hebt die Bedeutung des Europäischen Rahmens für Schlüsselkompetenzen hervor, innerhalb dessen unternehmerische Bildung neben Mathematik, Problemlösungsstrategien, Kommunikation, Fremdsprachenkenntnissen und anderen Kompetenzen als sehr wichtig eingestuft wird; |
|
65. |
ruft die Kommission auf, unternehmerische Bildung in allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen zu fördern, wobei der Erwerb praktischer Fähigkeiten und das informelle Lernen der Unternehmer und Schüler bzw. Studierenden voneinander ein zentrales Anliegen sein sollte; |
|
66. |
fordert die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf, unternehmerische Aus- und Weiterbildungsprogramme einzuführen bzw. deren Qualität zu verbessern; |
|
67. |
unterstreicht die Bedeutung von Programmen zur Sensibilisierung für unternehmerische Werte und Fähigkeiten von der Grundschule an, mit denen das innovative Potenzial der jungen Generation und ihre Freude am Experimentieren gefördert werden; |
|
68. |
ist der Ansicht, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften in der Lage sind, Bildungsprogramme zu initiieren, die den Unternehmergeist in regionaltypischen Wirtschaftsbereichen anregen und so zur Entwicklung des entsprechenden Wirtschaftszweiges und der gesamten Region beitragen; |
|
69. |
hebt die Bedeutung des Dialogs zwischen Jungunternehmern und potenziellen Unternehmern hervor, wie er durch das Erasmusprogramm „Junge Unternehmer“ gefördert wird; |
|
70. |
weist darauf hin, dass einige der mit dem EER-Preis ausgezeichneten Regionen dieses Programm ausgiebig genutzt haben und die entsprechenden Ergebnisse für ihre Unternehmer sehr vielversprechend waren. Das Programm bietet künftigen Unternehmern Schulungen in KMU an und ermöglicht zugleich erfahrenen Unternehmern, von jungen, motivierten (künftigen) Unternehmern zu profitieren, die alltägliche Probleme (in Produktion oder bestehenden Verfahren) mit unvoreingenommenem Blick betrachten. Unternehmen, die sich an dieser Art von Austausch beteiligen, verfügen daher über ein großes Potenzial zur Verbesserung ihrer Innovationskapazitäten; |
|
71. |
hebt hervor, dass das soziale Unternehmertum als nützliche Alternative zu traditionellen Unternehmensformen mit oder ohne Erwerbszweck weiter gefördert werden sollte. Soziales Unternehmertum kann sich durchaus lohnen, insbesondere da angesichts der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen nötig ist; |
Schaffung eines Umfelds, in dem Jungunternehmen wachsen und gedeihen können
|
72. |
sieht es als notwendig an, Unternehmen und künftigen Unternehmern die Chancen des Binnenmarktes stärker bewusst zu machen; |
|
73. |
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, die noch immer vorhandenen Hindernisse für Unternehmen, wie sie im zweiten Aktionsschwerpunkt des Aktionsplan genannt werden, zu beseitigen; ist ferner der Ansicht, dass Unternehmer und selbständige Erwerbstätige in den Systemen der sozialen Sicherheit nicht benachteiligt werden sollten; |
|
74. |
weist darauf hin, dass die Gebietskörperschaften zur Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für das Wachstum von Unternehmen in hochwertige Infrastruktur, im Verkehrswesen wie im digitalen Bereich, investieren müssen und dazu die Unterstützung der Europäischen Union benötigen; |
|
75. |
ist sich darüber im Klaren, dass in den kommenden Jahren mehrere hunderttausend ältere Unternehmer in der EU ihre Betriebe entweder der nächsten Generation übergeben oder schließen müssen; hält es daher für nötig, Strategien für die Unternehmensnachfolge umzusetzen und das Problem stärker ins Bewusstsein zu rücken; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine bereits in der Stellungnahme zu staatlichen Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (4) formulierte Forderung, Beihilfen für die Betriebswiederaufnahme nach den SBRZ-Leitlinien förderfähig zu machen; |
|
76. |
stimmt der Auffassung zu, dass Insolvenzverfahren vereinfacht werden sollten, damit Unternehmer eine zweite Chance haben; |
Förderung von Rollenvorbildern und Unternehmertum in bestimmten Zielgruppen
|
77. |
hält es für wesentlich, die Bürokratie im Zusammenhang mit der Gründung, dem Ausbau oder der Niederlassung von Unternehmen kontinuierlich abzubauen; |
|
78. |
unterstützt die Idee, das Unternehmertum in bestimmten Zielgruppen zu fördern und dabei deren spezifische Probleme zu berücksichtigen; |
|
79. |
unterstreicht die große Bedeutung älterer Unternehmer für die Wirtschaft der EU und betont, dass deren Bedeutung angesichts des demografischen Wandels voraussichtlich noch zunehmen wird; |
|
80. |
würdigt die Tatsache, dass im Rahmen des Aktionsplan ältere Unternehmer als wertvolle unternehmerische Ressource in der EU in den Blick genommen und damit potenzielle Synergien mit sozialpolitischen Maßnahmen ermöglicht werden, die der Förderung wirtschaftlicher Tätigkeiten in der Generation 50+ zugutekommen; |
|
81. |
hebt hervor, dass ältere Arbeitnehmer aufgrund ihrer langen Berufserfahrung eine wertvolle Wissensquelle darstellen und einer neuen Generation von Unternehmern bei der Gründung oder Konsolidierung ihrer Unternehmen eine wichtige Hilfe sein können; |
|
82. |
stimmt zu, dass Einrichtungen der Unternehmensförderung auf lokaler und regionaler Ebene Erwerbsmodelle erarbeiten müssen, die älteren Arbeitnehmern auf freiwilliger Basis den Verbleib im Erwerbsleben ermöglichen. Zugleich soll damit die Beschäftigungsfähigkeit sowohl von Studenten als auch von Jungunternehmern durch Mentorprogramme verbessert werden; |
|
83. |
empfiehlt diesbezüglich, die Haltung des „aktiven Älterwerdens“ in der Gesellschaft zu fördern. Aktives Älterwerden nutzt nicht nur den direkt Betroffenen, sondern kann auch Wachstum und Innovation zugutekommen. Auf lokaler und regionaler Ebene könnten die Entscheidungsträger die Chancen der sogenannten Seniorenwirtschaft eingehender untersuchen und fördern. Hiermit muss eine veränderte Haltung und der Wandel zu einer neuen Politik für ältere Menschen einhergehen; |
|
84. |
weist darauf hin, dass in einigen europäischen Regionen bereits bestimmte Gruppen im Hinblick auf die Förderung ihres unternehmerischen Potenzials in den Blick genommen wurden, und ruft dazu auf, die entsprechenden Erfahrungen zu nutzen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Principi-Attivi-Programm der Region Apulien; |
Förderung des Innovationspotenzials durch Unternehmergeist
|
85. |
stimmt der Ansicht zu, dass die grüne Wirtschaft ein beträchtliches Innovationspotenzial birgt, das von den europäischen KMU effizienter genutzt werden könnte; |
|
86. |
weist auf die große Bedeutung hin, die Gründerzentren, Clusterinitiativen und Clustern sowohl dabei zukommt, den Transfer von wissenschaftlichem Know-how zur Realwirtschaft zu erleichtern und praxisorientiertes Wissen zu verbreiten als auch dabei, die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Interessenvertretung der Regionen zu stärken; plädiert für die Kommerzialisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse; |
|
87. |
hebt hervor, dass in zahlreichen EER-Regionen vielversprechende Beispiele von Clusterinitiativen und Gründerzentren für Jungunternehmer existieren, die zu neuen Produkten und Dienstleistungen mit Wachstumspotenzial geführt haben. Als Beispiele hierfür ließen sich anführen: Eco World Styria (Steiermark EER-Region 2013), der Golm Science Park in Brandenburg (EER-Region 2011) und der Science Park mit Gründerzentrum in der Region Murcia (EER-Region 2011); |
|
88. |
begrüßt die Stärkung des Enterprise Europe Network und die Aufstockung der Mittel für das spezifische Ziel „Verbesserung des Marktzugangs“, das ebenfalls durch das Netzwerk unterstützt wird; |
|
89. |
ruft alle einschlägigen regionalen Akteure dazu auf, an diesem Netzwerk mitzuwirken, damit alle verschiedenen Typen von KMU erreicht werden und engere Kontakte geknüpft werden können. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Stellungnahme des AdR vom 11. April 2013, CDR2255-2012_00_00_TRA_AC, Ziffer 18.
(2) Stellungnahme des AdR vom 31. Januar 2013, CDR2232-2012_00_00_TRA_AC, Ziffer 45.
(3) CdR 14/2012 fin, ECOS-V-025, Ziffer 64.
(4) Stellungnahme des AdR vom 31. Januar 2013, CDR2232-2012_00_00_TRA_AC, Ziffer 49.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/75 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Grünbuch — Langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft
2013/C 356/13
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
befürwortet die zeitgerechte Initiative der Kommission „Grünbuch — Langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft“ und begrüßt, dass mit Blick auf die künftige Entwicklung der EU eine breit angelegte Debatte in Form einer Befragung angestoßen wird, in der geklärt werden soll, wie das Angebot an langfristigen Finanzierungen verbessert und das System zur Finanzierung langfristiger Investitionen in Europa gestärkt und diversifiziert werden kann; |
|
— |
teilt die Auffassung der Kommission, dass es der europäische Finanzsektor seit der Finanzkrise weniger gut schafft, Sparkapital in langfristige Investitionen zu leiten; vor allem haben die Finanzkrise und die derzeit schwache gesamtwirtschaftliche Lage ein Klima der Unsicherheit und der Risikoscheu geschaffen, das insbesondere Mitgliedstaaten, die unter finanziellem Druck stehen, zu spüren bekommen; |
|
— |
zeigt sich besorgt darüber, dass die Besonderheiten der lokalen und regionalen Ebene bei Angeboten für langfristige Finanzierungen und den für langfristige Investitionen charakteristischen Maßnahmen nicht genügend berücksichtigt werden; |
|
— |
bedauert, dass die EU den Wettbewerb und den Spielraum der Regierungen in bestimmten Investitionsbereichen eingeschränkt hat, die gerade für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften von besonderer Bedeutung sind. Die Koordinierungsprozesse und Genehmigungsverfahren sind zu langwierig und kompliziert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Weltmarkt beeinträchtigt wird und andere Regionen in der Welt für Investoren an Attraktivität gewinnen. |
|
Berichterstatter |
Uno SILBERG (EE/EA), Mitglied des Gemeinderats von Kose |
|
Referenzdokument |
Initiative der Europäischen Kommission: „Grünbuch — Langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft“ COM(2013) 150 final |
I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Intelligentes und integratives Wachstum
|
1. |
befürwortet die zeitgerechte Initiative der Kommission „Grünbuch — Langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft“ und begrüßt, dass mit Blick auf die künftige Entwicklung der EU eine breit angelegte Debatte in Form einer Befragung angestoßen wird, in der geklärt werden soll, wie das Angebot an langfristigen Finanzierungen verbessert und das System zur Finanzierung langfristiger Investitionen in Europa gestärkt und diversifiziert werden kann; |
|
2. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass es der europäische Finanzsektor seit der Finanzkrise weniger gut schafft, Sparkapital in langfristige Investitionen zu leiten; vor allem haben die Finanzkrise und die derzeit schwache gesamtwirtschaftliche Lage ein Klima der Unsicherheit und der Risikoscheu geschaffen, das insbesondere Mitgliedstaaten, die unter finanziellem Druck stehen, zu spüren bekommen; |
|
3. |
unterstützt den Standpunkt der Kommission, dass Europa vor der dringenden Aufgabe steht, die EU auf den Weg intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums zurückzuführen. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen werden, dass die lokalen und regionalen Besonderheiten und die Probleme der KMU stärker berücksichtigt werden; |
|
4. |
betont, dass vor allem die auf dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beruhende allseitige und weitreichende Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, Mitgliedstaaten, Städten und Regionen, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie den Interessengruppen ausschlaggebend ist, um die Wirtschaftskrise zu überwinden, sich neuen Herausforderungen zu stellen und gemeinsame Ziele festzulegen und zu verwirklichen; |
|
5. |
ist der Ansicht, dass die Wirtschaft durch eine Erhöhung der durchschnittlichen Wertschöpfung der Unternehmen der produktiven Wirtschaft, die beschäftigungsintensiven Wirtschaftszweigen angehören, einen möglicherweise wirkungsvollen Wachstumsimpuls erhalten könnte. Ihre Förderung durch Innovationen und einen vereinfachten Kapitalzugang könnte sich wesentlich auf die gesamte Wirtschaft auswirken; |
|
6. |
weist darauf hin, dass die wissensbasierten Vermögenswerte der weltweit größten Unternehmen (die im Aktienindex S&P 500 notierten Börsenunternehmen) heute bereits 80 % der Unternehmenswerte ausmachen. Wachstumsmotoren sind in erster Linie in den Wirtschaftsbereichen mit dem weltweit größten Wachstumspotenzial zu finden: Grüne Wirtschaft, Landwirtschaft (u.a. effizientere Nutzung der örtlichen biologischen Ressourcen und Bio-Wirtschaft), Seniorenwirtschaft, Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Nutzung von IT-Lösungen sowie Einsatz der Kreativwirtschaft in bestimmten Wirtschafts- und Lebensbereichen. In den USA beispielsweise könnte in den nächsten 10 Jahren ein großer Teil (fast 60%) der neuen Arbeitsplätze im Zusammenhang mit solchen Produkten bzw. Dienstleistungen entstehen, die es heute noch gar nicht gibt. Mit Hilfe von IT-Lösungen könnte sich der wirtschaftliche Nutzen der Verwertung oder Wiederverwertung von Informationen des öffentlichen Sektors auf bis zu 140 Mrd. EUR pro Jahr belaufen, um die das BIP aufgestockt würde (1); |
|
7. |
erinnert an die früheren, themenverwandten Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen: Synergien zwischen privaten Investitionen und öffentlicher Finanzierung auf lokaler und regionaler Ebene (2). Mobilisierung privater und öffentlicher Investitionen zur Förderung der Konjunktur und eines langfristigen Strukturwandels: Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften (3). Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (2014-2020) (4). Die Schaffung größerer Synergien zwischen den Haushalten der EU, der einzelnen Mitgliedstaaten und der Gebietskörperschaften (5). Die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Förderung des Wachstums und der verstärkten Schaffung von Arbeitsplätzen (6); |
II. STANDPUNKTE DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN
Angebot langfristiger Finanzierungen und Merkmale langfristiger Investitionen
|
8. |
stimmt der Analyse der Europäischen Kommission zu, in der Wesentliches herausgestellt wird: Die Anleger haben keine Rechtssicherheit und sind bei ihren Investitionen sehr vorsichtig. Sie bevorzugen kurzfristige und liquidere Anlageformen, vor allem Investitionen in private Investitionsobjekte. Der Blick der Finanzinstitute ist häufig auf Schwellenländer gerichtet, die sich rasch entwickeln und ein geringes Lohnniveau aufweisen; |
|
9. |
ist gleichzeitig besorgt darüber, dass sich der internationale Wettbewerb um Auslandskapital rasch verschärft, da die verschuldeten Staaten dringend neue Kapitalquellen brauchen, um wachstumsfördernde Investitionen tätigen und die bislang aufgehäuften Schulden bedienen zu können. Die Aufmerksamkeit sollte sich nicht oder nicht nur auf das Darlehen richten, sondern auch auf andere Kapitalquellen; |
|
10. |
macht darauf aufmerksam, dass Städte und Regionen auf den Finanzmärkten unterschiedliche Funktionen erfüllen. Sie tätigen selber bedeutende langfristige Investitionen und agieren auch mehr oder weniger direkt als Investoren, etwa über städtische Unternehmen oder aus wirtschaftspolitischen Gründen. Daneben sind Städte und Regionen auf den Finanzmärkten aber auch selber Anlageobjekte; |
|
11. |
macht darauf aufmerksam, dass sich der öffentliche Sektor auf den Finanzmärkten in einem grundsätzlich anderen Handlungsumfeld bewegt und andere Ziele verfolgt als privatwirtschaftliche Akteure. So sind zum Beispiel die Renditeerwartungen an die Investitionen, der Anlagehorizont und die Risikotoleranz öffentlicher und privater Investoren sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund muss die Kommission beim öffentlichen Sektor genau hinschauen, wenn von langfristiger Finanzierung die Rede ist; |
|
12. |
zeigt sich besorgt darüber, dass die Besonderheiten der lokalen und regionalen Ebene bei Angeboten für langfristige Finanzierungen und den für langfristige Investitionen charakteristischen Maßnahmen nicht genügend berücksichtigt werden; |
|
13. |
bedauert, dass die EU den Wettbewerb und den Spielraum der Regierungen in bestimmten Investitionsbereichen eingeschränkt hat, die gerade für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften von besonderer Bedeutung sind. Die Koordinierungsprozesse und Genehmigungsverfahren sind zu langwierig und kompliziert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Weltmarkt beeinträchtigt wird und andere Regionen in der Welt für Investoren an Attraktivität gewinnen; |
|
14. |
fordert, dass Städten und Regionen auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten Möglichkeiten für und Unterstützung bei solchen langfristigen Investitionen gegeben wird, die die Beschäftigungslage verbessern, vom technologischen Standpunkt aus innovativ sind und das grüne Wachstum fördern sowie zur Entwicklung besserer Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen beitragen; |
Förderung einer langfristigen Finanzierung der Europäischen Wirtschaft — Fähigkeit der Finanzinstitute zur Kanalisierung langfristiger Projektfinanzierungen — Geschäftsbanken
|
15. |
erinnert an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 2012 (7), in denen betont wird, dass „die Möglichkeiten, die der bestehende haushaltspolitische Rahmen der EU bietet, um den Bedarf an produktiven öffentlichen Investitionen mit den Zielen der Haushaltsdisziplin in Einklang zu bringen, im Rahmen der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts in vollem Umfang genutzt werden können.“ Vor diesem Hintergrund plädiert der Ausschuss erneut für eine Reform des Stabilitätspakts, um bei der Berechnung der Haushaltsdefizite zwischen „laufenden Ausgaben“ und „Investitionen“ zu unterscheiden und so zu vermeiden, dass öffentliche Investitionen mit langfristigen Nettogewinnen erschwert werden; |
|
16. |
bekundet seine Zufriedenheit darüber, dass die Banken ihre Fähigkeit, Finanzmittel in langfristige Finanzierungen zu lenken, allmählich zurückgewinnen, doch für Investitionen vor Ort werden die Mittel bislang nur unter reichlich unangemessenen Bedingungen bereitgestellt; |
Nationale und multilaterale Entwicklungsbanken und finanzielle Anreize
|
17. |
hält es für wichtig, dass die nationalen und multilateralen Entwicklungsbanken a) strategisch wichtige Investitionen insbesondere im Bereich der Infrastrukturen und der Energieversorgung unterstützen und b) eine antizyklische Finanzpolitik betreiben, d.h. in Zeiten des Wirtschaftswachstums die Finanzmittel zurückhalten und die Investitionen vor allem in der Wirtschaftskrise deutlich erhöhen; |
|
18. |
teilt zwar die Auffassung, dass auf EU-Ebene eine überzogene Konsolidierung der Banken verhindert werden sollte, auf der anderen Seite wäre aber ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit zu empfehlen, um freie Finanzmittel für Investitionen auf lokaler und regionaler Ebene zu bündeln; |
|
19. |
spricht sich bei Investitionen zugunsten des nachhaltigen Wirtschaftswachstums für eine Verknüpfung von Kontrollen mit längeren Laufzeiten aus und fordert, dass vorläufige Investitionspläne weitergeführt werden. Projektanleihen würden auf lange Sicht auch die Nachhaltigkeit auf lokaler und regionaler Ebene gewährleisten; |
|
20. |
vertritt die Ansicht, dass die langfristigen Investitionen auf lokaler und regionaler Ebene auch dadurch unterstützt werden könnten, dass zusätzlich zu den politischen Instrumenten und Rahmenvorgaben die Bürokratie abgebaut, die Online-Kommunikation ausgebaut und der Beschlussfassungsprozess wesentlich beschleunigt wird; |
Institutionelle Anleger
|
21. |
teilt die Ansicht, dass die institutionellen Anleger bei der langfristigen Finanzierung eine wesentliche Rolle spielen und dass die Solvabilität II-Richtlinie eingehalten werden muss. Die Rolle dieser Investoren nimmt sicherlich in dem Maße zu, wie die investierten Summen ansteigen. Dabei muss gewährleistet sein, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in die Wirtschaft der EU, nicht aber in der Wirtschaft Asiens oder anderer Teile der Welt investiert werden; |
Kumulierte Effekte der Regulierungsreform auf Finanzinstitute
|
22. |
hebt hervor, dass es im Zuge jetziger und zukünftiger Reformierungen der aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu langfristigen kumulierten Effekten kommen wird. Das Regulierungssystem muss an dieser Stelle besonders gründlich durchdacht werden und im Laufe der Jahre müssen die möglichen Auswirkungen — auch auf lokaler und regionaler Ebene — genau verfolgt werden; |
Effizienz und Wirksamkeit der Finanzmärkte bei der Bereitstellung langfristiger Finanzierungsinstrumente
|
23. |
merkt an, dass die Kapitalmarktfinanzierung langfristiger Investitionen in Europa durch eine Stärkung des EU-Kapitalbinnenmarktes und der Infrastruktur zur Unterstützung der Finanzinstitute der lokalen und regionalen Ebene sowie durch die Gewährleistung eines effektiven Investorenschutzes verbessert werden kann und dass die Pensionsfonds einbezogen werden sollten, die in die lokale und regionale Entwicklung investieren; |
|
24. |
ist der Auffassung, dass Anlageprodukte oder -pakete potenzieller Investitionen (darunter Straßenbau und Infrastrukturen) weiterentwickelt werden müssen, um als direkte Anlageobjekte für Pensionsfonds dienen zu können; |
|
25. |
hält die Erhöhung der Arbeitsproduktivität für dringend erforderlich. Sie muss sich kontinuierlich an ein sich ständig wandelndes wirtschaftliches Umfeld anpassen. In einem solchen Umfeld kann es förderlich sein, wenn Arbeitnehmer zugleich auch als Anteilseigner bzw. Investoren fungieren können und wollen, deren Interesse darauf ausgerichtet ist, dass langfristig in die Unternehmen, in denen sie beschäftigt sind, investiert wird. Für lokale Investitionen, insbesondere in den Bereichen Energie und Umwelt, müssen Anlageinstrumente geschaffen werden, die es Akteuren der lokalen und regionalen Ebene ermöglichen, nicht nur Verbraucher, sondern auch Finanzakteure zu sein; |
|
26. |
betont, dass es für den Wandel und die lokale Entwicklung ggf. förderlich sein kann, wenn Arbeitnehmer zugleich auch Anteilseigner und Investoren sind, sofern sie das möchten und die Möglichkeit einer Beteiligung im Rahmen der gegebenen Marktstruktur überhaupt besteht. Eine Änderung der Rechnungslegungsvorschriften und mehr Transparenz können sich dabei möglicherweise positiv auf den Beteiligungswillen der Arbeitnehmer auswirken; |
|
27. |
ist der Überzeugung, dass es erforderlich ist, Mikrounternehmen und KMU verstärkt einzubeziehen, die Transparenz auf den Handelsplätzen zu verbessern und Investoren zu beteiligen. Der Anteil des Marktes für Anleihen außerhalb des Finanzsektors sollte erhöht werden, und der Zugang zum Markt für KMU-Anleihen sollte erleichtert werden; |
|
28. |
betont, dass der Verbriefungsmarkt der EU belebt werden kann, wenn kontrolliert wird, wie die Finanzinstitute das Kapital einsetzen, und wenn durch die Anwendung einheitlicher, transparenter Bewertungsmethoden sichergestellt wird, dass nur Kapital berücksichtigt werden kann, das entsprechend besichert ist. Die Anwendung der Maßnahmen dürfte freies Kapital generieren, das in Investitionen fließen könnte, und gleichzeitig muss der liquide Projektanleihemarkt für KMU gewährleistet werden; |
Querschnittsfaktoren, die langfristiges Sparen und langfristige Finanzierungen ermöglichen
|
29. |
vertritt die Auffassung, dass die Schaffung verschiedener Modelle für spezielle Sparkonten innerhalb der EU und die möglichen Vorzüge dieser Modelle mit der Frage zusammenhängen, wie die Verzinsung der Ersparnisse garantiert werden kann; |
|
30. |
befürchtet, dass ein verbindliches oder teilweise verbindliches europäisches Sparkonto in etlichen Mitgliedstaaten auf eine schroffe Ablehnung stoßen könnte und bei Freiwilligkeit kaum mit einem großen Publikumsinteresse zu rechnen wäre. Bei der Wahl eines Modells für ein spezielles EU-Sparkonto sollten unbedingt solche bevorzugt werden, die am besten geeignet sind, das angeschlagene Vertrauen wiederherzustellen und mitzuhelfen, die Beschäftigungs- und Wachstumsziele der Europa-2020-Strategie auf lokaler und regionaler Ebene zu verwirklichen; |
Besteuerung
|
31. |
hält es für wünschenswert, ein koordiniertes europäischen Vorgehen ins Auge zu fassen, um bei Kapitalinvestitionen niedrigere Steuersätze anzusetzen; |
|
32. |
vertritt die Auffassung, dass im Sinne der richtigen Anreize für langfristiges Sparen über die Anwendung solcher steuerlichen Vorteile auf nationaler Ebene nachgedacht werden muss, die zu schnellen Reinvestitionen der Gewinne, langfristigen Investitionen und zu Kapitalinvestitionen in Mikrounternehmen und KMU anregen; hierbei wäre es von Vorteil, zwischen Kapitaleinkünften und Einkünften aus anderen Quellen zu differenzieren. Außerdem könnte über eine Abstufung der Steuersätze und eine Steuerbefreiung für langfristige Sparguthaben nachgedacht werden; |
|
33. |
schlägt vor, bei der Bewertung des Nutzens von Erleichterungen bei der Körperschaftsteuer für Unternehmen von den bisher gesammelten positiven oder negativen Erfahrungen auszugehen. So bleibt beispielsweise in einigen Mitgliedstaaten bis dato der gesamte Gewinn unversteuert, ganz gleich, ob er nun reinvestiert wird oder nicht, während lediglich einige seiner Verwendungsweisen, durch die Geld aus dem Unternehmen abfließt, besteuert werden, also etwa Dividenden, besondere Begünstigungen oder natürliche Sachleistungen (natural benefits) usw. Im Endergebnis beläuft sich der effektive Steuersatz auf schätzungsweise 4-5 %. Durch ein solches System werden lokale Investitionen nicht gefördert; |
|
34. |
verweist darauf, dass in mehreren Umfragen zu Investitionsentscheidungen das Steuersystem erst an vierter bis sechster Stelle genannt wird. Demnach gibt es andere, wichtigere Faktoren wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Arbeitskräften vor Ort und deren geeignete Ausbildung, das Vorhandensein von Energie, Wasser etc. und günstige Grundkosten für Unternehmen oder auch andere Faktoren, die direkt oder indirekt die Unternehmenstätigkeit beeinträchtigen könnten, wie Korruption u.ä.; |
|
35. |
empfiehlt, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, den reinvestierten Teil des Gewinns und der Zinseinkünfte aus Investitionen nicht zu besteuern und Steuerbefreiungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Umweltvorhaben vorzusehen; |
|
36. |
unterstützt außerdem eine engere Koordinierung mit dem Ziel der Vereinfachung des Körperschaftssteuersystems, der Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage und der Senkung der Steuersätze. Staatliche Einmischungen in die Wirtschaft und das Leben der Menschen sind zu begrenzen, während die Eigenverantwortung der Unternehmen und der Bürger für ihre wirtschaftliche Lage entsprechend erhöht werden muss, wobei gleichzeitig verschiedene kollektiven Initiativen gefördert werden; |
Rechnungslegungsgrundsätze
|
37. |
stellt fest, dass die Grundsätze der Rechnungslegung zum beizulegenden Zeitwert nicht in allen Mitgliedstaaten angewendet werden. Sie werden von Unternehmen genutzt, die innerhalb der EU gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind. Bisher haben die Grundsätze der Rechnungslegung zum beizulegen Zeitwert keine Änderung des Anlegerverhaltens bewirkt; |
|
38. |
hält es für wichtig, die Stabilität der auf einer marktgestützten Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beruhenden Rechnungslegungsgrundsätze bei langfristigen Finanzierungszeiträumen zu gewährleisten und alternative Maßnahmen vorzusehen, um mit Blick auf den Marktwert der Vermögenswerte und ihrer Quellen das Auslaufen langfristiger Finanzierungen risikofrei zu gestalten; |
Corporate-Governance-Vereinbarungen
|
39. |
glaubt, dass Aktionäre zu einem längerfristigen Engagement bewogen werden können, wenn Steuervorteile für Dividenden gewährt werden. Gleiches gilt, wenn ein größerer Teil der Dividendenerträge an Aktionäre, die die Dividendenerträge langfristig investieren, ausgeschüttet würde. Außerdem sollte es Steuervorteile für langfristige Investitionen in die lokale und regionale Entwicklung geben; |
|
40. |
vertritt die Auffassung, dass dort, wo Anreize für Vermögensverwalter sich zu einem kontraproduktiven Faktor entwickeln, sicherlich die Transparenz der Rechnungslegung verbessert werden muss, um das Vertrauen zwischen Öffentlichkeit, Unternehmenseignern, Unternehmensleitung und Mitarbeitern zu gewährleisten; |
Information und Berichterstattung
|
41. |
vertritt die Auffassung, dass bei einer stärkeren Integration von finanziellen und nichtfinanziellen Informationen, die dazu beitragen, dass die Unternehmen einen klareren Überblick über ihre langfristige wirtschaftliche Lage gewinnen, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können, es in Anbetracht des derzeitigen Lebenstempos und der Möglichkeiten des digitalen Zeitalters dennoch nicht richtig wäre, auf die vierteljährliche Berichterstattung zu verzichten. Außerdem ermöglicht sie die Bewertung einer veränderten Situation, bevor sich Probleme auftürmen oder sich die Behebung der Folgen als wesentlich kostspieliger herausstellen würde; |
|
42. |
regt an, Umfang und Reichweite der vierteljährlichen Indikatoren unter Berücksichtigung sämtlicher Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu berücksichtigen. Zugleich ist es wichtig, dass Daten nicht tendenziös, sondern auf objektive und vertrauenswürdige Weise sowie mit verständlichen Zusammenfassungen in den Fachmedien veröffentlicht werden, wobei erforderlichenfalls Sachverständige hinzugezogen werden sollten oder eine Kurzanalyse beizufügen ist; |
|
43. |
vertritt die Auffassung, dass die Wirtschaftswissenschaft und die Statistik bereits genügend langfristige Vergleichsindikatoren bereithalten, was die Anwendung, die Kontrolle und die Analyse bereits bestehender Indikatoren zu einem aufwändigen Unterfangen macht. Der Einsatz neuer Indikatoren erscheint mithin nicht besonders zweckmäßig. Dies könnte sich freilich ändern, wenn ein Indikator bzw. ein Median von Vergleichsindikatoren mit besonders hohem Informationswert gefunden würde; |
Erleichterung des Zugangs zu Bankkrediten und Nichtbankenfinanzierungen für KMU
|
44. |
teilt die Sicht, wonach die KMU einen schlechteren Zugang zu Finanzierungen haben als Großunternehmen, wobei erschwerend hinzukommt, dass die Tätigkeit der KMU in etlichen Mitgliedstaaten durch eine in mancherlei Hinsicht diskriminierende Gesetzgebung erschwert wird; |
|
45. |
schlägt vor, über die Möglichkeiten einer öffentlichen Börse oder den Aufbau eines internetbasierten Anleihemarkts nachzudenken, auf dem jedermann frei und ohne die Vermittlung eines Maklers in die örtliche oder regionale Entwicklung investieren kann; |
|
46. |
empfiehlt den KMU, als ergänzende Darlehensgeber Kreditgenossenschaften, Bausparkassen und ähnliche kleine Finanzinstitutionen zu nutzen, deren Marktanteil in den meisten Staaten Osteuropas leider sehr klein ist und deren Entwicklung auch von staatlicher Seite oft nicht gefördert wird. Beispielsweise gibt es in einigen Mitgliedstaaten zwar eine Einlagensicherung für Bankguthaben, von der die Kreditgenossenschaften jedoch ausgenommen sind; |
|
47. |
schlägt vor, dass Gebietskörperschaften, wirtschaftliche Interessenvertretungen, Gremien zur Verwaltung des öffentlichen Vermögens und Finanzmarktorganisationen lokale und regionale Genossenschaften gründen, die alternative Finanzierungsmöglichkeiten für langfristige Finanzierungen auf lokaler und regionaler Ebene bieten; |
|
48. |
regt an, die für ein effizientes Funktionieren der Kreditgenossenschaften erforderlichen und sachdienlichen gesetzlichen Änderungen zu untersuchen und entsprechende Vorschläge zu machen; |
|
49. |
ist der Auffassung, dass ein derartiges Netz kleiner Finanzinstitute die Lösung für viele lokale und regionale Probleme sein könnte und dass gesichert werden müsste, dass die KMU einen garantierten Prozentanteil des Risikokapitals erhalten. Zugleich sollte erwogen werden, Unterstützungen der Kreditvergabe in größerem Umfang zu nutzen; |
|
50. |
unterstreicht, dass die Entwicklung eines EU-Regelungsrahmens für alternative Nichtbankenfinanzierungsquellen für KMU unter bestimmten Bedingungen sicherlich der lokalen und regionalen Entwicklung nutzen würde, da der jetzige Rechtsrahmen die KMU eher einschränkt als begünstigt. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Europäische Kommission, Informationen des öffentlichen Sektors — Rohdaten über neue Dienstleistungen und Produkte (http://bit.ly/wa4AR).
(2) CdR 272/2013.
(3) CdR 21/2010.
(4) CdR 98/2012.
(5) CdR 1778/2012.
(6) CdR 1186/2012.
(7) Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 13./14. Dezember 2012, Kapitel I „Wirtschaftspolitik“, Ziffer 2.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/80 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete
2013/C 356/14
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
bestätigt, dass die Regionen mit vorwiegend ländlichen Gebieten ihren Rückstand zwar aufholen, dass ihr Entwicklungsniveau aber weiterhin hinter dem Gemeinschaftsdurchschnitt zurückbleibt; |
|
— |
bedauert, dass im Vergleich zur Finanziellen Vorausschau 2007-2013 die Mittelzuweisung für die Entwicklung des ländlichen Raums deutlich gesunken ist; |
|
— |
weist darauf hin, dass derzeit Überlegungen darüber angestellt werden, die Mittel der zweiten Säule der GAP stärker als bisher zu verwenden; bedauert, dass dies eine weitere Senkung der Mittelzuweisungen zur Verbesserung der technischen und sozialen Infrastruktur auf dem Land nach sich ziehen würde; |
|
— |
Die Festlegung der Mindestquote von 5 % der ELER-Mittel für das LEADER-Programm reicht zur Belebung der ländlichen Wirtschaft nicht aus; |
|
— |
hält eine breit angelegte, direkte Zusammenarbeit zwischen den ländlichen Gemeinden eines funktionellen Gebiets, insbesondere bei der Erarbeitung einer Verhandlungsstrategie gegenüber Städten, die sich in diesem Gebiet befinden, für angebracht; |
|
— |
erkennt an, dass die Entwicklungsstrategien für diese Gebiete Mehrjahresrahmen feststecken sollten, die mindestens einen Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren umfassen; |
|
— |
fordert im Hinblick auf eine effizientere Nutzung der Mittel zur Bekämpfung der gesellschaftlichen Ausgrenzung eine systematische und vollständige kartografische Erfassung der Armutsenklaven in ländlichen Gebieten (mindestens auf NUTS-3-Ebene); |
|
— |
ist der Auffassung, dass die künftige EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums folgende Charakteristika aufweisen sollte:
|
|
Berichterstatter |
Jerzy ZAJĄKAŁA (PL/EA), Bürgermeister von Łubianka |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Die Bedeutung der Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete
|
1. |
macht darauf aufmerksam, dass nach der aktuellen Klassifizierung durch Eurostat mehr als 23 % der EU-Bevölkerung in rein ländlichen Gebieten und weitere 35 % in mäßig besiedelten Gebieten leben; weist ferner darauf hin, dass in einigen Mitgliedstaaten weitaus mehr Menschen in rein ländlichen Gebieten leben. Dies trifft auf 17 von 27 Mitgliedstaaten zu, u.a. auf Irland (73 %), die Slowakei (50 %), Estland (48 %), Rumänien (46 %), Finnland, Griechenland, Litauen und Dänemark (43 %). |
|
2. |
hebt hervor, dass die ländlichen Gebiete mit ihrer Bevölkerung (und damit ihren kulturellen und gesellschaftlichen Ressourcen), ihrer natürlichen Umwelt und biologischen Vielfalt sowie ihren Rohstoffen und anderen wirtschaftlichen Ressourcen, die für das gesellschaftliche Leben der europäischen Gemeinschaft und ihre Entwicklung von großer Bedeutung sind, über ein großes Potenzial verfügen; hält in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur Erhaltung der gesellschaftlichen, kulturellen, natürlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete für besonders wichtig; |
|
3. |
weist darauf hin, dass sich die ländlichen Gebiete durch eine sehr große Vielfalt auszeichnen. Einige dieser Regionen erleben einen Bevölkerungsrückgang und haben in diesem Zusammenhang mit ernsthaften Problemen zu kämpfen, während andere, insbesondere wenn sie in der Nähe von Städten gelegen sind, eine steigende Nachfrage nach Grundstücken und starken Bevölkerungszuwachs bewältigen müssen. In einigen dieser Gebiete macht sich im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftskrise, von der auch die Landwirtschaft betroffen ist, ein ernsthafter Konjunkturrückgang bemerkbar, während andere Regionen dank Tourismus und einer intakten natürlichen Umwelt einen immer größeren Aufschwung erleben; |
|
4. |
äußert sich besorgt über den drastischen Rückgang und die zunehmende Überalterung der Bevölkerung in weiten Teilen des europäischen ländlichen Raumes. Für die Lebensfähigkeit der betroffenen Regionen wird es darauf ankommen, den ländlichen Raum als Lebensraum und Wirtschaftsstandort mit hinreichender Erwerbsbasis zu stabilisieren. Hierzu bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung und regionsspezifischer Konzepte, die an den endogenen Potenzialen ansetzen; |
|
5. |
hebt hervor, dass die Lebensqualität in den ländlichen Gebieten großen Einfluss darauf hat, ob die Landwirte und ihre Familien, die anderen Berufsgruppen, die die übrigen Primärressourcen bewirtschaften, und diejenigen, die sie aufwerten und verarbeiten, sowie die Bewohner ländlicher Gemeinden, die keine Landwirtschaft betreiben, weiterhin in diesen Gebieten leben und arbeiten wollen. Diese Entscheidungen haben Einfluss auf die Größe und Zusammensetzung der Bevölkerung sowie auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete; |
|
6. |
hebt hervor, dass die traditionellen kulturellen Wesensmerkmale der ländlichen Gebiete als wichtige Elemente der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Identität erhalten bzw. wiederhergestellt werden müssen; |
|
7. |
würdigt die große Bedeutung, die der Landwirtschaft auch bei der Bereitstellung wichtiger öffentlicher Güter, wie der Landschaft und der Nahrungsmittelsicherheit zukommt; spricht sich in diesem Zusammenhang für die weitere finanzielle Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe, die diese Güter bereitstellen, durch die Europäischen Union aus; zudem der Auffassung, dass u.a. die ländlichen Gebiete am meisten unter den künftigen Klimaveränderungen leiden werden, und fordert daher die Aufnahme von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels wie auch zur Anpassung an seine Auswirkungen in die Instrumente der Programmplanung, Raumentwicklung und Finanzierung, um über die partizipativen Verfahren und die landwirtschaftliche Praxis eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen; |
|
8. |
sieht es als erforderlich an, in der Gesellschaft insgesamt, insbesondere aber in der jüngeren Generation, das Verständnis und die Achtung für die Werte der ländlichen Gebiete und deren Bedeutung für die Wahrung der Lebensfähigkeit der Bevölkerung insgesamt zu wecken; |
Die finanzielle Dimension einer ausgewogenen Entwicklung der ländlichen Gebiete
|
9. |
erkennt an, dass die Gemeinsame Agrarpolitik als wichtiges Instrument der Gemeinschaft weiter entwickelt und verbessert werden muss, da sie der Umsetzung sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Ziele dient, auf die Erzielung guter Ergebnisse sowohl in der Binnenwirtschaft als auch im Wettbewerb auf dem Weltmarkt ausgerichtet ist und den territorialen Zusammenhalt der ländlichen Gebiete in den Mitgliedstaaten fördert; |
|
10. |
geht davon aus, dass dem ländlichen Raum aufgrund der tiefgreifenden Auswirkungen von Energiepolitik, Klimaschutz und Rohstoffeffizienz womöglich eine wichtigere Funktion in der Primärwirtschaft zukommen wird, und weist darauf hin, dass dieser Entwicklung schon jetzt vorgegriffen und gewährleistet werden muss, dass sie nachhaltig verläuft und die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Anliegen harmonisch miteinbezieht. Im Übrigen wäre darauf hinzuweisen, dass die Felderwirtschaft nach wie vor von großem Vorteil für den ländlichen Raum ist, weil sie dazu beitragen könnte, die Abhängigkeit von Sojaeinfuhren zu verringern, die Bodenqualität zu verbessern, den Düngemitteleinsatz zu senken, wirtschaftliche Tätigkeiten im ländlichen Raum zu festigen und die Handelsbilanz der Europäischen Union auszugleichen. Darüber hinaus bedauert der AdR, dass seinem Standpunkt zur Deckelung und zum Greening in den Beschlüssen der Staats- und Regierungschefs vom 26. Juni 2013 keine Rechnung getragen wurde und somit sowohl die Vielfalt als auch die Nachhaltigkeit des ländlichen Raums bedroht sind; |
|
11. |
unterstützt zugleich die umfassende Finanzierung wirksamer Programme mit Anreizen für junge Landwirte durch die Europäische Union und die finanzielle Unterstützung für Semisubsistenz-Betriebe sowie für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten, da diese wichtige Faktoren für die Erhaltung der Lebensfähigkeit der ländlichen Gebiete sind. Zugleich verweist der AdR auf die Notwendigkeit, die Beihilfen und Zuschüsse zu Maßnahmen für die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung von Schutzgebieten zu erhöhen, um den Umweltschutz mit der nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gebiete zu vereinbaren, die einen Großteil der Schutzgebiete betreuen; |
|
12. |
macht darauf aufmerksam, dass die Einkommen der Landwirte aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit sowie aus den Subventionen oder entsprechenden Zahlungen, die sie im Rahmen der beiden Säulen der GAP erhalten, wesentlichen Einfluss auf die Situation der ländlichen Gemeinden haben, in denen sie ansässig sind und ihre Betriebe führen. Diese Einkommen haben nicht nur Auswirkungen auf die Effizienz ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit und die Lebensqualität der Landwirte und ihrer Familien, sondern auch auf die Höhe des Steueraufkommens der Gemeinden, in denen sie ansässig sind. Die Höhe dieser Einkünfte hat außerdem erheblichen Einfluss auf die realen Möglichkeiten und das persönliche Engagement der Landwirte bei der Anhebung des Lebensstandards in den ländlichen Gebieten; |
|
13. |
äußert sich besorgt über die in der Finanziellen Vorausschau 2014-2020 vorgesehene Kürzung der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums; bedauert, dass im Vergleich zur Finanziellen Vorausschau 2007-2013 die Mittelzuweisung für die Entwicklung des ländlichen Raums deutlich gesunken ist, nämlich von 95,7 Mrd. auf unter 85 Mrd. EUR. Die den ländlichen Gemeinden tatsächlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel können noch geringer ausfallen, wenn die Mitgliedstaaten wie geplant das Recht erhalten, bis zu 15 % der Mittel aus der zweiten Säule auf die erste Säule der GAP zu übertragen (in einigen Regionen der EU sogar bis zu 25 %); |
|
14. |
weist ferner darauf hin, dass derzeit Überlegungen darüber angestellt werden, die Mittel der zweiten Säule der GAP stärker als bisher für Treuhandfonds im Zusammenhang mit der Deckung finanzieller Verluste aus Tier- und Pflanzenkrankheiten, Umweltvorfällen oder einem deutlich Einkommensrückgang der Landwirte zu verwenden, die bisher aus der ersten Säule der GAP finanziert wurden; bedauert, dass dies eine weitere Senkung der Mittelzuweisungen zur Verbesserung der technischen und sozialen Infrastruktur auf dem Land nach sich ziehen würde; |
|
15. |
begrüßt, dass mit dem gemeinsamen strategischen Rahmen und den Partnerschaftsvereinbarungen zwar die Voraussetzungen für Koordination und Integration geschaffen werden, um eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen zu unterstützen. Mit der Festlegung der Mindestquote von 5 % der ELER-Mittel für das LEADER-Programm ist ein wichtiger Ansatz für die Unterstützung der lokalen Entwicklung gegeben. Dennoch ist festzustellen, dass dieses Niveau zur Belebung der ländlichen Wirtschaft nicht ausreicht; |
|
16. |
begrüßt die Einbeziehung von der örtlichen Bevölkerung betriebener Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD) in die Programme der Strukturfonds in Form einer vor Ort umgesetzten lokalen Entwicklungsstrategie; ist dessen ungeachtet der Meinung, dass eine Mehrfondsstrategie mit der erforderlichen Koordinierung der jeweiligen Fondsverordnungen einhergehen muss. Die von der Kommission als Lösung vorgeschlagene Zwischenstufe ist unzureichend. Dabei wird zwar die Zuständigkeit einer einzigen anstatt mehreren Verwaltungsbehörden übertragen, die Verwaltungsverfahren an sich werden aber nicht vereinfacht. Die Rechtsvorschriften sind untereinander wenig kohärent und es besteht offensichtlich die Gefahr, dass mehr Zeit und Ressourcen dafür verwendet werden, Beanstandungen vorzubeugen, als die Entwicklung voranzubringen; |
|
17. |
spricht sein Bedauern darüber aus, dass die LEADER-Initiative für die operationellen Programme des EFRE und des EFS lediglich fakultativen Charakter hat und eine Finanzierung ausschließlich im Rahmen des thematischen Ziels „Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut“ vorgesehen ist. Durch diesen Grundsatz werden der potenzielle Handlungsspielraum lokaler Aktionsgruppen sowie die Möglichkeit der Einbeziehung verschiedener Fonds bei der Erarbeitung einer lokalen Entwicklungsstrategie eingeschränkt; |
|
18. |
weist darauf hin, dass die Aufrechterhaltung einer hohen Qualität öffentlicher und privater Dienstleistungen häufig eine starke politische, bürgerschaftliche und finanzielle Mobilisierung auf der Grundlage eines entschiedenen Ausgleichs der Unterschiede sowie der Notwendigkeit einer größeren Solidarität zwischen ländlichen und städtischen Gebieten erfordert; |
|
19. |
gibt zu bedenken, dass die geplante weitere Deregulierung der europäischen Agrarmärkte zu stärkeren Preisschwankungen bei Agrarprodukten führen und dies wiederum insbesondere die kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Familienbetriebe gefährden wird; macht zudem darauf aufmerksam, dass eine Aufhebung der Milchquoten zu einer stärkeren Industrialisierung und Konzentration in der Milchviehhaltung führen wird und dies wiederum den Klimawandel sowie die Abwanderung aus ländlichen Gebieten beschleunigt; sieht es weiterhin als wichtig an, den Landwirten eine Entschädigung für den kollektiven Nutzen zu leisten, den sie erbringen, z.B. für die Natur und die Kultur durch die Beweidung und Offenhaltung der Landschaft, der auf dem Markt nicht kommerziell verwertbar ist. Sollte sich zeigen, dass die Abschaffung des Milchquotensystems zu unerwünschten Formen der Tierhaltung führt, wären politische Maßnahmen nötig, um eine stärkere Information der Verbraucher und des Marktes insgesamt zu unterstützen und den Tierschutz in der gesamten EU sicherzustellen; |
|
20. |
weist auf die Möglichkeiten hin, Unterstützungstätigkeiten des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums, Säule 2, mit Tätigkeiten aus dem Regional-, Sozial- oder Fischereifonds, also den Fonds des GSR, zu verbinden. Biogaserzeugung, bodengebundene Infrastruktur für IKT, Innovation, Entwicklung von Fachkenntnissen, Unternehmensentwicklung und CLLD (von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung) sind Maßnahmen, die sich in das Programm für den ländlichen Raum einfügen, die jedoch auch Bezüge zu den anderen Fonds haben und bei denen verschiedene Gewerbezweige voneinander profitieren können und die Erfordernisse und Ressourcen von Stadt und Land gut zusammenpassen; |
Die Bedeutung des funktionellen Stadt-Land-Gefüges
|
21. |
macht insbesondere auf die Herausforderungen aufmerksam, vor denen ländliche Gemeinden im unmittelbaren Umfeld mittlerer und großer Städte stehen, und empfiehlt für die Festlegung einer Entwicklungsstrategie für diese Gebiete einen funktionellen Ansatz; |
|
22. |
stellt fest, dass sowohl die Städte als auch die ländlichen Gemeinden, die sich in funktionellen Gebieten befinden, über wertvolle und überaus nützliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Ressourcen verfügen; empfiehlt, bei der Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für ein funktionelles Gebiet jeweils eine Untersuchung der vorhandenen Ressourcen für das gesamte funktionelle Gebiet durchzuführen und in der Entwicklungsstrategie auch das Potenzial der ländlichen und städtischen Gemeinden im Hinblick auf deren optimale Nutzung nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen; weist auch auf die potenziellen Gefahren für ländliche Gebiete hin, die sich aus der ungleichmäßigen Entwicklung von Städten und ländlichen Gemeinden ergeben und die Folge der Tatsache sein können, dass die Städte ihre demographische und wirtschaftliche Überlegenheit ausnutzen; |
|
23. |
hält eine breit angelegte, direkte Zusammenarbeit zwischen den ländlichen Gemeinden eines funktionellen Gebiets, insbesondere bei der Erarbeitung einer Verhandlungsstrategie gegenüber Städten, die sich in diesem Gebiet befinden, für angebracht; |
|
24. |
sieht für die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie für funktionelle Gebiete eine Methode als wünschenswert an, bei der die Einbindung der lokalen Gebietskörperschaften sowie der Bewohner der städtischen und der ländlichen Gemeinden gewährleistet ist. Diese Mitwirkung sollte sowohl während der Vorbereitung (Untersuchung und Analyse) als auch bei der Entscheidung über die endgültige Form der Strategie sichergestellt sein; |
|
25. |
weist darauf hin, dass in den stadtnahen ländlichen Gebieten nur ein Teil der Bevölkerung Landwirtschaft betreibt. Aus Städten übergesiedelte Bewohner solcher Gebiete äußern häufig die Erwartung, bestimmte Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit, etwa der Einsatz natürlicher und künstlicher Dünger, die Arbeit mit landwirtschaftlichen Geräten, Viehhaltung und Beweidung, die sie als störend empfinden, solle eingestellt werden. Es wird empfohlen, im Rahmen der Raumplanung Probleme dieser Art zu antizipieren und ihnen insbesondere durch eine Nachhaltigkeitsstrategie zu begegnen, die die verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Interessen miteinander vereinbart und zum Beispiel Zonen für die landwirtschaftliche Erzeugung festlegt, um somit mögliche gesellschaftliche Konflikte weitestgehend zu vermeiden; |
|
26. |
unterstreicht, dass Programme zur sozialen Integration in ländlichen Gebieten, die ständigen Zuzug aus den Städten verzeichnen, eine Möglichkeit darstellen, eventuelle gesellschaftliche Konflikte aufgrund unterschiedlicher Lebensstile, Werte und gesellschaftlicher Normen anzugehen; |
|
27. |
weist darauf hin, dass die Kosten der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen der Zersiedelung solidarisch zwischen städtischen und ländlichen Gebieten geteilt werden sollten; |
Die Probleme ländlicher Gemeinden in abgelegenen (peripheren) Gebieten
|
28. |
macht darauf aufmerksam, dass sich die deutliche Mehrheit der ländlichen Gemeinden außerhalb der unmittelbaren Einflusssphäre großer und mittlerer Städte befindet. Zur Unterstützung dieser Gebiete sind daher spezifische Instrumente erforderlich; empfiehlt daher, sowohl in der Gemeinsamen Agrarpolitik als auch in der Kohäsionspolitik, die ebenfalls mithilfe von Instrumenten der regionalen Entwicklung umgesetzt wird, solche Lösungen zu berücksichtigen, die tatsächlich zum territorialen Zusammenhalt und zu einem Ausgleich der Chancen für eine nachhaltige Entwicklung führen; |
|
29. |
erkennt an, dass die ländlichen Gebiete erhalten werden müssen, und fordert dementsprechend eine größere Unterstützung der lokalen Selbstverwaltungen beim Aufbau und Unterhalt der technischen, aber auch der für den Erhalt der Lebensfähigkeit dieser Gebiete wichtigen gesellschaftlichen Infrastruktur; |
|
30. |
weist auf die funktionale Verknüpfung zwischen den in Randgebieten gelegenen ländlichen Gebieten und kleineren Städten hin und fordert die Einrichtung entsprechender Mechanismen zur Förderung gemeinsamer Maßnahmen zur Anhebung der Lebensqualität in diesen Gebieten, etwa dadurch, dass die kleinen Städte die für das reibungslose Funktionieren des Gebiets notwendigen Dienstleistungen vor Ort zur Verfügung stellen; |
|
31. |
stellt fest, dass die strategischen Dokumente zur Festlegung der Entwicklungspolitik dieser Gebiete sowohl Ergebnis der Zusammenarbeit und der (bilateralen und weitergehenden) Vereinbarungen zwischen benachbarten Gemeinden als auch der Kooperation im Bereich Regionalpolitik sein sollten; |
Das Verhältnis zwischen Stadt und Land und seine Bedeutung für die regionale Entwicklung
|
32. |
hebt einmal mehr hervor, wie wichtig und notwendig im Rahmen funktioneller Gebiete die Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gemeinden und Städten ist; erkennt zugleich an, dass die Entwicklungsstrategien für diese Gebiete Mehrjahresrahmen feststecken sollten, die mindestens einen Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren umfassen; |
|
33. |
spricht sich dafür aus, dass die Zusammenarbeit der ländlichen und städtischen Gemeinden auf der Grundlage von Territorialpartnerschaften stattfindet; |
|
34. |
ist der Ansicht, dass im Vorfeld der Zusammenarbeit im Rahmen eines funktionellen Gebiets eine breit geführte öffentliche Diskussion, gefolgt von einer souveränen Entscheidung der einzelnen Gemeinden stattfinden sollte. Ein eventueller Ausstieg einer Gemeinde aus der Zusammenarbeit im Rahmen eines funktionellen Gebiets sollte angesichts der Vernetzung der Infrastruktur und der gesellschaftlichen Verknüpfungen nur mit der Zustimmung aller an der Zusammenarbeit in dem funktionellen Gebiet beteiligten Städte und Gemeinden möglich sein; |
|
35. |
weist auf die gegenseitige Abhängigkeit der Städte und der ländlichen Gemeinden im Rahmen des funktionellen Gebietes hin, die sich aus der gemeinsamen Nutzung der Human-, Natur- und Wirtschaftsressourcen sowie der Organisation der öffentlichen Dienstleistungen ergibt; |
|
36. |
ruft mit Blick auf die aktuellen Trends im Lebensstil städtischer Milieus dazu auf, diese zur Förderung der Werte ländlicher Gebiete zu nutzen; weist darauf hin, dass sich durch Vernetzung ungeahnte Chancen für enge Kontakte zwischen Landwirten und Verbrauchern von Lebensmitteln ergeben; macht darauf aufmerksam, dass Initiativen dieser Art einen besonders wertvollen Beitrag zur Schaffung einer neuen Form von Stadt-Land-Beziehungen leisten können; |
|
37. |
unterstreicht, dass kurze Versorgungsketten für landwirtschaftliche Produkte zur Entwicklung einer nachhaltigen Erzeugung und eines entsprechenden Konsums beitragen. Sie entsprechen der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach authentischen Erzeugnissen ebenso wie dem Kriterium der jahreszeitgemäßen lokalen und sozial ausgewogenen Produktion. Dieses Konsummuster beruht auch auf dem Respekt der Bürger gegenüber der Umwelt, die in einer Reduzierung der Verpackungen, der Senkung der CO2-Emissionen und der Unterstützung nachhaltiger Produktionsverfahren zum Ausdruck kommt. Die Unterstützung der kurzen Versorgungsketten muss mit der Förderung der genossenschaftlichen Zusammenschlüsse einhergehen, denn so wird die Stellung der Landwirte auf den Märkten gestärkt. Entscheidend ist die Bündelung des Angebots als wirksames Instrument zur Erzielung gerechter Preise für die Landwirte und zur Sicherung der wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln; |
|
38. |
weist jedoch darauf hin, dass Erzeuger, die sich an Initiativen dieser Art beteiligen wollen, zahlreiche Probleme bewältigen müssen. Häufig erweist es sich als schwierig, den Verbrauchern, die in der Regel hinsichtlich Menge und Vielfalt kontinuierliche Lieferungen erwarten, ein regelmäßiges und gleichbleibendes Angebot zu bieten. Diese Art von Tätigkeit erfordert meistens eine kostspielige Ausstattung (z.B. passende Fahrzeuge, Kühlsysteme, Räume für Verkauf und Verarbeitung); empfiehlt daher, Aktivitäten dieser Art zu unterstützen; |
|
39. |
macht darauf aufmerksam, dass die Erreichbarkeit ländlicher Gebiete, ihre Entfernung von Entscheidungs- und Forschungszentren sowie der beschränkte Zugang zu neuen Technologien Schwierigkeiten darstellen, die für viele ländliche Gemeinden nur schwer zu überwinden und die für die Entwicklungsmöglichkeiten, Chancengleichheit und Lebensqualität wesentlich sind. Zudem ist die Erwerbsquote in ländlichen Gebieten niedriger als in städtischen Gebieten, und es werden weniger Arbeitsplätze geschaffen; |
|
40. |
weist darauf hin, dass zu den bisherigen Problemen neue Herausforderungen hinzutreten, wie etwa der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und andere Umweltprobleme, der Rückgang des ländlichen, insbesondere des landwirtschaftlich genutzten Raums und die Überalterung der Gesellschaft; unterstreicht, dass mehr getan werden muss, um das Bewusstsein für diese Problematik zu fördern und für die notwendige Abhilfe zu sorgen, indem aktive Maßnahmen zur Vermeidung der Abwanderung ergriffen werden; |
|
41. |
bedauert, dass die ländlichen Gebiete im Verhältnis zu den Städten an Dynamik verlieren; unterstreicht zugleich, dass im Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt vom November 2010 auf das soziale und wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen den europäischen Regionen hingewiesen wurde; |
|
42. |
bestätigt, dass die Regionen mit vorwiegend ländlichen Gebieten ihren Rückstand zwar aufholen, dass ihr Entwicklungsniveau aber weiterhin hinter dem Gemeinschaftsdurchschnitt zurückbleibt; bestätigt, dass diese Kluft besonders im Verhältnis zu Regionen mit überwiegend städtischen Gebieten sichtbar wird. Das durchschnittliche BIP in ländlichen Gebieten ist in der EU-12 um 73 % niedriger als das BIP in städtischen Gebieten. Besonders deutlich ist das Ungleichgewicht zwischen den ländlichen und den städtischen Regionen in Mittel-, Ost- und Südeuropa; |
|
43. |
fordert im Hinblick auf eine effizientere Nutzung der Mittel zur Bekämpfung der gesellschaftlichen Ausgrenzung eine systematische und vollständige kartografische Erfassung der Armutsenklaven in ländlichen Gebieten (mindestens auf NUTS-3-Ebene); |
|
44. |
macht erneut darauf aufmerksam, dass eine Multi-Level-Governance unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Neugestaltung der europäischen und der nationalen Politik, u.a. auch der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013, ist. Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen, die dringend zu klären sind. Obwohl dieser Grundsatz in dem Vorschlag für eine allgemeine Verordnung gebührend berücksichtigt wurde, ist die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Partnerschaftsvereinbarungen nach wie vor unklar. Die Regionen und Gesellschaften in ländlichen Gebieten können sich nicht länger mit dem Status einer kofinanzierten Einheit zufriedengeben, die bei der Wahl der Prioritäten und der Umsetzungs- und Verwaltungsmethoden kein Mitspracherecht hat. In den gerade von der Europäischen Kommission erstellten Leitlinien zu den Partnerschaftsvereinbarungen sollte deutlich hervorgehoben werden, wie wichtig es ist, Vertreter der ländlichen Gebiete in die Verwaltung dieser Vereinbarungen einzubeziehen; |
Die Strategie und Politik der EU für ländliche Gebiete bis 2030
|
45. |
ist der Auffassung, dass die künftige EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums folgende Charakteristika aufweisen sollte:
|
|
46. |
ist der Auffassung, dass zur Erreichung dieser Ziele im Rahmen der künftigen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums sichergestellt werden muss, dass Landwirte stärker in die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen einbezogen werden; |
|
47. |
ist der Meinung, dass die derzeitige Tendenz, die finanziellen Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums in erster Linie für die Landwirtschaft zu verwenden, im Hinblick auf die Gewährleistung einer echten wirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen Raums im nächsten Programmplanungszeitraum einer größeren Ausgewogenheit weichen sollte. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/86 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Stärkung der Gestaltungsmacht der lokalen Behörden in den Partnerländern mit Blick auf eine verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungsergebnisse
2013/C 356/15
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
befürwortet uneingeschränkt den von der Kommission in dieser neuen Mitteilung vertretenen Ansatz, wonach die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in ihrer politischen Bedeutung als Politikgestalter und Entscheidungsträger anerkannt werden, die ein angemessenes Maß an Autonomie, Kapazitätsaufbau und finanziellen Ressourcen benötigen; |
|
— |
begrüßt den Gedanken, dass bei der Unterstützung des öffentlichen Sektors in den Partnerländern mit dem Ziel einer wirksameren und effizienteren Gestaltung und Umsetzung der nationalen Entwicklungspolitik und der dazugehörigen Pläne die wichtige Rolle des öffentlichen Sektors auf lokaler und regionaler Ebene berücksichtigt werden sollte; |
|
— |
fordert die Kommission auf, die in den Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung festgelegten Regeln für eine Vollfinanzierung anzuwenden, wenn „es […] im Interesse der Gemeinschaft [liegt], einziger Geldgeber für eine Maßnahme zu sein“, wie im Falle des Programms „Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess“; |
|
— |
teilt die Ansicht der Kommission, das die EU ihre Unterstützung an die wachsende Rolle, das Potenzial und die Bedürfnisse der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Verbände in den Partnerländern anpassen und auf diese Weise den Schritt von einer wirksamen Hilfe hin zu einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit vollziehen sollte; betont, dass dies eine Aufstockung der Finanzmittel für die Maßnahmen zur Unterstützung der Dezentralisierung und der Gestaltungsmacht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie ihrer Verbände erforderlich macht; |
|
— |
erklärt seine Bereitschaft, mit technischer und finanzieller Unterstützung der Kommission ein Instrument zur Bewertung und Kontrolle der Dezentralisierungsaspekte in den Partnerländern zu entwickeln, und zwar in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten; |
|
— |
stellt fest, dass zu einer umfassenden Einbindung der lokalen Behörden in die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 ein echter partizipativer Prozess erforderlich ist und dass diese Einbindung im Gegensatz zur Konzipierung der Millenniumsentwicklungsziele bereits frühzeitig, in der Entwicklungsphase der Post-2015-Agenda erfolgen und durch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel flankiert werden muss; |
|
— |
bekundet erneut seine Unterstützung für die Ausrufung des Jahres 2015 als Europäisches Jahr der Entwicklung und fordert daher, dass in ausreichendem Maße Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden, um die Initiativen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu fördern; |
|
— |
bekräftigt seine Bereitschaft, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa eine politische Plattform zur Entwicklung ihrer internationalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu bieten. |
|
Berichterstatter |
Hans JANSSEN (NL/EVP), Bürgermeister von Oisterwijk |
|
Referenzdokument |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Stärkung der Gestaltungsmacht der lokalen Behörden in den Partnerländern mit Blick auf eine verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungsergebnisse COM(2013) 280 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Allgemeine Bemerkungen
|
1. |
begrüßt die neue Mitteilung der Europäischen Kommission über die Stärkung der Gestaltungsmacht der lokalen Behörden in den Partnerländern mit Blick auf eine verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungsergebnisse. Sie bildet einen wichtigen weiteren Schritt zur ausdrücklichen Anerkennung und zum weiteren Ausbau der Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Partner in der EU-Entwicklungspolitik, die Seite an Seite mit ganz anders gearteten Partnern und Akteuren wie Zentralregierungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten; |
|
2. |
erinnert daran, dass die Kommission 2008 ihre erste Mitteilung (1) über die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Entwicklungspolitik vorgelegt hat. Das war ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Stellung, der Rolle und des Mehrwerts der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Bereichen Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit; |
|
3. |
verweist auf frühere Stellungnahmen des AdR, insbesondere auf die jüngsten Stellungnahmen zu den Mitteilungen Globales Europa: Ein neues Konzept für die Finanzierung des auswärtigen Handelns der EU und Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel, in denen die besondere Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihre Rolle für die außenpolitische Tätigkeit der EU betont werden; |
|
4. |
befürwortet uneingeschränkt den von der Kommission in dieser neuen Mitteilung vertretenen Ansatz, wonach die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in ihrer politischen Bedeutung als Politikgestalter und Entscheidungsträger anerkannt werden, die ein angemessenes Maß an Autonomie, Kapazitätsaufbau und finanziellen Ressourcen benötigen; |
|
5. |
erinnert daran, dass alle „lokalen Behörden“– Regionen, Provinzen, Bezirke, Distrikte, Gemeinden, Dörfer etc. — von strategischer Bedeutung sind, wenn es darum geht, die demokratische Regierungsführung zu stärken und einen Beitrag zu einer wirksameren Entwicklung zu leisten; sieht daher keinen Grund für die Entscheidung der Europäischen Kommission, in erster Linie die kommunale Ebene in den Mittelpunkt ihrer Mitteilung (siehe Fußnote 1) zu stellen; |
|
6. |
begrüßt die in der Mitteilung erhobene Forderung, die Gestaltungsmacht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Partnerländern zu stärken, damit sie besser in der Lage sind, die ihnen beispielsweise durch die EU-Agenda für den Wandel übertragenen wichtigen Aufgaben zu erfüllen — im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie und weiterer Schlüsselelemente verantwortungsvoller Regierungsführung sowie auf dem Gebiet des breitenwirksamen und nachhaltigen Wachstums zugunsten der menschlichen Entwicklung; |
|
7. |
weist erneut darauf hin, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa in vielen Bereichen, in denen die Gebietskörperschaften der Partnerländer noch weitere Kapazitäten aufbauen müssen, über einen reichen Erfahrungssatz verfügen. Diese Tatsache sollte stärker in der Mitteilung zum Ausdruck kommen, in der ein Kernthema auch die Frage sein sollte, wie diese Erfahrungen u.a. durch den Wissensaustausch auf Augenhöhe umgesetzt und an die Umstände vor Ort angepasst werden können; |
|
8. |
ist der Ansicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ausgehend von der in der Mitteilung enthaltenen Analyse eng in die Gestaltung der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 eingebunden werden sollten. Die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erstreckt sich nicht nur auf die nachhaltige Entwicklung, sondern auch auf Bereiche wie inklusive Urbanisierung, sozialer Zusammenhalt, Anpassung an den Klimawandel, Sicherheit des Menschen etc. Vor diesem Hintergrund
|
|
9. |
würdigt das offene Verfahren, das in der Vorbereitungsphase der Mitteilung angewandt wurde. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften konnten ihre Beiträge und Vorschläge einsenden, und mehrfach gab es Möglichkeit zu einem Gedankenaustausch, unter anderem in einer Sitzung der Fachkommission CIVEX des AdR; |
|
10. |
begrüßt die Tatsache, dass in der Mitteilung die große Bedeutung des AdR als Impulsgeber und Koordinator in den Entwicklungsbemühungen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften anerkannt wird, und ist zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit im Zuge der weiteren Gestaltung und Umsetzung der EU-Entwicklungspolitik bereit. Geeignete Foren dafür sind beispielsweise die Jahreskonferenz zur dezentralen Zusammenarbeit, die den Dialog zwischen den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aus der EU und den Entwicklungsländern sowie den Organen und Einrichtungen der EU fördert, und –insbesondere mit Blick auf die Zusammenarbeit im Rahmen der seitens der EU unternommenen Anstrengungen, die Entwicklung in den Nachbarstaaten voranzubringen — ARLEM und CORLEAP, zwei Gremien, in denen Vertreter der lokalen und regionalen Ebenen aus der EU und den benachbarten Partnerländern zusammenkommen; |
Hintergrund
|
11. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass zentral gesteuerte Entwicklungsmaßnahmen und -programme nach einem Top-down-Konzept alleine nicht ausreichen, um der Vielschichtigkeit von nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung erfolgreich zu begegnen, und dass öffentliche und private Akteure ihre Aufgaben übernehmen müssen, insbesondere auf lokaler Ebene; |
|
12. |
teilt die ausgewogene Haltung, die die Kommission im Hinblick auf die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften einnimmt: Einerseits kann ihre wichtige Funktion unabhängig davon, wie die zentralen Behörden arbeiten (beispielsweise in unsicheren Staaten), zum Zuge kommen, andererseits kann ihre Schlüsselrolle, auch auf lokaler Ebene, durch negative Faktoren beeinträchtigt werden; |
|
13. |
begrüßt den Vorschlag der Kommission, in den Bemühungen um die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Partnerländern strategischer vorzugehen, um deren Gestaltungsmacht zu stärken und die Entwicklungsziele zu verwirklichen; |
|
14. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass die politische Anerkennung der Rolle, die die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Entwicklungsprozess spielen, mit einem angemessenen Maß an Autonomie, Kapazitätsaufbau und finanziellen Ressourcen einhergehen sollte, damit bei der Übertragung von Gestaltungsmacht an diese Behörden keine Lücken entstehen und damit ihre Gestaltungsmacht mit der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den einzelnen Regierungs- und Verwaltungsebenen in Einklang steht; |
|
15. |
fordert die Kommission auf, diese äußerst zutreffenden Beobachtungen in die Prioritäten für ihre Kooperationsprogramme mit einfließen zu lassen, die sie mit den Partnerländern vereinbart. Aufgrund der Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten diese uneingeschränkt in die Vorbereitung und Durchführung dieser Programme eingebunden werden, auch durch ihre Vertreterverbände; |
Erschließung des Entwicklungspotenzials der lokalen Behörden
|
16. |
begrüßt den Gedanken, dass bei der Unterstützung des öffentlichen Sektors in den Partnerländern mit dem Ziel einer wirksameren und effizienteren Gestaltung und Umsetzung der nationalen Entwicklungspolitik und der dazugehörigen Pläne die wichtige Rolle des öffentlichen Sektors auf lokaler und regionaler Ebene berücksichtigt werden sollte. Dieser Vorschlag deckt sich mit der Forderung des Ausschusses der Regionen nach einer besseren Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Entwicklungspolitik, sowohl innerhalb der EU als auch in den Entwicklungsländern, mit denen eine Partnerschaft besteht; |
|
17. |
teilt die Ansicht der Kommission, die den Partnerschaften mit den Interessenträgern und den Mechanismen für den Dialog eine große Bedeutung beimisst, da sie die Möglichkeit bieten, mit den zuständigen zentralen Behörden in einen Dialog zu treten, damit die lokalen Bedürfnisse und Anliegen bekannt sind und entsprechend berücksichtigt werden. Dies steht im Einklang mit dem Ansatz der Multi-Level-Governance. Gleichzeitig erfordert der Ansatz der Multi-Level-Governance auch, dass sich die zentralen Behörden ihrerseits um einen Dialog mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bemühen, um sich ein Bild von den Anliegen und Bedürfnissen auf lokaler Ebene zu machen; |
|
18. |
Sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als auch in den Partnerländern steht die geforderte Kofinanzierung einer Teilnahme bestimmter Akteure entgegen. Im Falle der Partnerländer könnten finanzielle Engpässe lokale Akteure von einer Beteiligung abhalten, während in einigen Mitgliedstaaten wie Schweden die lokale und regionale Ebene nicht an Programmen wie „Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess“ teilnehmen kann, da sie nicht befugt ist, lokal erhobene Steuern zur Finanzierung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. Angesichts der spezifischen Ziele des Programms und der weitreichenden Erfahrungen verschiedener europäischer Staaten in den Bereichen Soziales, Dezentralisierung, Gesundheit etc. dürfte dies dem Interesse der EU und ihres Programms für externe Zusammenarbeit zuwiderlaufen. Um diese Situation zu vermeiden, fordert der AdR die Kommission auf, die in den Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung festgelegten Regeln für eine Vollfinanzierung anzuwenden, wenn „es […] im Interesse der Gemeinschaft [liegt], einziger Geldgeber für eine Maßnahme zu sein“ (Artikel 253 Absatz 1 (e)); |
|
19. |
hebt die Bedeutung des territorialen Entwicklungskonzepts hervor, auf das in der Mitteilung Bezug genommen wird, und fordert die EU auf, sich gemeinsam mit anderen Entwicklungspartnern darum zu bemühen, dieses Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Die EU sollte darüber hinaus Anreize schaffen, beispielsweise zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Partnerländer, die im Dialog mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften des Landes sowie ihrem Verband/ihren Verbänden echte Fortschritte erzielen, um in ihrem nationalen Entwicklungsplan einen territorialen Ansatz zu verfolgen; |
Gestaltung der EU-Unterstützung für bessere Governance und wirksamere Entwicklungsergebnisse auf lokaler Ebene
|
20. |
stellt fest, dass der Vorschlag der Kommission, demokratisch legitimierte Behörden zu fördern, angemessen ist, vertritt jedoch die Ansicht, dass der im ersten Absatz des Kapitels enthaltene ausdrückliche Hinweis auf die „Möglichkeiten einer Koordinierung mit regionalen Behörden“ mit Blick auf Fußnote 1 der Mitteilung unverständlich ist, wo es heißt, dass in dieser Mitteilung der Begriff „lokale Behörden“ alle Arten von Behörden umfasst — Gemeinden und lokale Behörden, Bezirke, Provinzen und Regionen; |
|
21. |
teilt die Ansicht der Kommission, dass der politische Wille eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Dezentralisierung ist. Nach den Worten der Mitteilung muss dieser politische Wille jedoch gefördert werden, beispielsweise durch einen politischen Dialog. Und sollte ein politischer Wille wirklich erkennbar sein, dann sollte dies durch Anreize im Rahmen der EU-Zusammenarbeit belohnt werden; |
|
22. |
teilt die Auffassung, dass die Unterstützung der EU für die Dezentralisierung in erster Linie auf die Schaffung günstiger rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen und auf den Institutionen- und Kapazitätsaufbau ausgerichtet sein sollte. Der AdR unterstützt darüber hinaus weitere der genannten Prioritäten: So sollten beispielsweise die Finanzdezentralisierung, die Verwaltung der öffentlichen Finanzen und die Rechenschaftspflicht sowie ein langfristiger und nachfrageorientierter Ansatz für den Kapazitätsaufbau im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen; |
|
23. |
weist erneut darauf hin, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EU-Mitgliedstaaten in vielen Bereichen, in denen die Gebietskörperschaften in den Partnerländern ihre Kapazitäten noch ausbauen müssen, über einschlägige Sachkenntnis und einen reichen Erfahrungsschatz verfügen; ist der Ansicht, dass zusätzlich und ergänzend zur bilateralen Zusammenarbeit zwischen den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EU und ihrer Partnerländer die Verbände dieser Gebietskörperschaften als strategische Partner für die Durchführung der Programme für den Kapazitätsaufbau in den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften betrachtet werden sollten; |
|
24. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass die Verbände lokaler und regionaler Gebietskörperschaften einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung einer guten Regierungsführung und zum Erzielen von Entwicklungsergebnissen auf lokaler Ebene leisten können, und weist darauf hin, dass neben den sechs in der Mitteilung aufgeführten Aufgaben auch darauf hingewiesen werden sollte, dass die Verbände auch dafür zuständig sind, den Verbandsmitgliedern einschlägige Dienstleistungen anzubieten. Verbände der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften werden häufig von ihren Mitgliedern aufgefordert, Dienstleistungen in den Bereichen Kapazitätsaufbau und Schulungen anzubieten, insbesondere wenn es um die Entwicklung geht. Diese Dienstleistungen haben sich für die Öffentlichkeitswirksamkeit, das Engagement der Mitglieder und mithin für die Nachhaltigkeit der Verbände als sehr wichtig erwiesen. Auf diese Weise werden auch Informationen und Einblicke gewonnen, die im Zuge der Lobbyarbeit und der Beratungstätigkeiten des Verbandes genutzt werden können; |
|
25. |
teilt die Ansicht der Kommission, dass die Verbände der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in vielen Partnerländern noch wenig leistungsfähig sind. Damit sie ihre Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen können, ist substanzielle langfristige Unterstützung erforderlich. Diese kann verschiedene Formen annehmen: Beispielsweise durch die unmittelbare Bereitstellung von Finanzmitteln für die Haushalte, die von den EU-Delegationen verwaltet werden, und durch die Konzipierung oder Fortführung größerer, miteinander verknüpfter Programme wie des Programms ARIAL, auf das in der Mitteilung hingewiesen wird. In jedem Fall ist es von ausschlaggebender Bedeutung, durch kooperatives Lernen und den Erfahrungsaustausch auf die Kenntnisse und Erfahrungen der europäischen Verbände lokaler und regionaler Gebietskörperschaften zurückzugreifen; |
Künftiges Vorgehen: effizientere und flexiblere Unterstützung
|
26. |
teilt die Ansicht der Kommission, das die EU ihre Unterstützung an die wachsende Rolle, das Potenzial und die Bedürfnisse der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Verbände in den Partnerländern anpassen und auf diese Weise den Schritt von einer wirksamen Hilfe hin zu einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit vollziehen sollte; |
|
27. |
betont, dass dies eine Aufstockung der Finanzmittel für die Maßnahmen zur Unterstützung der Dezentralisierung und der Gestaltungsmacht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie ihrer Verbände erforderlich macht. Jetzt, zu Beginn eines neuen Finanzplanungszeitraums, ist der richtige Zeitpunkt dazu. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten für eine Förderung durch alle Instrumente des Pakets „Europa in der Welt“ in Frage kommen. Auch innerhalb des Europäischen Entwicklungsfonds muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Aus dem „Allgemeinen thematischen Bewertungsbericht über die Unterstützung der Kommission für Dezentralisierungsprozesse“ (3) vom Februar 2012 geht hervor, dass die direkte Unterstützung der Dezentralisierung im Zeitraum 2000-2004 nur 1 % aller Finanzierungsbeiträge der Kommission ausmacht (alle Bereiche und Länder), 2004-2008 waren es etwa 2,5 % und in den letzten Berichtsjahren (2008-2009) dagegen wiederum sehr viel weniger. Die Stärkung der Gestaltungsmacht der lokalen Behörden in den Partnerländern mit Blick auf eine verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungsergebnisse sollte mehr wert sein; |
|
28. |
begrüßt das Ansinnen der Kommission zu prüfen, ob innovative Finanzierungsmodalitäten genutzt werden können, sowie den Vorschlag, dass dies an die Bewertung der institutionellen Leistungsfähigkeit der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften geknüpft werden könnte. Derartige Bewertungen werden jedoch zu oft nach einem Top-down-Ansatz durchgeführt und enden in Sanktionen für diejenigen, die weniger gute Leistungen erbringen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass Teilnehmer dem Verfahren gegenüber weniger aufgeschlossen sind. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Kapazitätsaufbau in den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften weiter vorangetrieben werden muss, sollten bereichsübergreifende Lernprozesse stärker zum Einsatz kommen, wobei Instrumente wie zum Beispiel Leistungsvergleiche und transparente Vergleiche verwendet werden, die Verbänden lokaler und regionaler Gebietskörperschaften eine Stärkung ihres Beitrags zur Effizienzsteigerung ermöglichen, leichter mit positiven finanziellen Anreizen verknüpft werden können und auf lange Sicht zweckmäßiger und zielführender sind; |
|
29. |
befürwortet den Standpunkt, dass die EU in ihren Programmen für genug Flexibilität sorgen sollte, um Initiativen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Verbände unterstützen zu können. Dies ist ein ausschlaggebender Faktor für eine stärkere strategische Unterstützung ihrer Gestaltungsmacht. Eine derartige Flexibilität sollte es daher ermöglichen, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihren Verbänden direkt finanzielle Mittel für ihre „eigenen Initiativen“ zur Verfügung gestellt werden und dass sie solche Initiativen auch gemeinsam mit ihren Partnern unter den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und deren Verbänden in der EU bzw. über diese Partner finanzieren können; |
|
30. |
teilt die Auffassung der Kommission, dass die EU im Rahmen der Budgethilfe Systeme fördern sollte, mit deren Hilfe die Finanztransfers von der Ebene der Zentralregierung auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften überwacht werden. Dies sollte auch dazu beitragen, dass auf regionaler und globaler Ebene komplexere Instrumente entwickelt werden, mit deren Hilfe die Dezentralisierungsprozesse gelenkt werden können und die als Grundlage für eine Bewertung der aktuellen Lage dienen, wie beispielsweise im Falle der Europäischen Charta für lokale Selbstverwaltung auf europäischer Ebene; |
|
31. |
erklärt seine Bereitschaft, mit technischer und finanzieller Unterstützung der Kommission ein Instrument zur Bewertung und Kontrolle der Dezentralisierungsaspekte in den Partnerländern zu entwickeln, und zwar in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, insbesondere den Verbänden der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, sowie weiteren Organisationen (UN-HABITAT, UNDP) und Einrichtungen, auch in den Entwicklungsländern (mit dem Rat der Gebietskörperschaften der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion UEMOA zum Beispiel); |
|
32. |
ist der Ansicht, dass solche umfassenden Instrumente den politischen Dialog zwischen der EU und ihren Partnerländern wesentlich bereichern werden. Durch sie ist es möglich, im Zuge des Dialogs die politische Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz zwischen den verschiedenen Regierungsebenen eines Landes zu berücksichtigen. Gemäß dem Wunsch, die Nutzung innovativer Finanzierungen zu sondieren, kann ein derartiger politischer Dialog durch finanzielle Anreize gestärkt werden, die einen Bezug zu diesen Themen haben; |
|
33. |
stimmt mit der Ansicht der Kommission überein, dass die EU die dezentrale und grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa und den Partnerländern auf der Grundlage langfristiger und gleichberechtigter institutioneller Partnerschaften weiterhin unterstützen sollte. Aus europäischer Sicht sollte die Koordinierung von Partnerschaften innerhalb größerer Netze und die Zusammenarbeit in gemeinsamen Programmen gefördert und erleichtert werden. Der AdR weist darauf hin, dass das Portal der dezentralisierten Entwicklungszusammenarbeit eine derartige Koordinierung erleichtert, indem es Informationen zu bestehenden Projekten bereitstellt und Diskussionen ermöglicht, die darauf ausgerichtet sind, neue Projekte ins Leben zu rufen. Der AdR ist bereit, seine Aufgabe in dieser Hinsicht auch weiterhin zu erfüllen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Verbänden der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. Da stärker koordinierte Ansätze eine bessere Wirkung entfalten, könnte dies durch eine Aufstockung der für derartige Projekte zur Verfügung stehenden EU-Mittel gefördert werden; |
|
34. |
begrüßt den Standpunkt der Kommission, dass die EU die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer Verbände bei der Gestaltung der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 stärken sollte; stellt mit Genugtuung fest, dass diese Ansicht vom Rat (4) geteilt wird, der an die EU und ihre Mitgliedstaaten appelliert, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen der Stimme und Erfahrung lokaler Behörden Rechnung zu tragen und deren Vertretung in politischen Beratungen auf nationaler und internationaler Ebene zu unterstützen, nicht zuletzt bei der Ausarbeitung der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 und der Vorbereitung auf die Konferenz HABITAT III; |
|
35. |
stellt fest, dass zu einer umfassenden Einbindung der lokalen Behörden in die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 ein echter partizipativer Prozess erforderlich ist und dass diese Einbindung im Gegensatz zur Konzipierung der Millenniumsentwicklungsziele bereits frühzeitig, in der Entwicklungsphase der Post-2015-Agenda erfolgen muss. Die zur Gewährleistung der Einbindung erforderlichen finanziellen Mittel müssen bereitgestellt werden; |
|
36. |
bekundet erneut seine Unterstützung für die Ausrufung des Jahres 2015 als Europäisches Jahr der Entwicklung (5) und hält dies für eine gute Gelegenheit, Maßnahmen auf lokaler und regionaler Ebene zu ergreifen und — auch finanziell — zu unterstützen; fordert daher, dass in ausreichendem Maße Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden, um die Initiativen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften finanziell zu fördern; |
|
37. |
bekräftigt seine Bereitschaft, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa eine politische Plattform zur Entwicklung ihrer internationalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu bieten; |
|
38. |
bekräftigt seine Zusage, einen Beitrag zu weiteren politischen Entwicklungen und Innovationen zu leisten, indem er sich unter anderem auf diese Mitteilung und auf die Erfahrungen in der dezentralen Entwicklungszusammenarbeit stützt und mit den Netzen und Verbänden der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zusammenarbeitet. All dies zielt darauf ab, die Gestaltungsmacht der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Partnerländern mit Blick auf eine verbesserte Regierungsführung und wirksamere Entwicklungsergebnisse zu stärken. |
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) COM(2008) 626 final.
(2) Dritte Konferenz der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen.
(3) http://ec.europa.eu/europaid/how/evaluation/evaluation_reports/2012/1300_docs_en.htm
(4) Siehe die Schlussfolgerungen des Rates zu lokalen Behörden in der Entwicklungszusammenarbeit, Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten), Brüssel, 22. Juli 2013 und die Schlussfolgerungen des Rates — Eine übergeordnete Agenda für die Zeit nach 2015, Tagung des Rates Allgemeine Angelegenheiten, Luxemburg, 25. Juni 2013.
(5) Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der Entwicklung (2015), COM(2013) 509 final.
III Vorbereitende Rechtsakte
AUSSCHUSS DER REGIONEN
103. Plenartagung vom 7.-9. Oktober 2013
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/92 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Viertes Eisenbahnpaket
2013/C 356/16
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
begrüßt die Bereitschaft der Europäischen Kommission, den für die Schaffung eines einheitlichen Eisenbahnraums erforderlichen Rechtsrahmen zu ergänzen; |
|
— |
hält die Liberalisierung nicht für einen Selbstzweck, denn das Ziel muss darin bestehen, das Angebot und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. Die Öffnung für den Wettbewerb lässt sich nur beurteilen, wenn auch die Investitionen in die Infrastrukturen, die tatsächlichen Bedingungen, unter denen der Markt funktioniert, und die technischen Aspekte der Interoperabilität berücksichtigt werden; |
|
— |
weist darauf hin, dass die lokalen Gebietskörperschaften dank des Grundsatzes der Selbstverwaltung frei darüber entscheiden können, wie sie ihre Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs organisieren; sieht aber in der Einführung von zu niedrigen Höchstgrenzen für die Direktvergabe eine dramatische Einschränkung des Grundsatzes der Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften; |
|
— |
begrüßt die Stärkung der Rolle des Infrastrukturbetreibers sowie die Einsetzung von Koordinierungsausschüssen, die die Aktivitäten dieses in seiner Rolle gestärkten Infrastrukturbetreibers überwachen und für ein insgesamt effizientes System sorgen. Die lokalen Gebietskörperschaften sollten hierbei systematisch eingebunden werden und nicht nur „gegebenenfalls“; |
|
— |
spricht sich für eine rasche Einrichtung eines europäischen Netzes von Infrastrukturbetreibern aus, das für das Funktionieren eines einheitlichen Eisenbahnraums und eine grenzübergreifende Abstimmung unerlässlich ist; |
|
— |
befürwortet die Stärkung der Rolle der europäischen Eisenbahnagentur, mit der insbesondere die technische Interoperabilität und die Harmonisierung der Sicherheitsverfahren gefördert werden sollen, um größere Probleme infolge der Abweichungen zwischen 26 nationalen Behörden zu vermeiden. |
|
Berichterstatter |
Pascal Mangin (FR/EVP), Mitglied des Regionalrates der Region Elsass |
|
Referenzdokumente |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: „Das vierte Eisenbahnpaket — Vollendung des einheitlichen europäischen Eisenbahnraums zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in der EU“ COM(2013) 25 final; Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates über gemeinsame Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen COM(2013) 26 final; Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 COM(2013) 27 final; Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste COM(2013) 28 final; Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums bezüglich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur COM(2013) 29 final; Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (Neufassung) COM(2013) 30 final; Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Eisenbahnsicherheit (Neufassung) COM(2013) 31 final; Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Fortschritte im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems COM(2013) 32 final; Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über das Profil und die Aufgaben des anderen Zugpersonals COM(2013) 33 final; Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Durchführung der Bestimmungen der Richtlinie 2007/58/EG zur Öffnung des Marktes für grenzüberschreitende Schienenpersonenverkehrsdienste — Begleitunterlage zur Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament zum vierten Eisenbahnpaket COM(2013) 34 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
A. Gemeinwirtschaftliche verpflichtungen
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Allgemeine Bemerkungen
|
1. |
begrüßt die Bereitschaft der Europäischen Kommission, den für die Schaffung eines einheitlichen Eisenbahnraums erforderlichen Rechtsrahmen zu ergänzen; |
|
2. |
ruft seine bereits mehrfach, wie etwa zur „Ökologisierung des Verkehrssektors“ vertretene Auffassung in Erinnerung, dass eine der wichtigsten Zielsetzungen der europäischen Verkehrspolitik darin besteht, die Beförderung von Personen und den Transport von Waren, insbesondere den grenzüberschreitenden Güter- und Güterschwerverkehr, von der Straße auf die Schiene als umweltfreundlichstem Verkehrsträger zu verlagern, und die EU die Erreichung dieses Ziels durch geeignete Maßnahmen sicherstellen muss, wenn ausreichend freie Kapazitäten hierfür vorhanden sind; |
|
3. |
hält die Liberalisierung nicht für einen Selbstzweck, denn das Ziel muss darin bestehen, das Angebot und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. Die Öffnung für den Wettbewerb lässt sich nur beurteilen, wenn auch die Investitionen in die Infrastrukturen, die tatsächlichen Bedingungen, unter denen der Markt funktioniert, und die technischen Aspekte der Interoperabilität berücksichtigt werden; |
|
4. |
will einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der Verhältnismäßigkeit, Subsidiarität und die Kontrolle des Marktes durch starke Regulierungsbehörden miteinander verbindet. Der Ausschuss der Regionen befürwortet daher die von der Kommission eingeführten Bedingungen der Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Dienstleistungen und die Kontrolle der Regulierungsbehörden über die Verflechtung zwischen kommerziellen und öffentlichen Dienstleistungen; |
|
5. |
wünscht eine vollständige Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Ausarbeitung und Umsetzung der im Bereich der Schienenverkehrspolitik ergriffenen Maßnahmen, die unmittelbar die Nutzer und zuständigen Behörden selbst betreffen; |
|
6. |
ist der Ansicht, dass eine größere Effizienz des Eisenbahnsystems und insbesondere der öffentlichen Dienstleistungsaufträge den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften angesichts der starken haushalts- und finanzpolitischen Zwänge, denen sie unterliegen, zugutekommt; |
|
7. |
weist darauf hin, dass die lokalen Gebietskörperschaften dank des Grundsatzes der Selbstverwaltung frei darüber entscheiden können, wie sie ihre Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs organisieren. In diesem Sinne darf Artikel 5 Absatz 2 nicht in Frage gestellt werden, da er die Inanspruchnahme eines internen Betreibers ermöglicht; sieht aber in der Einführung von zu niedrigen Höchstgrenzen für die Direktvergabe eine dramatische Einschränkung des Grundsatzes der Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften; |
|
8. |
betont, dass der öffentliche Verkehr erschwinglich sein muss; |
Der Rechtsrahmen
Pläne für den öffentlichen Verkehr
|
9. |
fordert, dass die Pläne für den öffentlichen Verkehr den Betreibern und Nutzern aller Verkehrsträger eine ausreichende Sichtbarkeit und Sicherheit geben, um die Intermodalität zu fördern. Darin muss den Problemen sozialer und territorialer Zusammenhalt sowie nachhaltige Entwicklung Rechnung getragen werden; |
|
10. |
befürwortet die Forderung der Europäischen Kommission, dass sich die Pläne für den öffentlichen Verkehr auf alle Verkehrsträger erstrecken müssen. Sie müssen sich problemlos von den zuständigen lokalen Behörden anpassen lassen, da sie von diversen Veränderungen der Gegebenheiten beeinflusst werden können. Darüber hinaus ist eine wirksame grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, insbesondere über die EVTZ, zu fördern und zu gewährleisten, damit sie ihre Verkehrspläne für die einzelnen Verkehrsträger aufeinander abstimmen können; |
|
11. |
fordert, dass die den lokalen Gebietskörperschaften auferlegten Verpflichtungen bezüglich der Umsetzung der Verkehrspläne nicht zu übermäßigen organisatorischen und finanziellen Belastungen führen; |
Sozialer Rahmen
|
12. |
begrüßt die Verweise auf den sozialen Rahmen. Sie sollten allerdings genauer formuliert werden, um jegliche Gefahr des Sozialdumpings einzudämmen. Hingegen sollten sie kein Hindernis für eine größere Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsektors darstellen und der Förderung der Vielseitigkeit des Personals dienen; |
Methoden zur Auswahl der Dienstleister
|
13. |
stellt fest, dass die zuständigen Behörden mit der Vergabe der öffentlichen Dienstleistungsaufträge im Wege von Ausschreibungen bei gleicher oder höherer Qualität der Dienstleistungen unter bestimmten Bedingungen Effizienzgewinne und Einsparungen erzielen könnten; |
|
14. |
fordert jedoch, den zuständigen lokalen Behörden auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, frei zwischen einer Ausschreibung (teilweise oder vollständige Öffnung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags), Eigenregie und einer Direktvergabe zu wählen. Um Entgleisungen in Form von Monopolstellungen zu verhindern, muss die Direktvergabe strenger kontrolliert werden, insbesondere entsprechend Kriterien für die Qualität der Dienstleistungen und nicht nur für ihren Preis; für die Verkehrsaufgabenträger geht es darum, Preistransparenz für die erbrachten Dienstleistungen durch die Bestreitbarkeit der Märkte herzustellen; |
|
15. |
unterstreicht, dass im Rahmen eines flexiblen Ansatzes für die Auswahl des Verkehrsdienstleisters durch die zuständigen lokalen Gebietskörperschaften, darunter die Regionen, dem Entwicklungsstand der Regionalverkehrsmärkte in den einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen ist; |
|
16. |
fragt sich angesichts der Tatsache, dass bei bestimmten Ausschreibungen nur ein äußerst geringer Wettbewerb festzustellen ist, inwieweit ein Wettbewerb effektiv gegeben ist. Er fordert die Kommission auf, die Kriterien für eine wahrhaft wettbewerbliche Vergabe klarzustellen, indem sie sich insbesondere auf die durch die Beantwortung der eingereichten Angebote entstehenden Verwaltungskosten und die Laufzeit der von den zuständigen Behörden angebotenen Aufträge stützt; |
|
17. |
fordert nachdrücklich, dass die Schienenverkehrsbetreiber, die bereits öffentliche Dienstleistungen erbracht haben, auch für die Richtigkeit der im Rahmen der Ausschreibungen zum Zweck der Verlängerung oder Übertragung eines Dienstleistungsauftrags unter Beachtung der Vertraulichkeit von Geschäftsvorgängen gemachten Angaben haften; |
Zugang zum Markt für Rollmaterial
|
18. |
erkennt an, dass der Erwerb von Rollmaterial ein Markteintrittshindernis sein kann; |
|
19. |
will keine Methode ausschließen, um die Abdeckung des Restwertrisikos dieses Rollmaterials zu gewährleisten; |
Staatliche Beihilfen
|
20. |
weist auf die Ankündigung des Parlaments und des Rats hin, dass sie eine Streichung von Artikel 9 der hier in Rede stehenden Verordnung ablehnen würden; |
|
21. |
pflichtet angesichts der Besonderheiten des Verkehrssektors dem Parlament und dem Rat darin bei, die Pflicht einer systematischen Meldung aller Zuschüsse zu den Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs abzulehnen; |
B. Marktöffnung und verwaltung
|
22. |
unterstützt — sofern die Bedingungen für einen fairen und transparenten Wettbewerb für alle europäischen Eisenbahnunternehmen sowie ein wettbewerbsverzerrungsfreier Markt absolut garantiert sind — einen gewissen Freiraum für die Mitgliedstaaten zwischen dem Modell der Trennung und dem Modell integrierter Unternehmen bei der Organisation und Entwicklung ihres Eisenbahnsystems; |
|
23. |
begrüßt die Stärkung der Rolle des Infrastrukturbetreibers in dem Anliegen der Rationalisierung des Eisenbahnsystems. Der Infrastrukturbetreiber muss eine zentrale Anlaufstelle für den Zugang zum Schienenverkehrsnetz bieten, insbesondere den für Verkehr zuständigen Behörden. Daher sollte sein Verwaltungs- oder Aufsichtsrat ein Kollegium von Vertretern der regionalen Verkehrsbehörden umfassen; |
|
24. |
begrüßt die Einsetzung von Koordinierungsausschüssen, die die Aktivitäten dieses in seiner Rolle gestärkten Infrastrukturbetreibers überwachen und für ein insgesamt effizientes System sorgen. Die lokalen Gebietskörperschaften sollten hierbei systematisch eingebunden werden und nicht nur „gegebenenfalls“; |
|
25. |
fordert die Benennung von Ansprechpartnern beim Infrastrukturbetreiber für die Beziehungen zu den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften; |
|
26. |
weist darauf hin, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Subsidiaritätsprinzip anzuwenden sind, insbesondere wenn sich die Kommission neue Entscheidungsbefugnisse zuweisen möchte; |
|
27. |
spricht sich für eine rasche Einrichtung eines europäischen Netzes von Infrastrukturbetreibern aus, das für das Funktionieren eines einheitlichen Eisenbahnraums und eine grenzübergreifende Abstimmung unerlässlich ist; |
|
28. |
weist nachdrücklich auf die Rechenschaftspflicht der Bahnhofsbetreiber gegenüber den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hin: Die Bahnhöfe haben eine starke Hebelwirkung im Hinblick auf die Attraktivität der Regionen; |
|
29. |
weist darauf hin, dass die Liberalisierung kein Selbstzweck ist, da das Ziel darin bestehen muss, das Angebot und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. Allerdings gibt es in Europa noch zu wenige Erfahrungswerte über die Öffnung des Marktes für regionalen Personenzugverkehr für den Wettbewerb. Diese Öffnung sollte gefördert werden, wobei die öffentlichen Dienstleistungen unter dem Aspekt der Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Ausgewogenheit solcher Dienstleistungen zu schützen sind; |
|
30. |
betont, dass die geltenden Vorschriften beibehalten werden sollten, wonach Unternehmen, die als Betreiber der Infrastruktur oder Dienstleister für lokale Dienste auf einer spezifischen kleinen Schieneninfrastruktur tätig sind, ihre Tätigkeit nach den derzeitigen Bedingungen fortführen können. Eine solche lokale Infrastruktur darf eine Länge von 150 km nicht übersteigen; |
|
31. |
begrüßt die Verweise auf den sozialen Rahmen. Sie sollten allerdings genauer formuliert werden, um jegliche Gefahr des Sozialdumpings einzudämmen. Hingegen sollten sie kein Hindernis für eine größere Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsektors darstellen und der Förderung der Vielseitigkeit des Personals dienen; |
|
32. |
befürwortet die umfassenderen Befugnisse der Regulierungsstellen und spricht sich für eine Zusammenarbeit unter ihnen auf europäischer Ebene aus, insbesondere zur Beurteilung einer etwaigen Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Ausgewogenheit einer Dienstleistung. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften müssen außerdem über angemessene Fristen verfügen, um im Falle von Zweifeln an der Wahrung dieser Ausgewogenheit die Regulierungsstellen zu befassen; |
|
33. |
weist darauf hin, dass die Fahrscheinsysteme ebenso wesentlich für die Marktöffnung sind. In diesem Bereich ist eine bessere Koordinierung zwischen den Eisenbahnunternehmen und mit den zuständigen örtlichen und regionalen Behörden erforderlich; |
|
34. |
ist der Ansicht, dass die Pflicht der inländische Verkehrsdienste erbringenden Unternehmen, an einem das Angebot und die Fahrscheine (für den intermodalen Verkehr) betreffenden nationalen Informationssystem mitzuwirken, bindend sein sollte, da der Ausbau der damit zusammenhängenden Dienstleistungen ein wichtiger Faktor bei der Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs, insbesondere des Schienenverkehrs, ist; |
C. Der technische pfeiler
|
35. |
stimmt der Diagnose zu, die die Kommission in Bezug auf die Hauptprobleme und Grenzen des bestehenden europäischen Rechtsrahmens für den technischen Bereich gestellt hat; |
|
36. |
befürwortet die Stärkung der Rolle der europäischen Eisenbahnagentur mit Sitz in Valenciennes, mit der insbesondere die technische Interoperabilität und die Harmonisierung der Sicherheitsverfahren gefördert, die Einführung einer einzigen Genehmigung für die Inbetriebnahme von Fahrzeugen und zur Vermeidung bedeutender Probleme infolge der Abweichungen zwischen 26 nationalen Behörden die Befugnisse der europäischen Eisenbahnagentur gestärkt werden sollen. Fahrzeuge, die nur im Inland eingesetzt werden sollen, können weiterhin durch nationale Sicherheitsbehörden zugelassen werden; |
|
37. |
fordert jedoch eine Übergangsfrist bis die europäische Eisenbahnagentur voll funktionsfähig ist, um ihre neuen Aufgaben wahrnehmen zu können; |
|
38. |
befürwortet das von der Kommission festgelegte Ziel, die Zahl der nationalen Vorschriften zu reduzieren, indem hinfällige oder im Widerspruch zu EU-Rechtsvorschriften und den technischen Spezifikationen für die Interoperabilität stehende Vorschriften abgeschafft werden; |
|
39. |
begrüßt bestimmte Vorschläge der Europäischen Kommission in Bezug auf die Rolle der europäischen Eisenbahnagentur und die Schaffung einer Beschwerdestelle innerhalb der Agentur. Die Europäische Kommission schlägt vor, die Rolle der Agentur zu stärken und sie zu einer für die Fahrzeuge und die Sicherheitsbescheinigungen der Eisenbahnunternehmen zuständigen entscheidungsbefugten zentralen Anlaufstelle zu machen. Daher müssen die Befugnisse der Agentur, ihre (finanziellen und personellen) Ressourcen und ihre Zuständigkeit gestärkt und geklärt werden. Dasselbe gilt für die Beschwerdekammer; |
|
40. |
fordert, den Ausschuss der Regionen in die Ausarbeitung der Programme der Eisenbahnagentur einzubeziehen; |
|
41. |
ruft dazu auf, den Kosten-Nutzen-Analysen in Bezug auf die Maßnahmen zur Förderung der Interoperabilität und insbesondere ihre Auswirkung auf lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Rechnung zu tragen; |
II. EMPFEHLUNGEN FÜR ÄNDERUNGEN
Änderungsvorschlag 1
COM(2013) 28 final
Neuer Erwägungsgrund nach Erwägungsgrund 9
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Das Prinzip der Reziprozität ist ein wichtiges Mittel, um einer Wettbewerbsverzerrung entgegenzuwirken; dieses Prinzip sollte auf die Unternehmen aus Drittländern, die an Vergabeverfahren innerhalb der Union teilnehmen wollen, Anwendung finden. |
Begründung
Drittstaaten sollte nicht die Möglichkeit gegeben werden, am wettbewerblichen Vergabeverfahren in EU-Staaten teilzunehmen, solange sie ihren eigenen Markt nicht für EU-Mitgliedstaaten geöffnet haben.
Änderungsvorschlag 2
COM(2013) 28 final
Erwägungsgrund 15
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Für die Vorbereitung auf die obligatorische wettbewerbliche Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen benötigen Eisenbahnunternehmen, an die in der Vergangenheit solche Aufträge direkt vergeben wurden, zusätzlich Zeit für eine wirkungsvolle, nachhaltige interne Umstrukturierung. Daher sind für Aufträge, die zwischen dem Inkrafttreten dieser Verordnung und dem 3. Dezember 2019 direkt vergeben werden, Übergangsmaßnahmen erforderlich. |
Für die Vorbereitung auf die obligatorische wettbewerbliche Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen benötigen Eisenbahnunternehmen, an die in der Vergangenheit solche Aufträge direkt vergeben wurden, zusätzlich Zeit für eine wirkungsvolle, nachhaltige interne Umstrukturierung. Daher sind für Aufträge, die zwischen dem Inkrafttreten dieser Verordnung und dem 3. Dezember 2019 direkt vergeben werden, Übergangsmaßnahmen erforderlich. |
Änderungsvorschlag 3
COM(2013) 28 final
Erwägungsgrund 18
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Im Zusammenhang mit den Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 994/98 (Ermächtigungsverordnung) hat die Kommission auch eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (COM(2012) 730/3) vorgeschlagen. Um den Ansatz für die Gruppenfreistellungsverordnungen im Bereich staatlicher Beihilfen zu harmonisieren und im Einklang mit den in Artikel 108 Absatz 4 und Artikel 109 AEUV vorgesehenen Verfahren sollten Beihilfen zur Koordinierung des Verkehrs oder zur Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen nach Artikel 93 AEUV in den Geltungsbereich der Ermächtigungsverordnung aufgenommen werden. |
Im Zusammenhang mit den Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 994/98 (Ermächtigungsverordnung) hat die Kommission auch eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (COM(2012) 730/3) vorgeschlagen. Um den Ansatz für die Gruppenfreistellungsverordnungen im Bereich staatlicher Beihilfen zu harmonisieren und im Einklang mit den in Artikel 108 Absatz 4 und Artikel 109 AEUV vorgesehenen Verfahren sollten Beihilfen zur Koordinierung des Verkehrs oder zur Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen nach Artikel 93 AEUV in den Geltungsbereich der Ermächtigungsverordnung aufgenommen werden. |
Begründung
Die Verlagerung des Grundsatzes der Befreiung von der Meldepflicht für Ausgleichszahlungen auf ein anderes Regelwerk würde die gesamte Logik der Verordnung über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verändern und ein großes Risiko der Rechtsunsicherheit für die öffentlichen Personenverkehrsdienste mit sich bringen.
Änderungsvorschlag 4
COM(2013) 28 final
Artikel 2, Buchstabe c)
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
„zuständige örtliche Behörde“ jede zuständige Behörde, deren geografischer Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt und die sich mit dem Verkehrsbedarf eines städtischen Ballungsraums oder eines ländlichen Bezirks befasst; |
„zuständige örtliche Behörde“ jede zuständige Behörde, deren geografischer Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats erstreckt und oder die sich mit dem Verkehrsbedarf einer Region oder eines städtischen Ballungsraums oder eines ländlichen Bezirks befasst, einschließlich auf grenzüberschreitender Ebene; |
Begründung
Die in der französischen Fassung verwendete Formulierung „n'est pas nationale“ kann zweierlei Bedeutung haben: der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet oder es wird eine zuständige lokale Behörde bezeichnet, die sich auf dem Staatsgebiet zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten befindet. Die Definition muss klarer formuliert werden, um der Entstehung von Verkehrsbehörden mit grenzübergreifenden Zuständigkeiten Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus muss sich die vorliegende Verordnung eindeutig auch auf die Regionen erstrecken.
Änderungsvorschlag 5
COM(2013) 28 final
Artikel 2 Buchstabe e)
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||
|
Der Anwendungsbereich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen schließt sämtliche öffentlichen Verkehrsdienste aus, die über das hinausgehen, was erforderlich ist, um lokale, regionale oder subnationale Netzeffekte auszuschöpfen. |
|
Begründung
Wenn bei einer regionalen Eisenbahnstrecke ein wirtschaftliches Gleichgewicht erzielt oder Gewinne erwirtschaftet werden, muss sie im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags mit Strecken zusammengelegt werden können, bei denen Verluste eingefahren werden, damit ihre Gewinne zur Finanzierung Letzterer beitragen können und gegebenenfalls die für den Betrieb erforderlichen technischen Mittel optimiert werden können.
Änderungsvorschlag 6
COM(2013) 28 final
Artikel 2 a Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
1. Die zuständigen Behörden stellen für das Gebiet, für das sie zuständig sind, Pläne für den öffentlichen Personenverkehr auf, die sich auf sämtliche relevanten Verkehrsträger erstrecken, und aktualisieren diese regelmäßig. |
1. Die zuständigen Behörden stellen für das Gebiet, für das sie zuständig sind, Pläne für den öffentlichen Personenverkehr auf, die sich auf sämtliche relevanten Verkehrsträger erstrecken, und aktualisieren diese regelmäßig. Diese Verpflichtungen gelten ausschließlich für Ballungsgebiete mit mehr als 100 000 Einwohnern. |
||||
|
In diesen Plänen für den öffentlichen Verkehr werden die Ziele der Politik auf dem Gebiet des öffentlichen Verkehrs und die Mittel zu ihrer Umsetzung festgelegt, die sich für das Gebiet, für das sie zuständig sind, auf sämtliche relevanten Verkehrsträger erstrecken. Sie enthalten zumindest Folgendes: |
In diesen Plänen für den öffentlichen Verkehr werden die Ziele der Politik auf dem Gebiet des öffentlichen Verkehrs und die Mittel zu ihrer Umsetzung festgelegt, die sich für das Gebiet, für das sie zuständig sind, auf sämtliche relevanten Verkehrsträger erstrecken. Sie enthalten zumindest Folgendes: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
Bei der Aufstellung der Pläne für den öffentlichen Verkehr achten die zuständigen Behörden insbesondere auf die geltenden Regeln auf dem Gebiet der Fahrgastrechte sowie des Sozial-, Beschäftigungs- und Umweltschutzes. |
Bei der Aufstellung der Pläne für den öffentlichen Verkehr achten die zuständigen Behörden insbesondere auf die geltenden Regeln auf dem Gebiet der Fahrgastrechte sowie des Sozial-, Beschäftigungs- und Umweltschutzes, um jeglichem Dumping in den verschiedenen Bereichen vorzubeugen. |
||||
|
|
Die Pläne für den öffentlichen Verkehr müssen einen Monat vor ihrer Veröffentlichung der Regulierungsstelle zur Stellungnahme vorgelegt werden. |
||||
|
|
Die zuständigen Behörden arbeiten zusammen, um die in ihren jeweiligen Verkehrsplänen enthaltenen Informationen aufeinander abzustimmen, und stellen gemeinsame Verkehrspläne für die regionalen grenzüberschreitenden Verkehrsdienste auf. |
||||
|
Die zuständigen Behörden beschließen die Pläne für den öffentlichen Verkehr nach Konsultation der relevanten Interessenträger und veröffentlichen sie. Für die Zwecke dieser Verordnung sind zu berücksichtigende relevante Interessenträger zumindest die Verkehrsunternehmen, gegebenenfalls die Infrastrukturbetreiber sowie repräsentative Fahrgastvereinigungen und Arbeitnehmerverbände. |
Die zuständigen Behörden beschließen die Pläne für den öffentlichen Verkehr nach Konsultation der relevanten Interessenträger und veröffentlichen sie. Für die Zwecke dieser Verordnung sind zu berücksichtigende relevante Interessenträger zumindest die Verkehrsunternehmen, gegebenenfalls die Infrastrukturbetreiber sowie repräsentative Fahrgastvereinigungen und Arbeitnehmerverbände. |
||||
|
|
Die früheren bzw. bestehenden öffentlichen Dienstleister sind gehalten, den zuständigen Behörden auf Antrag innerhalb einer Frist von einem Monat die erforderlichen Daten zu übermitteln, selbst wenn es sich um Behörden eines Nachbarstaats handelt. |
Begründung
Die ÖPV-Pläne können schwere zusätzliche Verpflichtungen bedeuten, indes ohne Wirkung für die im Rahmen der Raumordnung vereinbarten Hauptstreckenzüge. Mit dem Änderungsvorschlag wird angeregt, diese Verpflichtung auf Ballungsgebiete einer bestimmten Größe zu begrenzen.
Angesichts der Komplexität und Volatilität (die sich der Kontrolle der zuständigen Behörden entzieht) der verkehrsmäßigen Bedienung ist es wirklichkeitsnäher, Verkehrsbedienungsgrundsätze in einem Verkehrsplan festzulegen.
Bei weniger stark befahrenen Strecken könnte sich die Verpflichtung zu einer Mindestnutzung negativ auf die betreffende öffentliche Dienstleistung auswirken und würde folglich dem Interesse der zuständigen Behörde zuwiderlaufen.
Intermodalität und grenzübergreifende Koordination müssen gefördert werden.
Für die Pläne für den öffentlichen Verkehr sind genaue Daten über die Entwicklung der Märkte für die einzelnen Verkehrsträger erforderlich. Die Marktteilnehmer verfügen über die wichtigsten Informationsquellen und müssen die betreffenden Informationen mit der betreffenden Behörde teilen.
Änderungsvorschlag 7
COM(2013) 28 final
Artikel 2a, Ziffer 4
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
Die Spezifikationen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die entsprechende Ausgleichsleistung für finanzielle Nettoauswirkungen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen müssen |
Die Spezifikationen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die entsprechende Ausgleichsleistung für finanzielle Nettoauswirkungen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen müssen |
||||
|
|
Änderungsvorschlag 8
COM(2013) 28 final
Artikel 4 Absatz 8
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
8. Die zuständigen Behörden stellen allen interessierten Parteien relevante Informationen für die Vorbereitung eines Angebots im Rahmen eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens zur Verfügung. |
8. Die zuständigen Behörden stellen allen interessierten Parteien relevante Informationen für die Vorbereitung eines Angebots im Rahmen eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens zur Verfügung. |
|
|
Die Infrastrukturbetreiber, die Schienenverkehrsbetreiber, die den öffentlichen Dienstleistungsauftrag ausführen bzw. ausgeführt haben, müssen den zuständigen Behörden dabei behilflich sein, alle sachdienlichen Angaben zu machen. Sie sind verantwortlich für die Richtigkeit der der zuständigen Behörde übermittelten Daten. |
|
Dazu gehören Informationen über Fahrgastnachfrage, Tarife, Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit den öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die Gegenstand der Ausschreibung sind, sowie Einzelheiten der Infrastrukturspezifikationen, die für den Betrieb der erforderlichen Fahrzeuge bzw. des erforderlichen Rollmaterials relevant sind, um ihnen die Abfassung fundierter Geschäftspläne zu ermöglichen. Schieneninfrastrukturbetreiber unterstützen die zuständigen Behörden bei der Bereitstellung aller einschlägigen Infrastrukturspezifikationen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen ist Gegenstand einer rechtlichen Überprüfung im Sinne von Artikel 5 Absatz 7. |
Dazu gehören Informationen über Fahrgastnachfrage, Tarife, Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit den öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die Gegenstand der Ausschreibung sind, sowie Einzelheiten der Infrastrukturspezifikationen, die für den Betrieb der erforderlichen Fahrzeuge bzw. des erforderlichen Rollmaterials relevant sind, um ihnen die Abfassung fundierter Geschäftspläne zu ermöglichen. Schieneninfrastrukturbetreiber unterstützen die zuständigen Behörden bei der Bereitstellung aller einschlägigen Infrastrukturspezifikationen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen ist Gegenstand einer rechtlichen Überprüfung im Sinne von Artikel 5 Absatz 7. |
|
|
Der derzeitige Betreiber einer Strecke bzw. eines Netzes, die Gegenstand einer Ausschreibung gemäß dem wettbewerblichen Vergabeverfahren sind, übermittelt der zuständigen Behörde unter Beachtung der Vertraulichkeit von Geschäftsvorgängen unentgeltlich, vollständig und genau die für die Vorbereitung eines Angebots erforderlichen Angaben insbesondere über die Verkehrsnachfrage und die mit der Personenbeförderung erzielten Einnahmen. |
|
|
Der frühere Schienenverkehrsbetreiber und der Infrastrukturbetreiber erstatten den anderen Betreibern jedweden Verlust, der diesen bei auf falschen oder fehlenden Angaben beruhenden Angebotseinreichungen entsteht. |
Begründung
Die Angaben des Infrastrukturbetreibers reichen nicht aus, weil sie nicht die Handelsdaten des Schienenverkehrsdienstleisters beinhalten. Die früheren bzw. derzeitigen Dienstleister müssen entsprechende Angaben machen, insbesondere die etablierten Betreiber, um einen diskriminierungsfreien Zugang zur Information zu gewährleisten. Dieser Kohärenzansatz ist unverzichtbar, weil ansonsten auf die zuständigen Behörden Verpflichtungen zukommen, denen sie nicht nachkommen können.
Änderungsvorschlag 9
COM(2013) 28 final
Artikel 5, neuer Absatz nach Absatz 3
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Die zuständige Behörde kann Betreiber aus Drittländern von dem wettbewerblichen Vergabeverfahren ausschließen, wenn diese Drittländer kein wettbewerbliches Vergabeverfahren für Unternehmen aus den Mitgliedstaaten der Union vorsehen. |
Begründung
Drittstaaten sollte nicht die Möglichkeit gegeben werden, am wettbewerblichen Vergabeverfahren in EU-Staaten teilzunehmen, solange sie ihren eigenen Markt nicht für EU-Mitgliedstaaten geöffnet haben.
Änderungsvorschlag 10
COM(2013) 28 final
Artikel 5 Absatz 4
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
4. Sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist, können die zuständigen Behörden entscheiden, öffentliche Dienstleistungsaufträge direkt zu vergeben, wenn |
4. Sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist, können die zuständigen Behörden entscheiden, öffentliche Dienstleistungsaufträge direkt zu vergeben, wenn |
||||
|
|
||||
|
|
Begründung
Der von der Kommission vorgeschlagene Schwellenwert von 150 000 km für die jährliche öffentliche Personenschienenverkehrsleistung schließt de facto jeden Schienenverkehrsbetrieb aus, wo dieser Verkehrsträger Sinn machen würde. Ein Grenzwert von 500 000 km gestattet, die Ausnahme von der Regel der Auftragsvergabe im Wege der Ausschreibung auf Strecken einer für die Schiene sinnvollen Länge und einem für die Lebensfähigkeit der Schiene erforderlichen Dienstleistungsniveau.
Änderungsvorschlag 11
COM(2013) 28 final
Artikel 5 neuer Absatz nach Absatz 4
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Die Entscheidung über eine Direktvergabe von Dienstleistungsaufträgen wird der Regulierungsstelle gemäß Artikel 55 der Richtlinie 2012/34/EU innerhalb einer Frist von zwei Monaten zur Konsultation übermittelt. |
Begründung
Dieser neue Absatz ermöglicht die Beteiligung der zuständigen Regulierungsstelle an der Organisation des Schienenverkehrs, ohne dass dadurch die Befugnisse der örtlich zuständigen Behörden, Dienstleistungsaufträge direkt an interne Betreiber zu vergeben, beschnitten werden. Gleichzeitig werden in diesem Absatz die Bedingungen für die Direktvergabe von Dienstleistungsaufträgen spezifiziert, um Oligopolen vorzubeugen.
Änderungsvorschlag 12
COM(2013) 28 final
Artikel 5, neuer Absatz nach Absatz 6
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Soweit durch nationales Recht nicht untersagt, können die zuständigen Behörden entscheiden, Aufträge über öffentliche Eisenbahndienstleistungen direkt zu vergeben, ausgenommen andere schienengestützte Verkehrsträger wie U-Bahn oder Straßenbahn. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 3 ist die Laufzeit solcher Aufträge auf höchstens zehn Jahre begrenzt, sofern nicht Artikel 4 Absatz 4 anzuwenden ist. |
|
|
Wenn der Auftrag bereits Gegenstand einer Direktvergabe war und die Indikatoren für die Qualität der Dienstleistungen sich über die gesamte Laufzeit des Auftrags betrachtet aus Gründen, die der öffentliche Dienstleister zu verantworten hat, im Durchschnitt um mehr als 10% verschlechtern, ist dieser Auftrag bei Ablauf im Wege der Ausschreibung neu zu vergeben. Sechs Monate nach Erlassung der Verordnung legt die Kommission im Wege delegierter Rechtsakte anhand einer Reihe von Leistungsindikatoren einschließlich der Pünktlichkeit die zu erbringende Dienstleistungsqualität fest. |
Begründung
Es sollte die Möglichkeit der Direktvergabe wiederhergestellt werden, allerdings mit bestimmter zeitlicher Begrenzung. Wenn diese Vergabeform sich als nicht zufriedenstellend erweist, muss die zuständige Behörde automatisch wieder zur Vergabe im Wege der Ausschreibung übergehen.
Änderungsvorschlag 13
COM(2013) 28 final
Artikel 5a Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
Die zuständige Behörde kann die in Unterabsatz 1 enthaltene Anforderung auf eine der folgenden Arten erfüllen: |
Die zuständige Behörde kann die in Unterabsatz 1 enthaltene Anforderung auf eine der folgenden unterschiedliche, größenbedingten Kosteneinsparungen zuträgliche Arten erfüllen, wie z.B.: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Begründung
Es darf keine Finanzierungsmethode ausgeschlossen werden (Bürgschaft, Übernahme, Direktkauf usw.). Die Staaten dürfen sich jedoch auch nicht aus ihrer Verantwortung stehlen und die Belastung zu Unrecht auf die örtlichen Behörden abschieben. Der Rechts- und Regulierungsrahmen muss so gestaltet sein, dass der Markt für Rollmaterial angekurbelt wird, indem insbesondere größenbedingte Kosteneinsparungen und geeignete Finanzierungslösungen gefördert werden.
Änderungsvorschlag 14
COM(2013) 29 final
Artikel 8 Absatz 2a
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
2a. Öffentliche Dienstleistungsaufträge für den öffentlichen Schienenpersonenverkehr, die zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 2. Dezember 2019 direkt vergeben werden, können für ihre vorgesehene Laufzeit gültig bleiben. Sie dürfen jedoch keinesfalls nach dem 31. Dezember 2022 fortbestehen. |
2a. Öffentliche Dienstleistungsaufträge für den öffentlichen Schienenpersonenverkehr, die zwischen dem 1. Januar 2013 Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung und dem 2. Dezember 2019 direkt vergeben werden, können für ihre vorgesehene Laufzeit gültig bleiben. Sie dürfen jedoch keinesfalls nach dem 31. Dezember 2022 fortbestehen. Diese Bestimmung gilt nicht für vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung vergebene Aufträge. |
Begründung
Das Datum des Inkrafttretens der vorgeschlagenen Änderungen muss dem Datum des Inkrafttretens der überarbeiteten Verordnung entsprechen. Diese Bestimmung darf nicht für vor diesem Termin vergebene Aufträge gelten.
Änderungsvorschlag 15
COM(2013) 29 final
Erwägungsgrund 10
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Die geltenden Unabhängigkeitsanforderungen der Richtlinie 2012/34/EU erstrecken sich lediglich auf den rechtlichen und den organisatorischen Bereich sowie auf die Entscheidungsfindung. Der Fortbestand integrierter Unternehmen wird dadurch nicht völlig ausgeschlossen, sofern diese drei Unabhängigkeitsanforderungen erfüllt sind. Was die Unabhängigkeit in den Entscheidungen anbelangt, so muss durch geeignete Regelungen ausgeschlossen werden, dass ein integriertes Unternehmen Kontrolle über die Entscheidungen eines Infrastrukturbetreibers ausübt. Allerdings werden selbst bei vollständiger Anwendung solcher Regelungen nicht alle der in vertikal integrierten Unternehmen bestehenden Möglichkeiten zur Diskriminierung von Wettbewerbern beseitigt. Insbesondere besteht innerhalb integrierter Strukturen weiterhin die Möglichkeit der Quersubventionierung; zumindest aber ist es für die Regulierungsstellen äußerst schwierig, zur Unterbindung solcher Quersubventionierungen geschaffene Regelungen zu überwachen und durchzusetzen. Eine institutionelle Trennung zwischen Infrastrukturbetrieb und Verkehrsleistungen ist die wirksamste Maßnahme zur Lösung dieser Probleme. |
Die geltenden Unabhängigkeitsanforderungen der Richtlinie 2012/34/EU erstrecken sich lediglich auf den rechtlichen und den organisatorischen Bereich sowie auf die Entscheidungsfindung. Der Fortbestand integrierter Unternehmen wird dadurch nicht völlig ausgeschlossen, sofern diese drei Unabhängigkeitsanforderungen die gegenseitige Unabhängigkeit des Verkehrsunternehmens und des Infrastrukturbetreibers bei den wesentlichen Funktionen, d.h. den Entscheidungen über die Zuweisung von Zugtrassen und die Erhebung von Wegeentgelten, die Bahnhöfe, Investitionen und die Instandhaltung, aufrechterhalten bleibt erfüllt sind. Was die Unabhängigkeit in den Entscheidungen anbelangt, so muss durch geeignete Regelungen ausgeschlossen werden, dass ein integriertes Unternehmen Kontrolle über die Entscheidungen eines Infrastrukturbetreibers ausübt. Allerdings werden selbst bei vollständiger Anwendung solcher Regelungen nicht alle der in vertikal integrierten Unternehmen bestehenden Möglichkeiten zur Diskriminierung von Wettbewerbern beseitigt. Insbesondere besteht innerhalb integrierter Strukturen weiterhin die Möglichkeit der Quersubventionierung; zumindest aber ist es für die Regulierungsstellen äußerst schwierig, zur Unterbindung solcher Quersubventionierungen geschaffene Regelungen zu überwachen und durchzusetzen. Eine institutionelle Trennung zwischen Infrastrukturbetrieb und Verkehrsleistungen ist die wirksamste Maßnahme zur Lösung dieser Probleme. |
Begründung
Die Kommission geht von der ideologischen Vorstellung aus, dass die völlige Trennung der Tätigkeiten die beste Lösung ist. Eine solche Herangehensweise gehört nicht in einen Richtlinienentwurf, der neutral bleiben muss.
Änderungsvorschlag 16
COM(2013) 29 final
Artikel 6 Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Die Europäische Kommission schlägt vor, Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU zu streichen. |
Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU wird beibehalten bzw. wie folgt geändert: |
|
|
Um unverhältnismäßig hohe Kosten zu vermeiden, können d Die Mitgliedstaaten können ferner vorschreiben, dass unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen weniger als 3 000 Beschäftigte hat und sich seine Tätigkeiten auf den Nahverkehr und eine Infrastruktur mit einer Länge von weniger als 150 km beschränken, mit Blick auf diese Trennung innerhalb desselben Unternehmens voneinander getrennte Unternehmensbereiche eingerichtet oder dass der Infrastrukturbetrieb und der Verkehrsbetrieb von getrennten Körperschaften geführt werden. |
Begründung
In Bezug auf die institutionelle Trennung der Betreibung der Infrastruktur von der Erbringung der Verkehrsdienstleistungen wird empfohlen, für Dienstleister, die lediglich regionale Dienste erbringen, die derzeit geltenden Bestimmungen beizubehalten. Es muss nämlich berücksichtigt werden, dass diese institutionelle Trennung bei kleinen Unternehmen, die Dienstleistungen auf einer spezifischen Infrastruktur erbringen, zu einer erheblichen Fragmentierung dieser Dienstleister und zu einem Anstieg der Betriebskosten und damit der von der öffentlichen Hand gezahlten Ausgleichsentgelte führen könnte.
Änderungsvorschlag 17
COM(2013) 29 final
Artikel 7 Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Infrastrukturbetreiber sämtliche in Artikel 3 Absatz 2 genannten Funktionen ausübt und von jeglichem Eisenbahnunternehmen unabhängig ist. |
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Infrastrukturbetreiber sämtliche in Artikel 3 Absatz 2 genannten Funktionen ausübt und von jeglichem Eisenbahnunternehmen unabhängig ist, was die wesentlichen Funktionen, d.h. die Entscheidungen über die Zuweisung von Zugtrassen und die Erhebung von Wegeentgelten, die Bahnhöfe, Investitionen und die Instandhaltung, betrifft. Um die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers zu garantieren, stellen können sich die Mitgliedstaaten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip eigenständig organisieren sicher, dass die Infrastrukturbetreiber innerhalb einer von jeglichem Eisenbahnunternehmen rechtlich getrennten Einheit eingerichtet sind. |
|
Um die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers zu garantieren, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Infrastrukturbetreiber innerhalb einer von jeglichem Eisenbahnunternehmen rechtlich getrennten Einheit eingerichtet sind. |
|
Änderungsvorschlag 18
COM(2013) 29 final
Artikel 7 Absatz 5
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Ist der Infrastrukturbetreiber bei Inkrafttreten dieser Richtlinie Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so können die Mitgliedstaaten beschließen, von der Anwendung der Absätze 2 bis 4 abzusehen. In diesem Fall stellt der betreffende Mitgliedstaat sicher, dass der Infrastrukturbetreiber die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Aufgaben wahrnimmt und organisatorisch sowie in seinen Entscheidungen gemäß den Anforderungen der Artikel 7a bis 7c von Eisenbahnunternehmen unabhängig ist. |
Ist der Infrastrukturbetreiber bei Inkrafttreten dieser Richtlinie Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so können d Die Mitgliedstaaten können beschließen, von der Anwendung der Absätze 2 bis 4 abzusehen. In diesem Fall stellt der betreffende Mitgliedstaat sicher, dass der Infrastrukturbetreiber die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Aufgaben wahrnimmt und organisatorisch sowie in seinen Entscheidungen gemäß den Anforderungen der Artikel 7a bis 7c von Eisenbahnunternehmen unabhängig ist. |
Begründung
Hiermit wird unabhängig von der Situation zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie die Rückkehr zu einem integrierten Modell ermöglicht.
Änderungsvorschlag 19
COM(2013) 29 final
Artikel 7b Absatz 3
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Der Infrastrukturbetreiber verfügt über einen Aufsichtsrat, der sich aus Vertretern der Endeigentümer des vertikal integrierten Unternehmens zusammensetzt. |
Der Infrastrukturbetreiber verfügt über einen Aufsichtsrat, der sich aus Vertretern der Endeigentümer des vertikal integrierten Unternehmens und Vertretern der zuständigen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, soweit diese dort nicht schon vertreten sind, zusammensetzt. |
|
[…] |
[…] |
Begründung
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind wesentliche Akteure des Eisenbahnsystems. Aus diesem Grunde sind sie in die Entscheidungs- und Kontrollgremien des Infrastrukturbetreibers einzubeziehen, der ja eine natürliche Monopolstellung hat. Die Gebietskörperschaften sind das Bindeglied zwischen Betreibern und Endkunden, deren Bedürfnisse sie gut kennen.
Änderungsvorschlag 20
COM(2013) 29 final
Artikel 7b Absatz 5
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Der Transfer von anderen als den unter Buchstabe c genannten Mitarbeitern zwischen dem Infrastrukturbetreiber und den übrigen rechtlichen Einheiten des vertikal integrierten Unternehmens ist nur möglich, wenn sichergestellt werden kann, dass keine sensiblen Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden. |
Der Transfer von anderen als den unter Buchstabe c genannten Mitarbeitern zwischen dem Infrastrukturbetreiber und den übrigen rechtlichen Einheiten des vertikal integrierten Unternehmens ist nur möglich, wenn sichergestellt werden kann, dass keine sensiblen Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden. Die betreffenden Mitarbeiter sind jedoch gemäß den Gepflogenheiten des Handelsrechts zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse aus ihren früheren Tätigkeiten verpflichtet. |
Begründung
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes: Der Begriff sensibler Informationen ist zu ungenau und deshalb kein Hinderungsgrund für eine interne Mobilität innerhalb von Bahnkonzernen. Karenzzeiten und andere bestehende Informationsbarrieren reichen aus, um das Durchsickern sensibler Informationen zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften ein und desselben Bahnkonzerns zu verhindern. Die betreffenden Mitarbeiter unterliegen der Pflicht zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse, wie das im Handelsrecht Brauch ist.
Änderungsvorschlag 21
COM(2013) 29 final
Artikel 7 b, neuer Absatz nach Absatz 7
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Die Europäische Kommission erlässt vor dem 1. Januar 2019 genaue Bestimmungen über mobile Arbeitnehmer, um Praktiken wie Dumping und Lohnwettbewerb vorzubeugen, und strebt dazu ein spezifisches Zertifizierungsverfahren für die Mitarbeiter des Zugpersonals an. |
Begründung
Praktiken wie Dumping und Lohnwettbewerb, die im Straßen- und Seeverkehr festgestellt wurden, müssen im Eisenbahnsektor verhindert werden.
Änderungsvorschlag 22
COM(2013) 29 final
Artikel 7 c Absätze 3 und 4
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung |
Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung |
||||
|
1. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative stellt die Kommission fest, ob Infrastrukturbetreiber,die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind, die Anforderungen der Artikel 7a und Artikel 7b erfüllen und dadurch hinreichend gewährleistet ist, dass für alle Eisenbahnunternehmen die gleichen Bedingungen gelten und der Wettbewerb in dem betreffenden Markt nicht verzerrt wird. |
1. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative stellt die Kommission fest, ob Infrastrukturbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind , die Anforderungen der Artikel 7 , 7a und Artikel 7b erfüllen und dadurch hinreichend gewährleistet ist, dass für alle Eisenbahnunternehmen die gleichen Bedingungen gelten und der Wettbewerb in dem betreffenden Markt nicht verzerrt wird. |
||||
|
2. Die Kommission ist befugt, von dem Mitgliedstaat, in dem das vertikal integrierte Unternehmen niedergelassen ist, innerhalb einer vertretbaren Frist alle notwendigen Auskünfte zu verlangen. Die Kommission konsultiert die betreffende(n) Regulierungsstelle(n) und gegebenenfalls das in Artikel 57 genannte Netzwerk der Regulierungsstellen. |
2. Die Kommission ist befugt, von dem jeweiligen Mitgliedstaat, in dem das vertikal integrierte Unternehmen niedergelassen ist , innerhalb einer vertretbaren Frist alle notwendigen Auskünfte zu verlangen. Die Kommission konsultiert die betreffende(n) Regulierungsstelle(n), die jeweils zuständigen Behörden und gegebenenfalls das in Artikel 57 genannte Netzwerk der Regulierungsstellen. |
||||
|
3. Die Mitgliedstaaten können Eisenbahnunternehmen, die Teil des vertikal integrierten Unternehmens sind, zu dem der Infrastrukturbetreiber gehört, die Zugangsrechte nach Artikel 10 beschränken, wenn die Kommission den Mitgliedstaaten mitteilt, dass kein Antrag gemäß Absatz 1 gestellt wurde, oder bis zur Prüfung eines solchen Antrags durch die Kommission, oder wenn die Kommission einen Beschluss gemäß dem Verfahren nach Artikel 62 Absatz 2 gefasst hat, wonach |
3. Die Mitgliedstaaten können Eisenbahnunternehmen, die Teil des vertikal integrierten Unternehmens sind, zu dem der Infrastrukturbetreiber gehört , die Zugangsrechte nach Artikel 10 beschränken, wenn die Kommission den Mitgliedstaaten mitteilt, dass kein Antrag gemäß Absatz 1 gestellt wurde, oder bis zur Prüfung eines solchen Antrags durch die Kommission, oder wenn die Kommission einen Beschluss gemäß dem Verfahren nach Artikel 62 Absatz 2 gefasst hat, wonach: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Die Kommission beschließt innerhalb eines angemessenen Zeitraums. |
Die Kommission beschließt innerhalb eines angemessenen Zeitraums von 30 Arbeitstagen. |
||||
|
4. Der betreffende Mitgliedstaat kann die Kommission ersuchen, ihren in Absatz 3 genannten Beschluss gemäß dem Verfahren nach Artikel 62 Absatz 2 aufzuheben, wenn der Mitgliedstaat der Kommission nachweist, dass die Gründe für den Beschluss nicht mehr gegeben sind. Die Kommission beschließt innerhalb eines angemessenen Zeitraums. |
4. Der betreffende Mitgliedstaat kann die Kommission ersuchen, ihren in Absatz 3 genannten Beschluss gemäß dem Verfahren nach Artikel 62 Absatz 2 aufzuheben, wenn der Mitgliedstaat der Kommission nachweist, dass die Gründe für den Beschluss nicht mehr gegeben sind. Die Kommission beschließt innerhalb eines angemessenen Zeitraums von 30 Arbeitstagen. |
||||
|
5. Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 wird die Erfüllung der Anforderungen der Artikel 7a und 7b von der in Artikel 55 genannten Regulierungsstelle laufend überwacht. Jeder Antragsteller hat das Recht, die Regulierungsstelle zu befassen, wenn er der Auffassung ist, dass diese Anforderungen nicht erfüllt werden. Bei Beschwerden dieser Art entscheidet die Regulierungsstelle innerhalb der in Artikel 56 Absatz 9 genannten Fristen über die notwendigen Abhilfemaßnahmen |
5. Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 wird die Erfüllung der Anforderungen der Artikel 7 , 7a und 7b von der in Artikel 55 genannten Regulierungsstelle laufend überwacht. Jeder Antragsteller hat das Recht, die Regulierungsstelle zu befassen, wenn er der Auffassung ist, dass diese Anforderungen nicht erfüllt werden. Bei Beschwerden dieser Art entscheidet die Regulierungsstelle innerhalb der in Artikel 56 Absatz 9 genannten Fristen über die notwendigen Abhilfemaßnahmen. |
Begründung
Die Kommission diskriminiert die vertikal integrierten Unternehmen. Die von der Kommission durchgeführten Kontrollen sollten bei den integrierten Unternehmen den gleichen Umfang haben wie bei den getrennten Unternehmen. Die Kommission ist wie jede Aufsichtsbehörde auf genaue Fristen angewiesen, um die Rechtssicherheit für alle Akteure zu gewährleisten.
Änderungsvorschlag 23
COM(2013) 29 final
Artikel 7 d Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Koordinierungsausschuss |
Koordinierungsausschuss |
|
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Infrastrukturbetreiber für jedes Netz einen Koordinierungsausschuss einsetzen und verwalten. Die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss steht mindestens dem Infrastrukturbetreiber, bekannten Antragstellern im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 und — auf deren Antrag — potenziellen Antragstellern, ihren Vertretungsorganisationen, Vertretern der Nutzer von Schienengüter- und -personenverkehrsdiensten sowie gegebenenfalls regionalen und kommunalen Behörden offen. Vertreter des Mitgliedstaats und die betreffende Regulierungsstelle werden als Beobachter zu den Sitzungen des Koordinierungsausschusses eingeladen. |
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Infrastrukturbetreiber für jedes — nationale, regionale oder lokale — Netz einen Koordinierungsausschuss einsetzen und verwalten. Die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss steht mindestens dem Infrastrukturbetreiber, bekannten Antragstellern im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 und — auf deren Antrag — potenziellen Antragstellern, ihren Vertretungsorganisationen, Vertretern der Nutzer von Schienengüter- und -personenverkehrsdiensten sowie gegebenenfalls den jeweiligen regionalen und kommunalen Behörden offen. Vertreter des Mitgliedstaats und die betreffende Regulierungsstelle werden als Beobachter zu den Sitzungen des Koordinierungsausschusses eingeladen. |
Begründung
Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sind wichtige Akteure der Verkehrspolitik und müssen als solche dem Koordinierungsausschuss unbedingt angehören.
Änderungsvorschlag 24
COM(2013) 29 final
Artikel 7 Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Europäisches Netz der Infrastrukturbetreiber |
Europäisches Netz der Infrastrukturbetreiber |
|
1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Infrastrukturbetreiber in einem Netzwerk für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in der Union mitwirken und zusammenarbeiten, um insbesondere die zeitnahe und effiziente Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes, einschließlich der Kernnetzkorridore, der Güterverkehrskorridore im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und des in dem Beschluss 2012/88/EU aufgestellten Bereitstellungsplans für das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS), sicherzustellen. |
1. Die Mitgliedstaaten verlangen innerhalb von zwei Jahren nach Umsetzung dieser Richtlinie sorgen dafür, dass die Infrastrukturbetreiber in einem Netzwerk für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in der Union mitwirken und zusammenarbeiten, um insbesondere die zeitnahe und effiziente Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes, einschließlich der Kernnetzkorridore, der Güterverkehrskorridore im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 201011/2010 und des in dem Beschluss 2012/88/EU aufgestellten Bereitstellungsplans für das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS), sowie die Effizienz der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Eisenbahnverkehr sicherzustellen. |
|
Die Kommission ist Mitglied des Netzwerks. Sie koordiniert und unterstützt die Arbeit des Netzwerks und unterbreitet ihm gegebenenfalls Empfehlungen. Sie sorgt dafür, dass die betreffenden Infrastrukturbetreiber aktiv zusammenarbeiten. |
Die Kommission ist Mitglied des Netzwerks. Sie koordiniert und unterstützt die Arbeit des Netzwerks und unterbreitet ihm gegebenenfalls Empfehlungen. Sie sorgt dafür, dass die betreffenden Infrastrukturbetreiber aktiv zusammenarbeiten. Sie berichtet dem Ausschuss der Regionen und dem Netz der in Artikel 57 Absatz 1 genannten Regulierungsstellen über die Fortschritte dieses Netzwerks. |
Begründung
Das Netzwerk europäischer Infrastrukturbetreiber bietet die Möglichkeit, die grenzüberschreitenden Probleme operativer Art auf der richtigen Ebene anzugehen. Die lokalen Gebietskörperschaften müssen dabei einbezogen werden. Darüber hinaus muss das Netz der Regulierungsbehörden über die Entwicklungen des Netzes der Infrastrukturbetreiber unterrichtet werden.
Änderungsvorschlag 25
COM(2013) 29 final
Neuer Artikel nach Artikel 7 d
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Der Infrastrukturbetreiber benennt aus seinen Reihen einen Vertreter, der für die Beziehungen zu den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zuständig ist. Dieser Vertreter muss in der Lage sein, Anfragen einer lokalen oder regionalen Gebietskörperschaft binnen fünf Tagen im Namen des Infrastrukturbetreibers zu beantworten. |
Begründung
Die Stärkung der Zuständigkeiten der Infrastrukturbetreiber muss mit mehr Verantwortung für sie auf internationaler Ebene durch das Netz der Infrastrukturbetreiber aber auch auf lokaler Ebene einhergehen. Als eine Art zentrale Anlaufstelle muss der Ansprechpartner für die lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften in der Lage sein, deren Anfragen schnell zu beantworten.
Änderungsvorschlag 26
COM(2013) 29 final
Artikel 10, neuer Absatz nach Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Um einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Bahnhöfen zu gewährleisten, stellen die Bahnhofs- und Bahnsteigbetreiber online ein Beschwerdeformular für die Unternehmen und alle Bewerber zur Verfügung. Die Regulierungsstellen und die jeweils zuständigen Behörden erhalten einen Jahresbericht über diese Beschwerden. |
Begründung
Der diskriminierungsfreie Zugang muss regelmäßig evaluiert werden können, insbesondere durch die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, denen ein hochwertiges Verkehrsangebot für die Benutzer ein wichtiges Anliegen ist.
Änderungsvorschlag 27
COM(2013) 29 final
Artikel 11 Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
Die Frage, ob das wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährdet würde, wird von der/den in Artikel 55 genannten Regulierungsstelle(n) anhand einer objektiven wirtschaftlichen Analyse auf der Grundlage vorab festgelegter Kriterien beurteilt. Die Beurteilung erfolgt, nachdem einer oder mehrere der nachstehend aufgeführten Beteiligten innerhalb eines Monats nach der gemäß Artikel 38 Absatz 4 erfolgten Unterrichtung über den geplanten Personenverkehrsdienst einen entsprechenden Antrag gestellt haben: |
Die Frage, ob das wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährdet würde, wird von der/den in Artikel 55 genannten Regulierungsstelle(n) anhand einer objektiven wirtschaftlichen Analyse auf der Grundlage vorab festgelegter Kriterien beurteilt. Die Beurteilung erfolgt, nachdem einer oder mehrere der nachstehend aufgeführten Beteiligten innerhalb eines Monats von zwei Monaten nach der gemäß Artikel 38 Absatz 4 erfolgten Unterrichtung über den geplanten Personenverkehrsdienst einen entsprechenden Antrag gestellt haben: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Begründung
Die Frist von einem Monat für Einwände gegen einen neuen Verkehrsdienst, der das wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährdet, ist zu kurz.
Änderungsvorschlag 28
COM(2013) 29 final
Artikel 13 a Abs. 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Gemeinsame Informations- und integrierte Fahrscheinsysteme |
Gemeinsame Informations- und integrierte Fahrscheinsysteme |
|
1. Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 und der Richtlinie 2010/40/EU können die Mitgliedstaaten inländische Personenverkehrsdienste erbringende Eisenbahnunternehmen verpflichten, sich an einem gemeinsamen Informations- und integrierten Fahrscheinsystem zur Erstellung von Fahrscheinen, Durchgangsfahrscheinen und Reservierungen zu beteiligen, oder beschließen, zuständige Behörden zu ermächtigen, ein solches System einzurichten. Wird ein solches System eingerichtet, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass es nicht zu Marktverzerrungen oder Diskriminierungen zwischen Eisenbahnunternehmen führt und von einer öffentlichen oder privaten juristischen Person oder einer Vereinigung aller Eisenbahnunternehmen, die Personenverkehrsdienste erbringen, verwaltet wird. |
1. Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 und der Richtlinie 2010/40/EU können verpflichten die Mitgliedstaaten inländische Personenverkehrsdienste erbringende Eisenbahnunternehmen verpflichten, sich an einem gemeinsamen Informations- und integrierten Fahrscheinsystem zur Erstellung von Fahrscheinen, Durchgangsfahrscheinen und Reservierungen zu beteiligen, oder beschließen, zuständige Behörden zu ermächtigen, ein solches System einzurichten. Wird Wenn ein solches System eingerichtet wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass es nicht zu Marktverzerrungen oder Diskriminierungen zwischen Eisenbahnunternehmen führt und von einer öffentlichen oder privaten juristischen Person oder einer Vereinigung aller Eisenbahnunternehmen, die Personenverkehrsdienste erbringen, verwaltet wird. |
|
|
Eine Gruppe von Vertretern der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beteiligt sich an dieser juristischen Person oder Vereinigung und ist in vollem Umfang an ihren Entscheidungen beteiligt. |
Begründung
Dieser Artikel bildet die Rechtsgrundlage für das Ziel der Regionen, das Fahrscheinsystem auf einem wettbewerbsorientierten Markt zu harmonisieren. Er bietet ihnen die Möglichkeit, die verschiedenen Probleme anzugehen, die bei den Fahrscheinsystemen in den von etablierten Bahnunternehmen betriebenen Bahnhöfen aufgetreten sind.
Die Pflicht für inländische Verkehrsdienste erbringenden Unternehmen, an einem nationalen Informationssystem mitzuwirken, sollte zwingend vorgeschrieben werden, da der Ausbau der damit zusammenhängenden Dienstleistungen ein wichtiger Faktor bei der Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs, insbesondere des Schienenverkehrs, ist. In diesem Zusammenhang müssen die lokalen Gebietskörperschaften an den Verwaltungsgremien dieses Systems beteiligt werden.
Änderungsvorschlag 29
COM(2013) 29 final
Artikel 59, neuer Absatz nach Absatz 3
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Vertikal integrierte Unternehmen, die Infrastrukturbetreiber für weniger als 150 km Strecke sind oder ausschließlich Nahverkehrsbahndienste anbieten, unterliegen nicht Artikel 7 und Artikel 7a bis 7c, wenn sie diese Dienste im Rahmen der hilfsweisen Betreibung von See- und Binnenhafenanlagen erbringen; dies gilt unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 3 dieser Richtlinie und des Warentransports per „Short-liner“. |
Begründung
Dieser Änderungsvorschlag zielt darauf ab, die Betreiber kleiner Bahnnetze sowie den Nahverkehr, die den lokalen Bedarf decken und keine großen Unternehmen sind, vom Anwendungsbereich von Artikel 7 und Artikel 7 a bis 7 c auszunehmen. Zudem wird erneut auf den diskriminierungsfreien Zugang zu Serviceeinrichtungen hingewiesen.
Änderungsvorschlag 30
COM(2013) 29 final
Artikel 59, neuer Absatz nach Absatz 3
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
|
Vertikal integrierte Unternehmen, die die spezifischen Investitionsvorhaben gemäß Artikel 32 Absatz 3 dieser Richtlinie betreiben und bei denen diese Dienste im direkten Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern stehen, unterliegen nicht Artikel 7 und Artikel 7 a bis 7 c. |
Begründung
Dieser Änderungsvorschlag steht mit anderen Bestimmungen der Richtlinie 2012/34/EU im Einklang und zielt darauf ab, „spezifische Investitionsvorhaben“, die erst auf sehr lange Sicht rentabel werden, vom Anwendungsbereich von Artikel 7 und Artikel 7 a bis 7 c auszunehmen.
Änderungsvorschlag 31
COM(2013) 27 final
Erwägungsgrund 29
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
Um eine wirksame Erfüllung der Aufgaben der Agentur zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission in einem Verwaltungsrat vertreten sein, der mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet ist, einschließlich der Befugnisse zur Aufstellung des Haushaltsplans und zur Genehmigung der jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme. |
Um eine wirksame Erfüllung der Aufgaben der Agentur zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission in einem Verwaltungsrat vertreten sein, der mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet ist, einschließlich der Befugnisse zur Aufstellung des Haushaltsplans und zur Genehmigung der jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme, wobei der Ausschuss der Regionen und die Vertretungsgremien hierzu zu konsultieren sind. |
Begründung
Das Netz von Vertretungsgremien des Eisenbahnsektors und der Ausschuss der Regionen sollten bei der Festlegung der jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme der Agentur konsultiert werden, da sie von den Ergebnissen und den Arbeitsschwerpunkten der Agentur betroffen sind.
Änderungsvorschlag 32
COM(2013) 27 final
Artikel 33 Absatz 5
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung |
|
Die für die Ausstellung der Lizenzen und Bescheinigungen nach Absatz 2 Buchstaben c und d zuständigen nationalen Behörden melden der Agentur innerhalb eines Monats jede Einzelentscheidung über die Erteilung, die Verlängerung, die Änderung oder den Widerruf einer Lizenz bzw. Bescheinigung. |
Die für die Ausstellung der Lizenzen und Bescheinigungen nach Absatz 2 Buchstaben c und d zuständigen nationalen Behörden melden der Agentur innerhalb eines Monats jede Einzelentscheidung über die Erteilung, die Verlängerung, die Änderung, die Verweigerung oder den Widerruf einer Lizenz bzw. Bescheinigung und die entsprechende Begründung dazu. Die Agentur bestätigt oder widerruft die Entscheidung dann innerhalb eines Monats, wobei die Beteiligten anzuhören sind . |
Begründung
Es geht darum zu vermeiden, dass die nationalen Behörden alle vor Anrufung des EuGH möglichen Rechtswege gegen ihre Entscheidungen ausschöpfen, weshalb die Europäische Eisenbahnagentur in die Bestätigung oder Aufhebung nationaler Entscheidungen eingebunden werden sollte, die dem Geist des einheitlichen europäischen Eisenbahnraums widersprechen.
Änderungsvorschlag 33
COM(2013) 27 final
Artikel 48 Absatz 5
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
5. Der Verwaltungsrat verabschiedet bis zum 30. November jedes Jahres auch ein strategisches mehrjähriges Arbeitsprogramm und aktualisiert dieses. Der Stellungnahme der Kommission wird dabei Rechnung getragen. Das Europäische Parlament und die in Artikel 34 genannten Netze werden zu dem Entwurf konsultiert. Das verabschiedete mehrjährige Arbeitsprogramm wird den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und den in Artikel 34 genannten Netzen zugeleitet. |
5. Der Verwaltungsrat verabschiedet bis zum 30. November jedes Jahres auch ein strategisches mehrjähriges Arbeitsprogramm und aktualisiert dieses. Der Stellungnahme der Kommission wird dabei Rechnung getragen. Das Europäische Parlament, der Ausschuss der Regionen und die in Artikel 34 genannten Netze werden zu dem Entwurf konsultiert. Das verabschiedete mehrjährige Arbeitsprogramm wird den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Ausschuss der Regionen und den in Artikel 34 genannten Netzen zugeleitet. |
Begründung
Der Ausschuss der Regionen sollte auch im Rahmen des mehrjährigen Arbeitsprogramms der Agentur konsultiert werden, da die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der Finanzierung des Rollmaterials beteiligt sind und ein unmittelbares Interesse an der Verbesserung der Interoperabilität und der Sicherheit haben.
Änderungsvorschlag 34
COM(2013) 27 final
Artikel 54 Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
1. Beschwerde vor der Beschwerdekammer kann eingelegt werden gegen Entscheidungen der Agentur gemäß den Artikeln 12, 16, 17 und 18. |
1. Beschwerde vor der Beschwerdekammer kann eingelegt werden gegen Entscheidungen der Agentur gemäß den Artikeln 12, 16, 17 und 18 oder wegen Untätigkeit der Agentur innerhalb der festgelegten Fristen. |
Begründung
Beschwerden müssen möglich sein, wenn die Agentur innerhalb der festgelegten Fristen keine Entscheidung trifft.
Änderungsvorschlag 35
COM(2013) 27 final
Artikel 56 Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
|
1. Bei der Prüfung der Beschwerde geht die Beschwerdekammer zügig vor. Sie fordert die am Beschwerdeverfahren Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten des Beschwerdeverfahrens einzureichen. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben. |
1. Bei der Prüfung der Beschwerde geht die Beschwerdekammer zügig vor. Sie fordert die am Beschwerdeverfahren Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten des Beschwerdeverfahrens einzureichen. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben das Recht, mündliche Erklärungen abzugeben. |
|
|
Die Beschwerdekammer prüft sämtliche Beschwerden und wird innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerde gegebenenfalls relevante Informationen anfordern und die Beteiligten konsultieren. Sie muss über alle Beschwerden entscheiden, die notwendigen Abhilfemaßnahmen treffen und ihre begründete Entscheidung innerhalb einer zuvor festgelegten angemessenen Frist, jedoch nicht später als zwei Monate nach Eingang aller relevanten Informationen den Beteiligten mitteilen. Nimmt die Agentur innerhalb der festgelegten Frist nicht zu der Beschwerde Stellung, kann die Beschwerdekammer eine entsprechende Abmahnung vornehmen, die erforderlichenfalls mit einer Geldstrafe verbunden ist. |
Begründung
Die Verfahren und Fristen für die Prüfung der Beschwerden durch die Beschwerdekammer müssen im Einzelnen dargelegt werden (so muss zum Beispiel der Zeitpunkt definiert werden, an dem die Beschwerde als eingegangen gilt, da dies der Fristberechnung nach Einleitung des Verfahrens dient).
Der Beschwerdekammer sollten spezifische Befugnisse zur Umsetzung ihrer Entscheidungen eingeräumt werden, zum Beispiel für Abmahnungen oder Geldstrafen (Zwangsgelder), vor allem bei Untätigkeit.
Änderungsvorschlag 36
COM(2013) 27 final
Neuer Artikel nach Artikel 77
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||
|
|
1. Die Agentur trifft ihre Entscheidungen nach Artikel 12, 16, 17 und 18 ab dem [zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung]. Bis zu diesem Zeitpunkt wenden die Mitgliedstaaten weiterhin die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften an. 2. Während einer zusätzlichen Übergangszeit von 42 Monaten ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt können die Mitgliedstaaten abweichend von den Artikeln 12, 16, 17 und 18 unter den Bedingungen, die die Kommission in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen gemäß Artikel 75 festlegt, weiterhin Zulassungen bzw. Zeugnisse und Genehmigungen ausstellen. Vor einer Entscheidung muss die Agentur prüfen, ob:
Die Agentur kann die jeweils zuständigen Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten auffordern, die Entscheidung zu ändern, auszusetzen oder aufzuheben. Lehnt die nationale Sicherheitsbehörde ein Tätigwerden ab, kann die Agentur die Frage der Kommission oder dem in Artikel 75 genannten Ausschuss vorlegen. |
Begründung
In Anlehnung an die Übergangsphase für die Europäische Agentur für die Flugsicherheit (EASA) im Bereich der Zuständigkeit für die Typenzulassung von Flugzeugen sollte auch für die Eisenbahnagentur (ERA) ein Verfahren vorgesehen werden, wonach die ERA schrittweise zusätzliche Mitarbeiter einstellen und für die neuen Aufgaben schulen kann.
Änderungsvorschlag 37
COM(2013) 30 final
Anhang I, 4.2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderungsvorschlag des AdR |
||||||||||||
|
|
3. Kostenkontrolle Bei der Kosten-Nutzen-Analyse der vorgeschlagenen Maßnahmen werden unter anderem folgende Faktoren berücksichtigt:
Darüber hinaus müssen bei dieser Bewertung die wahrscheinlichen Folgen für alle Betreiber und Wirtschaftsbeteiligten einschließlich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften abgeschätzt werden. |
Begründung
Dieser Passus aus der derzeit geltenden Richtlinie (Anhang I, 4.2) sollte wieder eingefügt werden, damit eine Bewertung der Kosten und des Nutzen aller erwogenen technischen Lösungen vorgenommen wird, und zwar für jede technische Spezifikation für die Interoperabilität, damit die wirtschaftlichsten Lösungen umgesetzt werden (was vor allem im Sinne der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist).
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/116 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze
2013/C 356/17
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
nimmt den geänderten Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze zur Kenntnis und betont, dass die in diesem Dokument dargelegten Prioritäten — Hochgeschwindigkeitsnetze, grenzübergreifende öffentliche Dienste, Zugang zu weiterverwendbaren Informationen des öffentlichen Sektors und mehrsprachigen Diensten sowie Dienstinfrastrukturen für ein sicheres Internet — allesamt Bereiche betreffen, in denen die Städte und Regionen gleichzeitig Akteure sowie Anbieter und Nutzer von Dienstleistungen sind; |
|
— |
unterstreicht die große Relevanz der transeuropäischen Telekommunikationsnetze für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke sowie die Bedeutung von Forschungsinvestitionen zur Förderung einschlägiger Aktivitäten und zur Entwicklung künftiger Anwendungen zur Steigerung des Nutzens des Telekommunikationssektors; |
|
— |
empfiehlt, dass Europa sein Potenzial für die Entwicklung von IKT-Diensten im öffentlichen und privaten Sektor voll ausschöpfen und die IKT als Mittel zur Verbesserung der Dienstleistungen lokaler und regionaler Gebietskörperschaften in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentliche Beschaffung, Sicherheit sowie Sozialleistungen einsetzen sollte, aber auch für sonstige Tätigkeiten, die der Entscheidungsfindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dienen; |
|
— |
betont, wie wichtig die Förderung von öffentlichen und privaten Investitionen in einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten wie auch in städtischen Gebieten mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen ist, und macht daher auf die Koordinierung des Breitbandzugangs seitens Regierungsbehörden, Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit, örtliche Schulen und Gesundheitseinrichtungen aufmerksam. |
|
Hauptberichterstatter |
Alin-Adrian NICA (RO/ALDE), Bürgermeister von Dudeștii Noi |
|
Referenzdokument |
Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1336/97/EG COM(2013) 329 final |
I. STANDPUNKTE DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
1. |
nimmt den geänderten Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze zur Kenntnis und betont, dass die in diesem Dokument dargelegten Prioritäten — Hochgeschwindigkeitsnetze, grenzübergreifende öffentliche Dienste, Zugang zu weiterverwendbaren Informationen des öffentlichen Sektors und mehrsprachigen Diensten sowie Dienstinfrastrukturen für ein sicheres Internet — allesamt Bereiche betreffen, in denen die Städte und Regionen gleichzeitig Akteure sowie Anbieter und Nutzer von Dienstleistungen sind; |
|
2. |
hält es für wichtig, wie vom Europäischen Parlament gefordert die geltenden Rechtsvorschriften sorgfältig zu prüfen und sie an den derzeitigen Bedarf anzupassen; |
|
3. |
betrachtet mit Sorge die drastische Kürzung der für den Telekommunikationsbereich im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) vorgesehenen Mittel von 9,2 Mrd. EUR auf 1 Mrd. EUR und hebt hervor, dass die Telekommunikationsnetze mit Blick auf die Einführung und Weiterentwicklung künftiger digitaler Dienste sowie auf die digitale Wirtschaft zu einem ernstlichen Problem werden könnten. Der Ausschuss bedauert insbesondere, dass die Dienste „Transeuropäische Hochgeschwindigkeits-Backboneverbindungen für öffentliche Verwaltungen“ und „IKT-Lösungen für intelligente Energienetze und für die Erbringung intelligenter Energiedienstleistungen“, die nicht mehr als im gemeinsamen Interesse stehend erachtet werden, aus finanziellen Gründen gestrichen werden mussten; |
|
4. |
unterstreicht die große Relevanz der transeuropäischen Telekommunikationsnetze für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke sowie die Bedeutung von Forschungsinvestitionen zur Förderung einschlägiger Aktivitäten und zur Entwicklung künftiger Anwendungen zur Steigerung des Nutzens des Telekommunikationssektors; |
|
5. |
ist der Ansicht, dass Schlüsseltechnologien den Bürgern, Unternehmen und Behörden sehr zum Vorteil gereichen und zur Verbesserung der Qualität von Produkten und Leistungen der Daseinsvorsorge beitragen könnten; |
|
6. |
bekräftigt, wie wichtig Investitionen in die Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die Förderung des Wachstums und die Entwicklung neuer Geschäftstätigkeiten sind, und weist darauf hin, dass IKT-gestützte Innovationen zur Bewältigung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Probleme beitragen könnten; |
|
7. |
weist erneut darauf hin, dass IKT, die einer allen offenstehenden Informationsgesellschaft zu Grunde liegen, den Anforderungen aller Bürger gerecht werden sollten, einschl. Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind; |
|
8. |
betont, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Zusammenhang mit dem Vorschlag nicht nur als Nutzer europaweiter elektronischer Dienste, sondern auch als wichtige Dienstleister zu betrachten sind; |
|
9. |
fordert die Förderung privater Investitionen sowie öffentlicher Investitionen aus anderen Quellen als der Fazilität „Connecting Europe“, einschließlich eines umfassenderen Beitrags von Unternehmen und institutionellen Akteuren wie der Europäischen Investitionsbank (EIB); |
|
10. |
bekräftigt, dass zwischen Horizont 2020, den Strukturfonds und einzelstaatlichen Maßnahmen im Hinblick auf die übergeordneten EU-Ziele Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt Synergien geschaffen werden müssen; |
|
11. |
betont die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, wenn es darum geht, einen sachkundigen Dialog mit den Bürgern zu fördern und für deren Anliegen auf bürgernahe Weise eine Lösung zu finden und eine engere Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Nutzern von IKT-Innovationen in den verschiedenen Bereichen der Regierungen und Verwaltungen zu erleichtern; |
|
12. |
weist darauf hin, dass der Austausch zwischen Regionen und lokalen und regionalen Gebietskörperschaften über vorbildliche Vorgehensweisen nicht nur nützlich wäre, sondern sogar ein wesentlicher Bestandteil des Vorschlags sein sollte; |
II. EMPFEHLUNGEN DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN
|
13. |
fordert die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf, eine breit angelegte Zusammenarbeit einzugehen, um die Interoperabilität zwischen Behörden und somit die Effizienz der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern; |
|
14. |
unterstreicht die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Erleichterung grenzüberschreitender physischer wie auch digitaler Dienste und fordert deshalb nachdrücklich die umfassende Einbeziehung dieser Behörden in die Governance des Programms; |
|
15. |
räumt ein, dass die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Branchen zwar nach wie vor Beachtung finden muss, der künftige Wohlstand in Europa aber immer stärker von sektorübergreifenden Aktivitäten abhängen wird (1); |
II.1 Breitband
|
16. |
bekräftigt, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Bereichen, in denen sich die Marktmechanismen allein als unzureichend erweisen, eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung eines gleichberechtigten und erschwinglichen Breitbandzugangs, bei Projekten zur Überwindung der digitalen Kluft sowie bei der Konzipierung neuer, auf die Bürger ausgerichteter elektronischer Behördendienste zukommt (2); |
|
17. |
empfiehlt, dass Europa sein Potenzial für die Entwicklung von IKT-Diensten im öffentlichen und privaten Sektor voll ausschöpfen und die IKT als Mittel zur Verbesserung der Dienstleistungen lokaler und regionaler Gebietskörperschaften in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentliche Beschaffung, Sicherheit sowie Sozialleistungen einsetzen sollte, aber auch für sonstige Tätigkeiten, die der Entscheidungsfindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dienen; |
|
18. |
erinnert daran, dass die von der EU geförderten öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und kleinen und mittelständischen IKT-Unternehmen im Bereich der öffentlichen IKT-Dienste eine ausgezeichnete Grundlage für den lokalen Kompetenz- und Wissensaufbau in der gesamten EU bilden können (3); |
|
19. |
weist darauf hin, dass Investitionen in ultraschnelle Breitbandnetze zwar aus Investorensicht als Risiko betrachtet werden können, indes jedoch die richtige Wahl sind,, da die Nutzung des Hochgeschwindigkeitsinternets der tatsächlichen Breitbandversorgung beträchtlich einen besseren Zugang zu digitalen Diensten ermöglicht, und schlägt vor, diese Maßnahmen durch Pläne zu flankieren, mit denen die Inanspruchnahme dieser Dienste durch die Bürger gefördert und erleichtert wird, was mit den Zielen der Digitalen Agenda der EU im Einklang steht; |
|
20. |
weist erneut darauf hin, dass finanzielle und andere Unterstützungsmaßnahmen auf die Schaffung öffentlich zugänglicher Breitband-Netzwerke mit einer horizontalen Netzwerkarchitektur ausgerichtet sein sollten; unterstreicht das Erfordernis eines Geschäftsmodells, bei dem der physische Zugang zum Netzwerk von der Bereitstellung von Dienstleistungen getrennt ist und die modernen Lichtwellenleiternetze für den Wettbewerb geöffnet werden; in der Praxis heißt das, aktiv solche Geschäftsmodelle zu fördern, die auf dem freien Zugang zu den sogenannten dunklen Glasfasern („Dark Fiber“) — einer Art passiver Infrastruktur — basieren; |
|
21. |
betont, wie wichtig die Förderung von öffentlichen und privaten Investitionen in einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten wie auch in städtischen Gebieten mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen ist, und macht daher auf die Koordinierung des Breitbandzugangs seitens Regierungsbehörden, Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit, örtliche Schulen und Gesundheitseinrichtungen aufmerksam (4); |
II.2 Verwaltung und Interoperabilität
|
22. |
spricht sich dafür aus, die regionale und lokale Ebene verstärkt dafür zu sensibilisieren, dass die Interoperabilität digitaler Dienstinfrastrukturen Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse sowohl innerhalb eines Landes als auch grenzüberschreitend ist; betont ferner nachdrücklich die notwendige Förderung einer Modernisierung der Infrastruktur, um die Entwicklung und Verwirklichung der transeuropäischen Telekommunikationsnetze sicherzustellen; |
|
23. |
hält es für erforderlich, über einen geeigneten europäischen Rahmen für eine größere Effizienz der Forschungsinfrastrukturen und die Beseitigung von Hemmnissen für internationale Forschung zu sorgen; |
|
24. |
ist der Ansicht, dass allen Bürgern unabhängig von ihrem Wohnort eine gut funktionierende informationsgesellschaftliche Infrastruktur zur Verfügung stehen sollte, und erkennt an, dass sichere und schnelle Internetverbindungen, wie auch die sie ergänzenden effizienten drahtlosen mobilen Dienstleistungsangebote, für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, die Zugänglichkeit und die Chancengleichheit der Menschen von großer Bedeutung sind (5); |
|
25. |
spricht sich dafür aus, die grenzübergreifenden Dienstleistungen öffentlicher Behörden weiterzuentwickeln, indem auch Aspekte der Interoperabilität und elektronischen Identifizierung, die elektronischen Unterschriften, der elektronische Dokumentendienst und weitere Bauelemente der elektronischen Behördendienste berücksichtigt werden; |
II.3 Zugang zu digitalen Ressourcen
|
26. |
bekräftigt die Rolle des digitalen Binnenmarkts als Grundpfeiler der Digitalen Agenda für Europa, der die Schaffung eines wachsenden, erfolgreichen und dynamischen gesamteuropäischen Markts sichert, der den Zugang zu elektronischen Diensten gewährleistet (6); |
|
27. |
unterstreicht die Notwendigkeit koordinierter Bemühungen im Bereich der Digitalisierung und stellt fest, dass dank der Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials die Bürger europaweit darauf zugreifen und es für Freizeit-, Studien- und Arbeitszwecke werden nutzen können; |
|
28. |
befürwortet die Produktion und Verbreitung legaler digitaler Inhalte und Online-Dienstleistungen und einen einfachen, sicheren und flexiblen Zugang zu Online-Inhalten und Dienstleistungsmärkten für die Verbraucher; |
|
29. |
begrüßt die Tatsache, dass digitale Ressourcen des europäischen Erbes im Rahmen des Programms von vornherein förderwürdig sind; weist diesbezüglich auf die Auswirkung hin, die die Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials auf die Bürger in ganz Europa haben wird, und unterstreicht, dass dieser Prozess dazu beiträgt, Europas vielfältigem und mehrsprachigem Erbe im Internet ein klares Profil zu verleihen; und begrüßt deshalb die weitere Unterstützung des aktuellen Europeana-Portals, Europas Online-Bibliothek, -Museum und -Archiv; |
|
30. |
ist der Ansicht, dass das digitalisierte Material — sowohl zu gewerblichen als auch nichtgewerblichen Zwecken — weiterverwendet werden kann, beispielsweise für die Entwicklung von Lern- und Bildungsinhalten, Dokumentarfilmen, Tourismusanwendungen, Spielen, Animationen und Entwurfswerkzeugen, sofern dies unter vollständiger Beachtung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte erfolgt; |
|
31. |
erinnert daran, dass die Behörden auf regionaler und lokaler Ebene über angemessene interne Kapazitäten und nachhaltige Finanzressourcen für die Digitalisierung verfügen müssen, um in den Genuss erheblicher Kostenreduzierungen zu kommen; |
II.4 Zugang zu weiterverwendbaren Informationen des öffentlichen Sektors
|
32. |
hält es für erforderlich, eine Unterscheidung zwischen dem durch die Mitgliedstaaten zu regelnden Zugang und der Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors vorzunehmen, was unter strenger Einhaltung der Datenschutzvorschriften geschehen sollte, um den Nutzen für den Informationserzeuger zu erhöhen, der die ihm durch die Generierung dieser Informationen entstehenden Kosten möglicherweise nicht voll decken kann, und um einen nur begrenzten Zugang zu öffentlichen Informationen möglichst gering zu halten (7); |
|
33. |
bekräftigt die Bedeutung und Notwendigkeit gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Weiterverwendung und Nutzung von Informationen des öffentlichen Sektors, um sicherzustellen, dass im Einklang mit der Richtlinie 2013/37/EU sämtliche Akteure des europäischen Informationsmarkts die gleichen Ausgangsbedingungen vorfinden, die Bedingungen für die Weiterverwendung derartiger Informationen transparenter sind und Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt verhindert werden (8); |
|
34. |
stellt fest, dass ein leichter Zugang zu weiterverwendbaren Daten des öffentlichen Sektors das Wirtschaftswachstum fördert und neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen schafft, unabhängig von ihrem Standort auch für Kleinunternehmen, und merkt an, dass insbesondere die Weiterverwendung durch KMU gefördert und die erforderliche Finanzierung für die Erzeugung, Speicherung und Aktualisierung von Dokumenten des öffentlichen Sektors sichergestellt werden sollte (9); |
|
35. |
betont, dass die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors durch eine engere Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften umfassend zum Tragen gebracht und dadurch ein erheblicher Beitrag zur Förderung der Weiterverwendung öffentlicher Informationen im Hinblick auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung neuer Arbeitsplätze geleistet werden kann (10); |
II.5 Sicherheit
|
36. |
dringt darauf, bei der Weiterentwicklung der Infrastrukturen und Dienstleistungen im Rahmen der Digitalen Agenda für Europa sämtliche Sicherheitsanforderungen auf allen Ebenen zu erfüllen, damit der größtmögliche Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sichergestellt werden kann und ein unerlaubter Zugriff auf jedwede persönlichen Informationen und das Erstellen von Profilen einschließlich der Einkaufspräferenzen, medizinischer Informationen, Krankenakten usw. verhindert wird (11); |
|
37. |
schlägt vor, dass Einrichtungen, auch Behörden, sich bewusst machen müssen, dass die Bekämpfung der Cyberkriminalität ein fortwährender Kampf ist, und dazu angehalten werden, der von Cyberstörungen und -angriffen ausgehenden Gefahr oberste Priorität einzuräumen, indem sie Schwachstellen ermitteln und sich organisatorisch auf die Bewältigung der Folgen derartiger Angriffe vorbereiten; |
|
38. |
stellt fest, dass Cyberkriminalität in all ihren Formen eine sich rasant entwickelnde und ausgeklügelte neue Gefahr für die Mitgliedstaaten, Organisationen und Unionsbürger im 21. Jahrhundert ist, die immer häufiger auftritt, immer komplexer wird und nicht an den Grenzen halt macht; |
|
39. |
betont, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, der Erhebung einschlägiger Daten und auf dem Gebiet des Datenschutzes eine Schlüsselrolle zukommt, da Sicherheitsverletzungen eine Gefahr für öffentliche Versorgungsdienste wie die lokale Wasser- und Energieversorgung sind und die Gebietskörperschaften selbst viele digitale Informatikprodukte und -dienste nutzen und verwalten; |
|
40. |
fordert, Partnerschaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren zu fördern und auszubauen, um koordinierte Maßnahmen für die Cybersicherheit auszuarbeiten und in einschlägige Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene in dem Anliegen einzubringen, die Cyberkriminalität zu bekämpfen sowie ihre Auswirkungen aufgrund direkter finanzieller Verluste oder des Diebstahls geistigen Eigentums, von Kommunikationsunterbrechungen und der Schädigung unternehmenskritischer Daten zu minimieren (12); |
II.6 Abschließende Bemerkungen
|
41. |
vertritt die Auffassung, dass die in dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung vorgesehenen Maßnahmen in der vorliegenden Form in Bezug auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit keine Probleme aufwerfen dürften; |
|
42. |
betont die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Förderung gemeinsamer Forschungsprogramme, denn sie sind wesentliche Akteure bei der Entwicklung regionaler Strategien für Forschung und Innovation und verwalten häufig Forschungseinrichtungen und fördern ein innovationsfreundliches Umfeld; |
|
43. |
unterstreicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Konzipierung, Umsetzung und Verwaltung der Maßnahmen zur Finanzierung der transeuropäischen Telekommunikationsnetze systematisch konsultiert werden sollten (insbesondere hinsichtlich der Aspekte im Zusammenhang mit der Einführung der Breitbandtechnik in weniger bevölkerten Gebieten, der Bereitstellung grenzübergreifender Dienste usw.). |
III. EMPFEHLUNGEN FÜR ÄNDERUNGEN
Änderung 1
Präambel
|
Neu |
Änderung des AdR |
||
|
|
|
Begründung
Heutzutage ist es aufgrund der Schwachstellen, durch die einzelne personenbezogene Daten gefährdet werden könnten, einschließlich Einkaufspräferenzen, medizinischer Informationen, Krankenakten usw., wichtig, den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen und Standards für den Schutz der Privatsphäre als Sicherheitsanforderungen anzuwenden.
Änderung 2
Präambel, 1. Erwägungsgrund
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Telekommunikationsnetze und -dienste verwandeln sich immer mehr in internetgestützte Infrastrukturen, in denen Breitbandnetze und digitale Dienste eng miteinander verknüpft sind. Das Internet wird zur vorherrschenden Plattform für die Kommunikation, Dienstleistungen und den Geschäftsbetrieb. Deshalb ist die transeuropäische Verfügbarkeit schneller Internetzugänge und digitaler Dienste, die von öffentlichem Interesse sind, für das Wirtschaftswachstum und den Binnenmarkt unverzichtbar. |
Telekommunikationsnetze und -dienste verwandeln sich immer mehr in internetgestützte Infrastrukturen, in denen Breitbandnetze und digitale Dienste eng miteinander verknüpft sind. Das Internet wird zur vorherrschenden Plattform für die Kommunikation, Dienstleistungen und den Geschäftsbetrieb. Deshalb ist die transeuropäische Verfügbarkeit schneller erschwinglicher Internetzugänge und digitaler Dienste, die von öffentlichem Interesse sind, in allen Regionen der EU für das Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, soziale Inklusion und den Binnenmarkt unverzichtbar. |
Begründung
Wettbewerbsfähigkeit und soziale Inklusion sind zwei wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden sollten.
Änderung 3
Präambel, 7. Erwägungsgrund
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
In Bezug auf digitale Dienstinfrastrukturen sollten Bausteine Vorrang vor sonstigen digitalen Dienstinfrastrukturen haben, da erstere die Voraussetzung für letztere sind. Digitale Dienstinfrastrukturen sollen u.a. einen europäischen Mehrwert schaffen und einen nachweislichen Bedarf decken. Sie sollten sowohl technisch als auch operativ eine hinreichende Einsatzreife aufweisen, was insbesondere durch erfolgreiche Pilotprojekte nachgewiesen werden sollte. Sie sollten auf einem konkreten Plan zum Nachweis der Tragfähigkeit beruhen, um den langfristigen Betrieb vonKerndienstplattformen über die CEF-Förderung hinaus zu gewährleisten. Die im Rahmen der vorliegenden Verordnung gewährte finanzielle Unterstützung sollte wo immer möglich schrittweise verringert und durch Mittel aus anderen Quellen ersetzt werden. |
In Bezug auf digitale Dienstinfrastrukturen sollten Bausteine und digitale Dienstinfrastrukturen mit Elementen, die von anderen Diensteanbietern genutzt werden können, Vorrang vor sonstigen digitalen Dienstinfrastrukturen haben, da erstere die Voraussetzung eine Grundlage für letztere sind. Digitale Dienstinfrastrukturen sollen u.a. einen europäischen Mehrwert schaffen und einen nachweislichen Bedarf decken. Sie sollten sowohl technisch als auch operativ eine hinreichende Einsatzreife aufweisen, was insbesondere durch erfolgreiche Pilotprojekte nachgewiesen werdensollte. Sie sollten auf einem konkreten Plan zum Nachweis der Tragfähigkeit beruhen, um den langfristigen Betrieb von Kerndienstplattformen über die CEF-Förderung hinaus zu gewährleisten. Die im Rahmen der vorliegenden Verordnung gewährte finanzielle Unterstützung sollte wo immer möglich schrittweise verringert und durch Mittel aus anderen Quellen ersetzt werden. |
Änderung 4
Präambel, 22. Erwägungsgrund
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Die Kommission sollte von einer Sachverständigengruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten unterstützt werden, die u. a. in Bezug auf die Überwachung der Umsetzung dieser Leitlinien, die Planung, die Bewertung und die Lösung von Umsetzungsproblemen angehört wird und hierzu beitragen sollte. |
Die Kommission sollte von einer Sachverständigengruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten und einem Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unterstützt werden, die u. a. in Bezug auf die Überwachung der Umsetzung dieser Leitlinien, die Planung, die Bewertung und die Lösung von Umsetzungsproblemen angehört wird und hierzu beitragen sollte. |
Begründung
Die Teilnahme von Vertretern der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Konsultationsprozess wäre aufgrund ihrer Rolle bei der Umsetzung der Dienste sinnvoll.
Änderung 5
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Verbesserungen im Lebensalltag der Bürger, Unternehmen und Behörden durch Förderung des Verbunds und der Interoperabilität der nationalen, regionalen und lokalen Telekommunikationsnetze sowie des Zugangs zu diesen Netzen. |
Verbesserungen im Lebensalltag und bei den sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Bürger, Unternehmen und Behörden durch Förderung des Verbunds und der Interoperabilität der nationalen, regionalen und lokalen Telekommunikationsnetze sowie des Zugangs zu diesen Netzen. |
Begründung
Mit dem Lebensalltag sind soziale und wirtschaftliche Aktivitäten verknüpft, die zu den lokalen und regionalen Prioritäten gehören und gemeinsam die Entwicklung vorantreiben und zur Förderung effizienterer öffentlicher Dienste und Unternehmen beitragen könnten.
Änderung 6
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
effiziente private und öffentliche Investitionen, von denen Anreize für den Aufbau und die Modernisierung von Breitbandnetzen ausgehen und die zur Erreichung der Breitbandziele der Digitalen Agenda für Europa beitragen. |
effiziente private und öffentliche Investitionen und Ausbau von E-Learning, von denen Anreize für den Aufbau und die Modernisierung von Breitbandnetzen ausgehen und die zur Erreichung der Breitbandziele der Digitalen Agenda für Europa beitragen. |
Begründung
Die Entwicklung von Märkten für E-Learning bietet eine Alternative für die Finanzierung der Digitalisierung von Inhalten.
Änderung 7
Artikel 4 Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Vorhaben von gemeinsamem Interesse können den gesamten Projektzyklus einschließlich Durchführbarkeitsuntersuchungen, Durchführung, fortlaufenden Betrieb, Koordinierung und Bewertung umfassen. |
Vorhaben von gemeinsamem Interesse können den gesamten Projektzyklus einschließlich Durchführbarkeitsuntersuchungen, Durchführung, fortlaufenden Betrieb, Koordinierung und Bewertung umfassen und auf dem Grundsatz der Technologieneutralität beruhen, auf dem die elektronische Kommunikationsstruktur der EU aufbaut. |
Begründung
Es ist wichtig, die der elektronischen Kommunikationsstruktur zugrundeliegenden Prinzipien zu nennen, insbesondere wenn es um die Definition von Vorhaben von gemeinsamem Interesse geht.
Änderung 8
Artikel 7
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Die Union kann Kontakt zu Behörden und anderen Organisationen in Drittländern aufnehmen, mit ihnen Gespräche führen, Informationen austauschen und zusammenarbeiten, um die mit diesen Leitlinien verfolgten Ziele zu erreichen. Diese Zusammenarbeit muss u. a. darauf abzielen, die Interoperabilität zwischen den Telekommunikationsnetzen der Union und den Telekommunikationsnetzen von Drittländern zu fördern. |
Die Union kann im öffentlichen Interesse Kontakt zu Behörden und anderen Organisationen in Drittländern aufnehmen, mit ihnen Gespräche führen, Informationen austauschen und zusammenarbeiten, um die mit diesen Leitlinien verfolgten Ziele zu erreichen. Diese Zusammenarbeit muss u. a. darauf abzielen, die Interoperabilität zwischen den Telekommunikationsnetzen der Union und den Telekommunikationsnetzen von Drittländern zu fördern. Diese Zusammenarbeit ist auf die Strategien, insbesondere sämtliche bereits bestehende oder in Ausarbeitung befindliche makroregionale Strategien, im Rahmen der EU-Außenpolitik abzustimmen. |
Begründung
Dem öffentlichen Interesse sollte im Beschlussfassungsprozess vorrangige Bedeutung beigemessen werden. Auch wäre es ratsam, bei der Gestaltung einer Zusammenarbeit mit Drittländern den bereits bestehenden Verfahrensweisen und Strategien zu folgen.
Änderung 9
Artikel 8 Absatz 1
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Aufgrund der gemäß Artikel 21 der CEF-Verordnung (EU) Nr. XXX erhaltenen Informationen tauschen die Mitgliedstaaten und die Kommission Informationen über die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Leitlinien aus. |
Aufgrund der gemäß Artikel 21 der CEF-Verordnung (EU) Nr. XXX erhaltenen Informationen tauschen die Mitgliedstaaten und die Kommission Informationen über die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Leitlinien sowie einschlägige bewährte Verfahren aus. Dem Europäischen Parlament wird jedes Jahr eine Übersicht über diese Informationen vorgelegt. Die Mitgliedstaaten beteiligen die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an dem Verfahren. |
Begründung
Ein Vorschlag für die Verbesserung der Transparenz
Änderung 10
Artikel 8 Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Die Kommission wird von einer Sachverständigengruppe beratend unterstützt, der ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört. |
Die Kommission wird von einer Sachverständigengruppe beratend unterstützt, der ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehört, darunter auch jeweils ein Vertreter der regionalen und der lokalen Verwaltungsebene. |
Begründung
Die Einbindung der lokalen und regionalen Verwaltungsebene wäre von Vorteil, da öffentliche Dienste in Europa größtenteils von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften erbracht werden, und es sind gerade diese Dienste, die Bedeutung für den Alltag und die Freizügigkeit der Unternehmen und Bürger haben.
Änderung 11
Anhang — Abschnitt1 Punkt 2 Buchstabe (g)
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Dienstinfrastruktur für ein sicheres Internet: Dies bezieht sich auf eine Plattform für den Erwerb, den Betrieb und die Pflege gemeinsamer Rechenkapazitäten, Datenbanken und Softwarewerkzeuge für „Safer Internet“-Zentren (SICs) in den Mitgliedstaaten. Verwaltungsprozesse zur Bearbeitung von Meldungen über Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, einschließlich einer Verbindung zu Polizeibehörden und internationalen Organisationen wie Interpol, gegebenenfalls mit Veranlassung der Entfernung solcher Inhalte durch die betreffenden Websitebetreiber. Dies wird durch gemeinsame Datenbanken unterstützt. |
Dienstinfrastruktur für ein sicheres Internet: Dies bezieht sich auf eine Plattform für den Erwerb, den Betrieb und die Pflege gemeinsamer Rechenkapazitäten, Datenbanken und Softwarewerkzeuge sowie den Austausch bewährter Praktiken für „Safer Internet“-Zentren (SICs) in den Mitgliedstaaten. SICs in den Mitgliedstaaten, die einen Mehrwert für die EU bringen, sind wesentliche Voraussetzung für die Dienstinfrastruktur für ein sicheres Internet, für die nationale Beratungsstellen, Meldestellen, Sensibilisierungszentren und andere Aufklärungsmaßnahmen besonders wichtig sind. Verwaltungsprozesse zur Bearbeitung von Meldungen über Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, einschließlich einer Verbindung zu Polizeibehörden und internationalen Organisationen wie Interpol, gegebenenfalls mit Veranlassung der Entfernung solcher Inhalte durch die betreffenden Websitebetreiber. Dies wird durch gemeinsame Datenbanken und gemeinsame Softwaresysteme unterstützt. |
Begründung
Der Austausch bewährter Praktiken wäre für die SIC-Tätigkeiten sehr hilfreich.
Brüssel, den 8. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) CdR 39/2006.
(2) CdR 5/2008 fin.
(3) CdR 156/2009 fin.
(4) CdR 10/2009 fin.
(5) CdR 104/2010 fin.
(6) CdR 104/2010 fin.
(7) CdR 247/2009 fin.
(8) CdR 247/2009 fin.
(9) CdR 626/2012 fin.
(10) CdR 247/2009 fin.
(11) CdR 247/2009 fin.
(12) CDR1646-2013.
|
5.12.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 356/124 |
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen — Vorschlag für eine Richtlinie über die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement
2013/C 356/18
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
|
— |
weist darauf hin, dass die vorgeschlagene Richtlinie vor dem Hintergrund vorgelegt wird, dass viele Mitgliedstaaten bereits eine Politik für die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement verfolgen oder an deren Aufstellung arbeiten und dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hier Schlüsselakteure sind; macht darauf aufmerksam, dass der Vorschlag keine Auswirkungen auf die Zuständigkeiten auf der Ebene und innerhalb der Mitgliedstaaten im Bereich der Raumordnung haben darf; |
|
— |
ist der Ansicht, dass die Frage, ob die EU legislativ tätig werden sollte, noch immer ungelöst ist bzw. die Frage, wie die EU legislativ tätig werden sollte, ebenfalls angegangen werden muss; ist von daher der Auffassung, dass der Vorschlag in seiner derzeitigen Form gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt; |
|
— |
ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Richtlinie nicht genügend Flexibilität für die Umsetzung vorsieht, da sie (a) in die in einigen Mitgliedstaaten etablierten informellen Verfahren für das integrierte Küstenzonenmanagement eingreift und (b) vor allem die Vorschläge für das integrierte Küstenzonenmanagement unmittelbare Auswirkungen auf bestehende Befugnisse für die Raumordnungspolitik und -verfahren auf der regionalen und/oder lokalen Ebene haben; |
|
— |
unterstreicht nachdrücklich, dass eine Rahmenrichtlinie nicht den Inhalt maritimer Raumordnungspläne zum Gegenstand haben darf; |
|
— |
ist der Ansicht, dass im Wege einer Rahmenrichtlinie gemeinsame Grundsätze festgelegt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit zwischen den für Küstengebiete zuständigen nationalen Behörden erleichtert werden sollten, es aber ansonsten den Behörden der Mitgliedstaaten überlassen werden sollte, den Begriff „Küstengebiete“ erforderlichenfalls und entsprechend der Planungspolitik und den Planungsverfahren in ihren Gerichtsbarkeiten zu definieren; |
|
— |
betont, dass die vorgeschlagene Richtlinie in ihrer jetzigen Fassung negative Auswirkungen auf die lokale/regionale Planungspolitik und Planungsverfahren haben wird, da der Vorschlag sektorspezifische inhaltliche Mindestanforderungen für Raumordnungspläne mit Küstenbezug vorgeben wird, die die Planungsautonomie der Planungsbehörden massiv untergraben, die für einen Ausgleich zwischen allen geeigneten Nutzungsmöglichkeiten sorgen müssen. |
|
Berichterstatter |
Paul O'DONOGHUE (IE/ALDE); Mitglied des Grafschaftsrates von Kerry und der Regionalbehörde South West |
|
Referenzdokument |
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement COM(2013) 133 final |
I. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
Allgemeine Bemerkungen
|
1. |
unterstützt die allgemeinen Ziele der vorgeschlagenen Richtlinie: ein wirksameres Management von Meerestätigkeiten und eine effizientere Nutzung der Meeresressourcen; Entwicklung einer kohärenten und evidenzbasierten Beschlussfassung sowie verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem küsten- und dem meeresbezogenen Management; Erleichterung der konsequenten Umsetzung der wesentlichen politischen Ziele der EU (1) sowie Beitrag zu einem nachhaltigen Wachstum und der Entwicklung der „blauen Wirtschaft“; |
|
2. |
begrüßt die Bemühungen um eine bessere Koordinierung zwischen land- und seegestützten Tätigkeiten; befürwortet eine kohärente europäische Politik auf der Grundlage internationaler bewährter Verfahren, die etablierten nationalen Praktiken Rechnung trägt; spricht sich ferner für die Aufstellung gemeinsamer Grundsätze für die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement aus; |
|
3. |
weist darauf hin, dass die vorgeschlagene Richtlinie vor dem Hintergrund vorgelegt wird, dass viele Mitgliedstaaten bereits eine Politik für die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement verfolgen oder an deren Aufstellung arbeiten und dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hier Schlüsselakteure sind; macht darauf aufmerksam, dass der Vorschlag keine Auswirkungen auf die Zuständigkeiten auf der Ebene und innerhalb der Mitgliedstaaten im Bereich der Raumordnung haben darf; |
|
4. |
ist sich bewusst, dass die „maritime Raumordnung“ regelmäßige Absprachen unter den einzelnen Staaten erfordert, weswegen sich die Rolle der EU in diesem Bereich auf die Vorgabe eines Verfahrensrahmens bzw. von Verfahrensnormen beschränken sollte; |
|
5. |
bedauert, dass bei der Folgenabschätzung keine gezielte Konsultation lokaler und regionaler Gebietskörperschaften als Planungsbehörden und wesentliche Akteure für die Umsetzung der vorgeschlagenen Richtlinie stattgefunden hat; |
Rechtsgrundlage
|
6. |
ist sich bewusst, dass die vorgeschlagene Richtlinie eine Folge der Einführung der integrierten Meerespolitik aus dem Jahr 2007 sowie der Annahme einer Agenda für blaues Wachstum aus dem Jahr 2012 ist, kann jedoch einige der Bedenken nachvollziehen, die angesichts der verschiedenen Rechtsgrundlagen für die vorgeschlagene Richtlinie vorgebracht wurden; |
|
7. |
verweist in diesem Zusammenhang auf das Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates (2) bezüglich des Rückgriffs auf mehrere Rechtsgrundlagen für die vorgeschlagene Richtlinie; hält mehr Klarheit für erforderlich, falls die Europäische Kommission künftige Vorschläge auf mehrere Rechtsgrundlagen bzw. auf Artikel 3 (EUV-territorialer Zusammenhalt) stützt, was mittelbare bzw. unmittelbare Auswirkungen auf die Raumordnungspolitik und -praxis in den Mitgliedstaaten haben könnte; |
Subsidiaritätsprinzip und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
|
8. |
weist darauf hin, dass die Subsidiaritätsprüfung durch einzelstaatliche (und regionale) Parlamente neun negative begründete Stellungnahmen hervorbrachte (3); schließt sich der Auffassung an, dass Teile der vorgeschlagenen Richtlinie nicht den Ansprüchen an die Notwendigkeit und den Mehrwert von Rechtsvorschriften auf EU-Ebene genügen; |
|
9. |
verweist auf die in Bezug auf folgende Punkte vorgebrachten Bedenken: (a) Zuständigkeit — fehlende eindeutige Zuständigkeit auf EU-Ebene, während die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement in einigen Mitgliedstaaten bereits nationale, regionale und/oder Befugnisse sind; (b) unzureichende Berücksichtigung regionaler/lokaler Besonderheiten von Küstengebieten sowie etablierter Planungs- und Managementverfahren in der vorgeschlagenen Richtlinie; und (c) die Frage, ob EU-Rechtsvorschriften für spezifische grenzüberschreitende Probleme geeignet sind und ob die EU für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten als Ebene angemessen ist, wenn schon Seerechtsabkommen bestehen; |
|
10. |
ist der Ansicht, dass die Frage, ob die EU legislativ tätig werden sollte, noch immer ungelöst ist bzw. die Frage, wie die EU legislativ tätig werden sollte, ebenfalls angegangen werden muss; ist von daher der Auffassung, dass der Vorschlag in seiner derzeitigen Form gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt; |
|
11. |
hält die vorgeschlagene Richtlinie für zu normativ; kann der Auflistung der Mindestanforderungen in den Artikeln 6 bis 8 nicht zustimmen, da diese den Spielraum für die Festlegung von Prioritäten auf der regionalen oder lokalen Ebene einschränken und im Widerspruch zu den genannten Zielen der Richtlinie stehen, die verfahrenstechnischer Art sein und nicht in Planungsdetails eingreifen sollen; |
|
12. |
ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Richtlinie nicht genügend Flexibilität für die Umsetzung vorsieht, da sie (a) in die in einigen Mitgliedstaaten etablierten informellen Verfahren für das integrierte Küstenzonenmanagement eingreift und (b) vor allem die Vorschläge für das integrierte Küstenzonenmanagement unmittelbare Auswirkungen auf bestehende Befugnisse für die Raumordnungspolitik und -verfahren auf der regionalen und/oder lokalen Ebene haben; |
|
13. |
bemängelt den normativen Ansatz bei weiteren Aspekten des Vorschlags, wie etwa die Vorgabe von Zeitplänen für die Überprüfung der Pläne und Strategien (Artikel 6) oder die Berichterstattungsanforderungen (Artikel 15); sieht in der hiermit verbundenen Zunahme an Bürokratie, Verwaltungslasten und Kosten für die Umsetzung der Richtlinie vor allem auf der lokalen Ebene eine weitere Schwächung ihres Mehrwerts; |
|
14. |
hegt Bedenken bezüglich des vorgeschlagenen Einsatzes weiterer Durchführungsrechtsakte für die operativen Schritte zur Erarbeitung von Plänen und Strategien (Artikel 16); ist der Auffassung, dass dies über das für die Umsetzung der Verpflichtungen der Richtlinie Erforderliche hinausgeht und den Anschein erweckt, dass die Europäische Kommission die Richtlinie in ihrer derzeit vorgeschlagenen Form für verstärkungsbedürftig hält; regt an, dass der vorgeschlagene Einsatz von Durchführungsrechtsakten überdacht werden sollte und diese sich auf rein verfahrenstechnische Aspekte beschränken sollten; |
Maritime Raumordnungspläne
|
15. |
unterstützt voll und ganz die Aufstellung maritimer Raumordnungspläne als fachübergreifendes Instrument zur Erleichterung der Umsetzung des ökosystemorientierten Ansatzes, zur Unterstützung einer rationellen Nutzung der Meeresressourcen, zur Vereinbarkeit konkurrierender Tätigkeiten und zur Minimierung der Auswirkungen auf die Meeresumwelt sowie zur Gewährleistung der Resilienz von Küsten- und Meeresgebieten; spricht sich ferner für ein planmäßiges Konzept mit klaren Vorgaben zur Sicherung langfristiger Investitionen aus, was den Beitrag der maritimen Tätigkeiten zu den Zielen der Europa-2020-Strategie vergrößern würde; |
|
16. |
betont, dass die maritime Raumordnung als neutrales Planungsinstrument entwickelt werden muss, das einen gewissen Grad an Flexibilität vorsieht, um Politikgestaltungsprozesse auf unterschiedliche Meeresumwelten abstimmen zu können; bittet ferner um eine Klärung des Anwendungsbereichs des ökosystemorientierten Ansatzes in dem Vorschlag für eine Richtlinie, da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftsentwicklung und Umweltschutz erforderlich ist; lehnt daher die Aufstellung von oben vorgegebener Prioritäten und Mindestanforderungen für Managementpläne ab und spricht sich gegen eine Nutzung der maritimen Raumordnungspläne als Instrument für die Sicherstellung der Umsetzung sektorspezifischer politischer Ziele aus; |
|
17. |
hält die vorgeschlagene Richtlinie in ihrer jetzigen Form für zu ausführlich und nicht flexibel genug, um folgenden Aspekten umfassend Rechnung zu tragen: bestehenden Verfahren bei der maritimen Raumordnung; dem Erfordernis, die Aufstellung von Managementprioritäten auch weiterhin auf der nationalen oder subnationalen Ebene zu belassen; der regionalen Besonderheit der Ressource Meer; |
|
18. |
unterstützt jedoch die Annahme einer Rahmenrichtlinie für die Aufstellung von maritimen Raumordnungsplänen in der Europäischen Union, mit der unter Berücksichtigung bestehender Verfahren in den Mitgliedstaaten Folgendes erreicht werden sollte: Einführung der Verpflichtung zu maritimen Raumordnungsplänen; Festlegung gemeinsamer Grundsätze; Festsetzung der Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Koordinierung maritimer Pläne; Festlegung von Grundsätzen für die Vereinbarkeit konkurrierender Nutzungen des Meeres sowie konkurrierender Ziele verschiedener maritimer Raumordnungspläne; |
|
19. |
unterstreicht nachdrücklich, dass eine Rahmenrichtlinie nicht den Inhalt maritimer Raumordnungspläne zum Gegenstand haben darf; |
|
20. |
weist darauf hin, dass er die maritime Raumordnung unterstützt, für die Entwicklung der „blauen Wirtschaft“ jedoch ein integriertes Management erforderlich ist, für das die maritime Raumordnung zwar ein Teil der Lösung, nicht aber die Lösung an sich darstellt; betont ferner, dass die meerespolitische Entscheidungsfindung verbessert werden muss; |
|
21. |
ist daher überrascht, dass in dem Vorschlag für eine Richtlinie trotz seines normativen Charakters nicht auf die erforderlichen Grundsätze für diese Entscheidungsfindung eingegangen wird; hält daher für die Meerespolitik und zumal für die maritime Raumordnung einen fach- und ebenenübergreifenden Ansatz für erforderlich; weist darauf hin, dass die Verwaltung der Hoheitsgewässer und der ausschließlichen Wirtschaftszonen den Mitgliedstaaten obliegt, während die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aufgrund ihrer Befugnisse für Raumordnung und Verwaltung für Kohärenz und die Koordinierung zwischen der maritimen und terrestrischen Raumplanung sorgen können; |
Integriertes Küstenzonenmanagement
|
22. |
unterstreicht, dass er das integrierte Küstenzonenmanagement schon lange befürwortet und unterstützt und sich bewusst ist, dass dieses eine wichtige Rolle für das Erreichen von Synergien zwischen Planungsrahmen für maritime und terrestrische Umgebungen sowie für die Herbeiführung eines Konsenses zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren spielen kann; |
|
23. |
macht auf die Begriffsbestimmung für ein „Küstengebiet“ (Artikel 3 Absatz 1) und insbesondere auf die Auswirkungen dieser Begriffsbestimmung auf die lokalen/regionalen Planungsbehörden aufmerksam; hält die Einbeziehung der äußeren Grenze der Hoheitsgewässer in die Festlegung der seewärtigen Grenze für sehr weit gefasst und über den Zuständigkeitsbereich bestehender Planungsbehörden in vielen Mitgliedstaaten hinausgehend (bzw. die Kapazitäten ihrer Human- und Finanzressourcen übersteigend); hält ferner die festgelegte landwärtige Grenze für nicht deutlich genug und befürchtet hier unmittelbare Auswirkungen auf etablierte Flächennutzungspläne und -verfahren; |
|
24. |
ist der Ansicht, dass im Wege einer Rahmenrichtlinie gemeinsame Grundsätze festgelegt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit zwischen den für Küstengebiete zuständigen nationalen Behörden erleichtert werden sollten, es aber ansonsten den Behörden der Mitgliedstaaten überlassen werden sollte, den Begriff „Küstengebiete“ erforderlichenfalls und entsprechend der Planungspolitik und den Planungsverfahren in ihren Gerichtsbarkeiten zu definieren; |
|
25. |
ist der Auffassung, dass bei der Schnittstelle zwischen land- und seegestützter Planung stärker ganzheitlich vorgegangen werden muss, da die Verbindungen zwischen Land und See über das „Küstengebiet“ hinausgehen (wie z.B. der Einfluss von Wassereinzugsgebieten weiter landeinwärts, die Auswirkungen von Häfen als Zentren der Regionalentwicklung, die Vernetzung von Verkehrswegen und Energieerzeugungs- und -übertragungssystemen usw.), und hält mehr Flexibilität für die Mitgliedstaaten für erforderlich, damit sie selbst entscheiden können, welche Instrumente sie einsetzen wollen, um eine effiziente Koordinierung zwischen land- und seegestützten Tätigkeiten zu ermöglichen; |
|
26. |
hegt Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Umwandlung eines derzeit informellen Managementansatzes in ein zusätzliches formales Planungsinstrument; ist nicht überzeugt von Artikel 2 Absatz 3, der besagt, dass „die Bestimmungen dieser Richtlinie nicht die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der Städteplanung berühren“, da er Rechtsvorschriften für das integrierte Küstenzonenmanagement zu den Rechtsvorschriften für die terrestrische Raumordnung zählt, die vornehmlich eine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ist, auch wenn in einigen Staaten die Regionen über diesbezügliche Gesetzgebungsbefugnisse verfügen; ist der Ansicht, dass die Umsetzung der Richtlinie unmittelbare Auswirkungen auf die Praxis der Raumordnung auf der nationalen, regionalen und lokalen Ebene haben wird, weswegen er ernsthafte Bedenken gegen eine Verpflichtung zur Aufstellung von Strategien für das integrierte Küstenzonenmanagement in allen Mitgliedstaaten mit Küstenbezug anmeldet (4); |
|
27. |
verweist auf die IKZM-Empfehlung aus dem Jahr 2002, der zufolge „sich die Ziele der vorgeschlagenen Aktion angesichts der verschiedenen Voraussetzungen in den Küstengebieten und der Unterschiede im rechtlichen und institutionellen Rahmen der Mitgliedstaaten am besten erreichen [lassen], wenn eine Orientierung auf Gemeinschaftsebene gegeben wird“ (5); ist der Ansicht, dass sich seitdem wenig geändert hat und bedauert, dass die Europäische Kommission nicht alle nichtbindenden Optionen für die Stärkung der Umsetzung des integrierten Küstenzonenmanagements eingehend geprüft hat; |
|
28. |
sieht im integrierten Küstenzonenmanagement jedoch auch weiterhin eine wichtige Ergänzung zur maritimen Raumordnung sowie eine große Hilfe bei der Verwaltung der Küstenressourcen und der Einbindung der beteiligten Akteure; fordert die Europäische Kommission auf zu überdenken, wie diese Funktionen gestärkt werden könnten, und besser geeignete nichtbindende Maßnahmen zu entwickeln; schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten beurteilen sollten, welche spezifischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine stärkere Kohärenz zwischen Flächennutzungs- und maritimen Raumordnungsplänen sicherzustellen; |
Auswirkungen auf die lokale und regionale Ebene
|
29. |
verweist auf die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Raumordnungspolitik, einschließlich bestehender Praktiken bei der maritimen Raumordnung und dem integrierten Küstenzonenmanagement; weist ferner darauf hin, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften bereits eine bilaterale grenzüberschreitende Koordinierung in der Raumordnungspolitik vornehmen; |
|
30. |
unterstützt bestehende regionale Kooperationsinitiativen auf makroregionaler Ebene oder auf der Ebene von Meeresgebieten; bedauert, dass die Vielfalt der Meeresumwelten und das Potenzial einer engeren Zusammenarbeit unter Berücksichtigung dieser regionalen Besonderheiten in der vorgeschlagenen Richtlinie nicht explizit berücksichtigt werden; vertritt ferner die Ansicht, dass auch die Unvorhersehbarkeit im Kontakt mit einigen Drittstaaten und die Komplexität der Thematik der Regionen in äußerster Randlage in den Bestimmungen berücksichtigt werden müssen; |
|
31. |
ist der Auffassung, dass die etwaigen beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen der vorgeschlagenen Richtlinie auf die lokale/regionale Ebene erheblich sein könnten, insbesondere in Bezug auf (a) bestehende Befugnisse auf der lokalen/regionalen Ebene bei der Planungspolitik und Planungsverfahren und (b) im Sinne der Aufbürdung zusätzlicher administrativer und finanzieller Lasten; |
|
32. |
betont, dass die vorgeschlagene Richtlinie in ihrer jetzigen Fassung negative Auswirkungen auf die lokale/regionale Planungspolitik und Planungsverfahren haben wird, da der Vorschlag sektorspezifische inhaltliche Mindestanforderungen für Raumordnungspläne mit Küstenbezug vorgeben wird, die die Planungsautonomie der Planungsbehörden massiv untergraben, die für einen Ausgleich zwischen allen geeigneten Nutzungsmöglichkeiten sorgen müssen; |
|
33. |
hält den vorgeschlagenen Zeitrahmen, dass maritime Raumordnungspläne und Strategien für das Küstenzonenmanagement innerhalb von 36 Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie vorliegen müssen, für sehr ehrgeizig; weist darauf hin, dass eine solche Zeitvorgabe unmöglich einzuhalten ist, wo maritime Raumordnungspläne und das integrierte Küstenzonenmanagement noch in den Kinderschuhen stecken; schlägt daher eine Verlängerung dieser Zeitrahmen vor; |
|
34. |
stellt insbesondere die Logik in Frage, dass maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement mindestens alle sechs Jahre überprüft werden müssen, da dies ein äußerst schwieriges und kostspieliges Unterfangen für die zuständigen Behörden sein wird und nicht notwendigerweise etablierten Überprüfungszyklen für die Pläne in den Mitgliedstaaten entspricht; |
|
35. |
macht darauf aufmerksam, dass die Umsetzung den Planungsbehörden auf der lokalen und regionalen Ebene erhebliche zusätzliche Lasten auferlegen wird und sie zudem in Zeiten knapper Kassen der Notwendigkeit aussetzt, zusätzliche Finanz- und Humanressourcen — darunter rar gesäte Fachleute für die maritime Raumordnungsplanung — zu finden, um den Anforderungen der Richtlinie zu entsprechen; |
|
36. |
ist besorgt, dass die Europäische Kommission keine ausführliche Einschätzung in Bezug auf das Ausmaß der zusätzlichen Verwaltungslast und der Umsetzungskosten vorgenommen hat, die zu einem großen Teil von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu tragen sein werden; ist der Auffassung, dass diese Auswirkungen den Mehrwert der vorgeschlagenen Richtlinie für diese Gebietskörperschaften schmälern bzw. aufheben; |
|
37. |
regt daher an, dass die Europäische Kommission ex ante folgende Aspekte prüfen und deren Folgen abschätzen sollte: (a) die Auswirkungen der Richtlinie auf die bestehenden Verfahren und die Praxis für die Raumordnung in Küstengebieten; und (b) die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung der Richtlinie, insbesondere auf der lokalen und regionalen Ebene; |
II. EMPFEHLUNGEN FÜR ÄNDERUNGEN
Änderung 1
Erwägungsgrund 3
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Mit der integrierten Meerespolitik werden maritime Raumordnung und integriertes Küstenzonenmanagement als sektorübergreifende Instrumente der Politikgestaltung für Behörden und Interessenträger festgelegt, um für ein koordiniertes und integriertes Konzept zu sorgen. Die Anwendung eines ökosystemorientierten Ansatzes wird zur Förderung des nachhaltigen Wachstums der Meeres- und Küstenwirtschaft und der nachhaltigen Nutzung der Meeres- und Küstenressourcen beitragen. |
Mit der integrierten Meerespolitik werden maritime Raumordnung und integriertes Küstenzonenmanagement als sektorübergreifende Instrumente der Politikgestaltung für Behörden und Interessenträger festgelegt, um für ein koordiniertes, und integriertes und grenzübergreifendes Konzept zu sorgen. Die Anwendung eines ökosystemorientierten Ansatzes wird zur Förderung des nachhaltigen Wachstums der Meeres- und Küstenwirtschaft und der nachhaltigen Nutzung der Meeres- und Küstenressourcen beitragen. |
Begründung
Die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist für die integrierte Meerespolitik unerlässlich, vor allem für die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement.
Änderung 2
Erwägungsgrund 12
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
Auch wenn es sinnvoll ist, dass die Europäische Union Regeln für maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement vorgibt, sind die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden dennoch weiterhin dafür verantwortlich, für ihre Meeresgewässer und Küstengebiete den Inhalt solcher Pläne und Strategien festzulegen, einschließlich der Aufteilung von Meeresraum auf die verschiedenen sektorspezifischen Tätigkeiten. |
Auch wenn es sinnvoll ist, dass die Europäische Union einen Rahmen Regeln für maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement vorgibt, sind die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden dennoch weiterhin dafür verantwortlich, für ihre Meeresgewässer und Küstengebiete den Inhalt solcher Pläne und Strategien festzulegen, einschließlich der Aufteilung von Meeresraum auf die verschiedenen sektorspezifischen Tätigkeiten sowie der Nutzung von Meeresräumen. |
Änderung 3
Artikel 3 Absatz 2
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
„Integrierte Meerespolitik“: EU-Politik mit dem Ziel, eine koordinierte und kohärente Entscheidungsfindung zu fördern, um die nachhaltige Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und den sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, vor allem hinsichtlich der Küsten- und Inselgebiete und der Regionen in äußerster Randlage in der Europäischen Union sowie hinsichtlich der maritimen Wirtschaftssektoren, durch eine kohärente meeresbezogene Politik und entsprechende internationale Zusammenarbeit zu maximieren. |
„Integrierte Meerespolitik“EU-Politik mit dem Ziel, eine koordiniertes und kohärentes sektor- und grenzübergreifendes meerespolitisches Handeln Entscheidungsfindung zu fördern, um die nachhaltige Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und den sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, vor allem hinsichtlich der Küsten- und Inselgebiete und der Regionen in äußerster Randlage in der Europäischen Union sowie hinsichtlich der maritimen Wirtschaftssektoren, durch eine kohärente meeresbezogene Politik und entsprechende internationale Zusammenarbeit zu maximieren. |
Änderung 4
Artikel 5
Ziele von maritimen Raumordnungsplänen und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
||||||||
|
Maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement beruhen auf einem ökosystemorientierten Ansatz, um die Koexistenz zwischen konkurrierenden sektorspezifischen Tätigkeiten in Meeresgewässern und Küstengebieten zu erleichtern und Konflikte zu vermeiden, und sollten so ausgelegt sein, dass sie zu folgenden Zielen beitragen:
|
Maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement beruhen auf einem ökosystemorientierten Ansatz, um die Koexistenz zwischen konkurrierenden sektorspezifischen Tätigkeiten in Meeresgewässern und Küstengebieten zu erleichtern und Konflikte zu vermeiden, und sollten Ziele enthalten, über die u.a. auch zu Folgendem beigetragen werden kann so ausgelegt sein, dass sie zu folgenden Zielen beitragen:
|
Begründung
Es sollte deutlich hervorgehen, dass die in dem Richtlinienvorschlag genannten Ziele nur als Beispiele dienen. Den zuständigen Behörden muss ausreichend Flexibilität eingeräumt werden, um die für ihre Meeresumwelt geeigneten Prioritäten und deren Umsetzung selbst festzulegen.
Änderung 5
Artikel 6
Spezifische Mindestanforderungen für maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
||||||||||||
|
1. Durch maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement werden operative Schritte festgelegt, um die in Artikel 5 aufgeführten Ziele unter Berücksichtigung aller relevanten Tätigkeiten und Maßnahmen zu erreichen. 2. Dabei müssen maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement zumindest
3. Maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement müssen mindestens alle sechs Jahre überprüft werden. |
1. Durch maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement werden operative Schritte festgelegt, um die in Artikel 5 aufgeführten Ziele unter Berücksichtigung aller relevanten Tätigkeiten und Maßnahmen zu erreichen. 2. Dabei müssen maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement zumindest
3. Maritime Raumordnungspläne und Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement müssen gemäß dem nationalen Überprüfungszyklus für die Pläne mindestens alle sechs Jahre überprüft werden. |
Begründung
Die Umsetzungszyklen werden von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein müssen, um die Verwaltungslast zu verringern und sicherzustellen, dass die Richtlinie gemäß den bestehenden und etablierten Praktiken in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird.
Änderung 6
Artikel 7
Spezifische Mindestanforderungen für maritime Raumordnungspläne
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Maritime Raumordnungspläne enthalten zumindest Kartendarstellungen der Meeresgewässer, in denen die tatsächliche und potenzielle räumliche und zeitliche Verteilung aller relevanten maritimen Tätigkeiten verzeichnet ist, um die Ziele gemäß Artikel 5 zu erreichen. 2. In die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden maritimen Raumordnungspläne fließen mindestens folgende Elemente ein:
|
1. Maritime Raumordnungspläne enthalten zumindest Kartendarstellungen der Meeresgewässer, in denen die tatsächliche und potenzielle räumliche und zeitliche Verteilung aller relevanten maritimen Tätigkeiten verzeichnet ist, um die Ziele gemäß Artikel 5 zu erreichen. 2. In die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden maritimen Raumordnungspläne sollten von ihnen als relevant betrachtete Tätigkeiten einfließen, darunter z.B. mindestens folgende Elemente ein:
|
Begründung
Den zuständigen Behörden muss ausreichende Flexibilität gelassen werden, um die für ihre Meeresumwelt geeigneten Prioritäten und deren Umsetzung selbst festzulegen.
In einigen Gebieten in Europa sind die Freizeitaktivitäten sehr ausgeprägt, weswegen sie in der Raumordnung berücksichtigt werden müssen; auch die Hafengebiete müssen als starke Faktoren in der maritimen und auch der terrestrischen Raumordnung eingeplant werden (Straßen- und Schienennetz usw.).
Änderung 7
Artikel 8
Spezifische Mindestanforderungen für Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
||||||||||||||||||||||||
|
1. Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement umfassen mindestens eine Übersicht über die in Küstengebieten geltenden Maßnahmen sowie eine Analyse, inwieweit zur Erreichung der in Artikel 5 genannten Ziele zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. In den Strategien ist eine integrierte, sektorübergreifende Umsetzung der Politik vorzusehen, und es sind Wechselwirkungen zwischen landgestützten und seegestützten Tätigkeiten zu berücksichtigen. 2. In die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement fließen mindestens folgende Elemente ein:
|
1. Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement umfassen mindestens eine Übersicht über die in Küstengebieten geltenden Maßnahmen sowie eine Analyse, inwieweit zur Erreichung der in Artikel 5 genannten Ziele zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. In den Strategien ist eine integrierte, sektorübergreifende Umsetzung der Politik vorzusehen, und es sind Wechselwirkungen zwischen landgestützten und seegestützten Tätigkeiten zu berücksichtigen. 2. In die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden Strategien zum integrierten Küstenzonenmanagement fließen mindestens folgende Elemente ein:
|
Begründung
Rechtsvorschriften zum integrierten Küstenzonenmanagement sind im Grunde genommen dasselbe wie Rechtsvorschriften zur Raumordnung — und die ist Sache der Mitgliedstaaten. Zudem ist der Mehrwert der Formalisierung eines bestehenden informellen Managementinstruments eher gering.
Änderung 8
Artikel 14
Zuständige Behörden
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
|
1. Jeder Mitgliedstaat benennt für jedes betroffene Küstengebiet und jede betroffene Meeresregion bzw. -unterregion die Behörde(n), die für die Umsetzung dieser Richtlinie, einschließlich der Sicherstellung der Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 12 und der Zusammenarbeit mit Drittländern gemäß Artikel 13, zuständig ist bzw. sind. 2. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission zusammen mit den in Anhang I dieser Richtlinie genannten Informationen eine Liste der zuständigen Behörden. 3. Gleichzeitig übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission eine Liste seiner Behörden, die für die internationalen Gremien, in denen sie mitwirken und die für die Durchführung dieser Richtlinie relevant sind, zuständig sind. 4. Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über jede Änderung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen innerhalb von sechs Monaten nach Wirksamwerden der entsprechenden Änderung. |
1. Jeder Mitgliedstaat benennt unter Berücksichtigung des Erfordernisses eines starken fach- und ebenenübergreifenden Ansatzes für jedes betroffene Küstengebiet und jede betroffene Meeresregion bzw. -unterregion die Behörde(n), die für die Umsetzung dieser Richtlinie, einschließlich der Sicherstellung der Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 12 und der Zusammenarbeit mit Drittländern gemäß Artikel 13, zuständig ist bzw. sind. 2. Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission zusammen mit den in Anhang I dieser Richtlinie genannten Informationen eine Liste der zuständigen Behörden. 3. Gleichzeitig übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission eine Liste seiner Behörden, die für die internationalen Gremien, in denen sie mitwirken und die für die Durchführung dieser Richtlinie relevant sind, zuständig sind. 4. Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über jede Änderung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen innerhalb von sechs Monaten nach Wirksamwerden der entsprechenden Änderung. |
Begründung
Mit der Änderung soll das Erfordernis eines ebenenübergreifenden Ansatzes bei der Umsetzung der Richtlinie betont werden.
Änderung 9
Artikel 16
Durchführungsrechtsakte
|
Kommissionsvorschlag |
Änderung des AdR |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen zu folgenden Punkten erlassen:
|
1. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen zu folgenden Punkten erlassen:
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. |
2. Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. |
Begründung
Bezüglich des Einsatzes von Durchführungsrechtsakten bestehen erhebliche Bedenken, insbesondere mit Blick auf operative Aspekte der Aufstellung von Plänen und Strategien, die über das für die Umsetzung der Verpflichtungen der Richtlinie erforderliche Maß hinausgehen.
Brüssel, den 9. Oktober 2013
Der Präsident des Ausschusses der Regionen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Insbesondere die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie sowie die überarbeitete Gemeinsame Fischereipolitik.
(2) Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates vom 12. Juli 2013 (12283/13).
(3) BE, DE, FI, IE, LT, NL, PL, SE gaben negative begründete Stellungnahmen ab, PT und RO zwei positive Stellungnahmen.
(4) Den Mitgliedstaaten im Mittelmeerraum werden bereits durch das Übereinkommen von Barcelona einige Verpflichtungen auferlegt.
(5) Empfehlung zur Umsetzung einer Strategie für ein integriertes Management der Küstengebiete in Europa (2002/413/EG), Erwägungsgrund 17.