

This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52024XC05687
Commission Notice – Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights and on Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents
Mitteilung der Kommission — Leitlinien für die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen
Mitteilung der Kommission — Leitlinien für die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen
C/2024/6546
ABl. C, C/2024/5687, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5687/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5687/oj
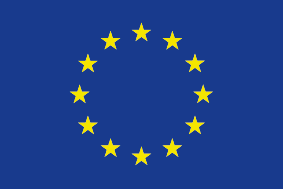
|
Amtsblatt |
DE Reihe C |
|
C/2024/5687 |
25.9.2024 |
MITTEILUNG DER KOMMISSION
Leitlinien für die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen
(C/2024/5687)
INHALTSVERZEICHNIS
|
1. |
EINLEITUNG | 3 |
|
2. |
ANWENDUNGSBEREICH DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 | 5 |
|
2.1. |
Räumlicher Anwendungsbereich | 5 |
|
2.1.1. |
Geografischer Anwendungsbereich | 5 |
|
2.1.2. |
Der Begriff „Flug“ im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a | 6 |
|
2.1.3. |
Flüge innerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 6 |
|
2.1.4. |
Flüge außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 7 |
|
2.1.5. |
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in Bezug auf in einem Drittland erhaltene Ausgleichs- oder Unterstützungsleistungen und die Auswirkungen auf die Rechte der Empfänger im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 7 |
|
2.2. |
Sachlicher Anwendungsbereich | 8 |
|
2.2.1. |
Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf Fluggäste von Hubschraubern | 8 |
|
2.2.2. |
Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf Fluggäste, die kostenlos oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar verfügbar ist | 8 |
|
2.2.3. |
Anwesenheitspflicht der Fluggäste bei der Abfertigung | 8 |
|
2.2.4. |
Anwendung auf ausführende Luftfahrtunternehmen | 9 |
|
2.2.5. |
Vorkommnisse, für die die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt | 9 |
|
2.2.6. |
Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf multimodale Reisen | 9 |
|
2.2.7. |
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in Bezug auf die Richtlinie (EU) 2015/2302 (Richtlinie über Pauschalreisen) | 9 |
|
3. |
VORKOMMNISSE, DIE ANSPRÜCHE IM RAHMEN DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 BEGRÜNDEN | 10 |
|
3.1. |
Nichtbeförderung | 10 |
|
3.1.1. |
Begriff „Nichtbeförderung“ | 10 |
|
3.1.2. |
Ansprüche wegen Nichtbeförderung | 11 |
|
3.2. |
Annullierung | 12 |
|
3.2.1. |
Definition der Annullierung | 12 |
|
3.2.2. |
Änderung der Abflugzeit | 12 |
|
3.2.3. |
Fall eines Luftfahrzeugs, das zum Abflugort zurückkehrt | 12 |
|
3.2.4. |
Umgeleiteter Flug | 13 |
|
3.2.5. |
Beweislast im Falle einer Annullierung | 13 |
|
3.2.6. |
Ansprüche wegen Annullierung | 13 |
|
3.3. |
Verspätung | 13 |
|
3.3.1. |
Verspätung beim Abflug | 13 |
|
3.3.2. |
„Große Verspätung“ bei Ankunft | 13 |
|
3.3.3. |
Ausmaß der Verspätung bei der Ankunft und Begriff der Ankunftszeit | 13 |
|
3.4. |
Höherstufung und Herabstufung | 14 |
|
3.4.1. |
Definition von Höherstufung und Herabstufung | 14 |
|
3.4.2. |
Ansprüche bei Höherstufung oder Herabstufung | 14 |
|
4. |
FLUGGASTRECHTE | 15 |
|
4.1. |
Recht auf Information | 15 |
|
4.1.1. |
Allgemeines Recht auf Information | 15 |
|
4.1.2. |
Bei Verspätung, Nichtbeförderung oder Annullierung zu erteilende Informationen | 15 |
|
4.2. |
Anspruch auf Erstattung, anderweitige Beförderung oder Umbuchung bei Nichtbeförderung oder Annullierung | 16 |
|
4.3. |
Anspruch auf Betreuungsleistungen bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung beim Abflug | 18 |
|
4.3.1. |
Der Begriff „Anspruch auf Betreuungsleistungen“ | 18 |
|
4.3.2. |
Bereitstellung von Mahlzeiten, Erfrischungen und Unterbringung | 18 |
|
4.3.3. |
Betreuung unter außergewöhnlichen Umständen oder bei außergewöhnlichen Vorkommnissen | 20 |
|
4.4. |
Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung, Annullierung, Verspätung bei der Ankunft und anderweitiger Beförderung sowie auf Erstattung bei Herabstufung | 20 |
|
A. |
Allgemeines | 20 |
|
B. |
Ausgleich bei Nichtbeförderung | 20 |
|
4.4.1. |
Ausgleich, Nichtbeförderung und außergewöhnliche Umstände | 20 |
|
4.4.2. |
Ausgleich, Nichtbeförderung und Anschlussflüge | 20 |
|
4.4.3. |
Höhe der Ausgleichsleistung | 21 |
|
C. |
Ausgleich bei Annullierung | 21 |
|
4.4.4. |
Allgemeiner Fall | 21 |
|
4.4.5. |
Höhe der Ausgleichsleistung | 21 |
|
4.4.6. |
Verpflichtung zur Unterrichtung der Fluggäste | 21 |
|
D. |
Ausgleichsleistung bei großer Verspätung bei der Ankunft | 22 |
|
4.4.7. |
„Große Verspätung“ bei der Ankunft | 22 |
|
4.4.8. |
Ausgleich bei großer Verspätung bei der Ankunft im Falle von Anschlussflügen | 22 |
|
4.4.9. |
Ausgleich für große Verspätung bei Ankunft, wenn ein Fluggast einen Flug zu einem anderen Flughafen als den seiner Buchung akzeptiert | 22 |
|
4.4.10. |
Höhe der Ausgleichsleistung | 23 |
|
4.4.11. |
Berechnung der Entfernung auf Basis der „Reise“ zwecks Festlegung des Ausgleichs bei großer Verspätung am Endziel | 23 |
|
E. |
Ausgleich bei anderweitiger Beförderung | 23 |
|
4.4.12. |
Verpflichtung zur rechtzeitigen anderweitigen Beförderung von Fluggästen | 23 |
|
4.4.13. |
Anderweitige Beförderung und Ankunft mehr als 2 Stunden, aber weniger als 3 Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit | 24 |
|
F. |
Erstattung bei Herabstufung | 24 |
|
4.4.14. |
Berechnung des Betrags | 24 |
|
G. |
Weiter gehender Schadensersatz | 24 |
|
5. |
AUẞERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE | 24 |
|
5.1. |
Grundsatz | 24 |
|
5.2. |
„Interne“ und „externe“ Vorkommnisse | 25 |
|
5.2.1. |
Begriff | 25 |
|
5.2.2. |
„Interne“ Vorkommnisse | 25 |
|
5.2.3. |
Externe Vorkommnisse | 27 |
|
5.3. |
Zumutbare Maßnahmen, die von einem Luftfahrtunternehmen im Falle von außergewöhnlichen Umständen erwartet werden können | 28 |
|
5.4. |
Außergewöhnliche Umstände bei einem früheren Flug mit demselben Luftfahrzeug | 29 |
|
6. |
FLUGGASTRECHTE BEI MASSIVEN REISEUNTERBRECHUNGEN | 29 |
|
6.1. |
Allgemeines | 29 |
|
6.2. |
Recht auf anderweitige Beförderung oder Erstattung | 29 |
|
6.3. |
Anspruch auf Betreuungsleistungen | 30 |
|
6.4. |
Ausgleichsanspruch | 30 |
|
7. |
AUSGLEICH, ERSTATTUNG, ANDERWEITIGE BEFÖRDERUNG UND BETREUUNG BEI MULTIMODALEN REISEN | 31 |
|
8. |
BESCHWERDEN BEI NATIONALEN DURCHSETZUNGSSTELLEN, STELLEN FÜR ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ IM RAHMEN DER VERORDNUNG ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT IM VERBRAUCHERSCHUTZ | 31 |
|
8.1. |
Beschwerden bei nationalen Durchsetzungsstellen | 31 |
|
8.2. |
Alternative Streitbeilegung (AS) | 32 |
|
8.3. |
Weitere Mittel zur Unterstützung der Beteiligten bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 32 |
|
9. |
EINREICHUNG VON KLAGEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 | 33 |
|
9.1. |
Zuständigkeit für die Klageerhebung nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 33 |
|
9.2. |
Frist für die Erhebung einer Klage nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 | 34 |
|
10. |
HAFTUNG DES LUFTFAHRTUNTERNEHMENS NACH DEM ÜBEREINKOMMEN VON MONTREAL | 34 |
1. EINLEITUNG
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) trat am 17. Februar 2005 in Kraft. Sie legt ein Mindestniveau für Qualitätsstandards zum Schutz der Fluggäste fest, wodurch die Liberalisierung des Luftverkehrsmarkts um eine für die Verbraucher wichtige Dimension ergänzt wird.
Zu den im Verkehrsweißbuch der Kommission vom 28. März 2011 (2) angekündigten Initiativen gehört unter anderem die „[e]inheitliche Auslegung der EU-Vorschriften über Passagierrechte und ihre einheitliche und wirksame Durchsetzung, um gleiche Ausgangsbedingungen für die Wirtschaft und einen europäischen Schutzstandard für die Bürger zu gewährleisten“.
Im Hinblick auf den Luftverkehr wies die Kommission in ihrer Mitteilung vom 11. April 2011 (3) darauf hin, dass die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 wegen der Grauzonen und Lücken im derzeitigen Wortlaut unterschiedlich ausgelegt und je nach Mitgliedstaat unterschiedlich durchgesetzt wurden. Darüber hinaus machte die Mitteilung deutlich, dass Fluggäste Probleme hatten, ihre individuellen Ansprüche geltend zu machen.
Am 29. März 2012 nahm das Europäische Parlament (EP) eine Entschließung (4) als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission vom 11. April 2011 an. Das Parlament hob die Maßnahmen hervor, die seines Erachtens wesentlich dafür waren, das Vertrauen der Fluggäste zurückzugewinnen, namentlich eine ordnungsgemäße Anwendung der bestehenden Bestimmungen durch die Mitgliedstaaten und die Luftfahrtunternehmen, die Durchsetzung von ausreichenden und einfachen Rechtsbehelfen und die Bereitstellung genauer Informationen für Fluggäste bezüglich ihrer Rechte.
Um die Rechte zu präzisieren, eine bessere Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 durch die Luftfahrtunternehmen zu gewährleisten und die Durchsetzung der Verordnung durch die nationalen Durchsetzungsstellen zu gewährleisten, hat die Kommission im Jahr 2013 einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 vorgelegt (5) (6). Der Vorschlag wird derzeit durch den EU-Gesetzgeber geprüft (7).
Wie in ihrer Mitteilung vom 7. Dezember 2015 über eine Luftfahrtstrategie für Europa (8) angekündigt, hat die Kommission 2016 Auslegungsleitlinien zur Verordnung (EG) Nr. 261/2004 und zur Verordnung (EG) Nr. 2027/97 (9) des Rates angenommen.
Die Rechtsprechung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004. Der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden der „Gerichtshof“) wurde häufig von nationalen Gerichten um Klärung bestimmter Vorschriften ersucht, auch wesentlicher Aspekte der Verordnung. Seine Auslegungsurteile spiegeln den derzeitigen Stand des EU-Rechts wider, das nationale Behörden anwenden müssen. Sowohl die im Jahr 2010 vorgenommene Bewertung (10) als auch eine 2012 durchgeführte Folgenabschätzung (11) machten die enorme Zahl der Urteile des Gerichtshofs deutlich. Dies zeigt, dass Schritte unternommen werden müssen, um ein gemeinsames Verständnis und die ordnungsgemäße Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in der gesamten Union zu gewährleisten.
Mit diesen Auslegungsleitlinien werden die früheren Leitlinien zu Fluggastrechten durch die Aufnahme der seit 2016 ergangenen einschlägigen Urteile des Gerichtshofs aktualisiert. Sie zielen unter anderem darauf ab, eine Reihe von Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, insbesondere im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs, klarer zu fassen (12). Dies dürfte eine wirksamere und konsequentere Durchsetzung der geltenden Vorschriften ermöglichen. Es wurde ein neuer Abschnitt über massive Reiseunterbrechungen hinzugefügt (Abschnitt 6).
In diesen Leitlinien sollen die Fragen angesprochen werden, die am häufigsten von nationalen Durchsetzungsstellen, Fluggästen und deren Verbänden, dem Europäischen Parlament und Vertretern der Wirtschaft gestellt wurden. Es ist weder beabsichtigt, mit diesen Leitlinien alle Bestimmungen umfassend abzudecken, noch führen sie neue Rechtsvorschriften ein. Anzumerken ist auch, dass Auslegungsleitlinien keinen Einfluss auf die Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof haben (13).
Diese Leitlinien beziehen sich auch auf die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 und das Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (im Folgenden „Übereinkommen von Montreal“) (14). Die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 verfolgt einen doppelten Zweck: zum einen die Angleichung der EU-Rechtsvorschriften über die Haftung von Luftfahrtunternehmen in Bezug auf Fluggäste und deren Gepäck an die Bestimmungen des Übereinkommens von Montreal, dessen Vertragspartei die EU ist, und zum anderen die Ausweitung der Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens auf die Flugdienste, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats erbracht werden.
Darüber hinaus werden in diesen Leitlinien Fragen der Zuständigkeit im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates behandelt (15).
Wie in ihrer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität (16) angekündigt, hat die Kommission den Rahmen für Fluggastrechte überprüft und am 29. November 2023 zusätzliche Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (17) vorgeschlagen. Mit diesen Auslegungsleitlinien will die Kommission weder diesen Vorschlag noch den Vorschlag von 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 ersetzen oder ergänzen, sondern vielmehr eine bessere Anwendung und Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 gewährleisten.
2. ANWENDUNGSBEREICH DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004
2.1. Räumlicher Anwendungsbereich
2.1.1. Geografischer Anwendungsbereich
Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 beschränkt sich der Anwendungsbereich der Verordnung auf Fluggäste, die von einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags unterliegt, einen Flug antreten, sowie auf Fluggäste, die von einem Flughafen in einem Drittland (d. h. in einem Land, das kein Mitgliedstaat ist) einen Flug zu einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags unterliegt, antreten, sofern das ausführende Luftfahrtunternehmen ein in einem Mitgliedstaat zugelassenes Luftfahrtunternehmen (im Folgenden „EU-Luftfahrtunternehmen“) ist.
Gemäß Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) findet das EU-Recht keine Anwendung auf die in Anhang II AEUV aufgeführten Länder und Hoheitsgebiete (18). Für diese Länder und Hoheitsgebiete gilt stattdessen das besondere Assoziierungssystem, das im Vierten Teil des AEUV dargelegt ist. Darüber hinaus gilt das EU-Recht nicht für die Färöer (19). Daher sind diese Gebiete als Drittländer im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 anzusehen (20).
Dagegen gelten gemäß Artikel 355 Absatz 1 AEUV die Verträge für Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln. Diese Hoheitsgebiete sind daher im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 Teile von Mitgliedstaaten, die den Bestimmungen des Vertrags unterliegen.
2.1.2. Der Begriff „Flug“ im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
Nach Auffassung des Gerichtshofs kann eine Reise, die einen Hin- und Rückflug umfasst, nicht als ein einziger Flug angesehen werden. Der Begriff „Flug“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist dahin auszulegen, dass es sich dabei im Wesentlichen um einen Beförderungsvorgang im Luftverkehr handelt, der eine „Einheit“ dieser Beförderung darstellt, die von einem Luftfahrtunternehmen durchgeführt wird, das die entsprechende Flugroute festlegt (21). Infolgedessen ist Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 nicht auf den Fall einer Hin- und Rückreise anwendbar, bei der Fluggäste, die ursprünglich einen Flug von einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats angetreten haben, mit einem Flug, der von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen ausgeführt wird und von einem Flughafen in einem Drittland abgeht, zu diesem Flughafen zurückreist. Die Tatsache, dass der Hin- und der Rückflug Gegenstand einer einzigen Reservierung sind, wirkt sich nicht auf die Auslegung dieser Bestimmung aus (22).
Wenn die Reise eines Fluggastes – vom ersten Abflug zum Endziel – aus mehreren Flügen besteht, werden diese Flüge als Ganzes im Sinne der Verordnung betrachtet, wenn sie als eine Einheit gebucht wurden oder – mit anderen Worten – Gegenstand einer einzigen Buchung waren. Daher sind bei der Entscheidung, ob die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 anwendbar ist, der erste Abflugort und das Endziel der gesamten Reise zu berücksichtigen, unabhängig von etwaigen Zwischenlandungen oder Flughäfen während der Reise (23).
2.1.3. Flüge innerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
In mehreren Urteilen hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Verordnung auf Reiseunterbrechungen bei Anschlussflügen außerhalb der EU oder auf Zwischenfälle bei Anschlussflügen, die von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden, Anwendung finden kann.
Eine Flugunterbrechung kann auch dann in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 fallen, wenn sie außerhalb der EU bei einem Anschlussflug aus der EU in ein Drittland mit Zwischenlandung außerhalb der EU und mit einem Wechsel des Fluggeräts erfolgt ist. Der Gerichtshof bestätigte, dass der Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei großen Verspätungen von Flügen besteht, wenn zwei oder mehr Flüge Gegenstand einer einzigen Buchung waren (24).
Hinsichtlich der Partei, die im Falle einer Reiseunterbrechung zur Entschädigung des Fluggastes verpflichtet ist, hat der Gerichtshof klargestellt, dass jedes ausführende Luftfahrtunternehmen, das an der Durchführung mindestens eines der Anschlussflüge beteiligt war, zur Zahlung dieser Entschädigung verpflichtet ist, unabhängig davon, ob der von diesem Unternehmen durchgeführte Flug die Ursache der Reiseunterbrechung war oder nicht (25).
So kann ein Fluggast bei Anschlussflügen, die Gegenstand einer einzigen Buchung waren und im Rahmen einer Code-Sharing-Vereinbarung mit einem EU-Luftfahrtunternehmen, das den ersten Flug (Teilflug) durchführt, und einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen, das den zweiten Teilflug durchführt, eine Klage auf Ausgleichszahlung gegen das EU-Luftfahrtunternehmen richten, selbst wenn die Ursache für die Verspätung auf den zweiten Teilflug zurückgeht (26).
Ebenso hat der Gerichtshof im Falle von Anschlussflügen, die Gegenstand einer einzigen Buchung waren, von einem Drittstaat in die EU mit Zwischenlandung in der EU entschieden, dass ein Fluggast, wenn der Grund für eine große Verspätung auf den ersten Teilflug zurückgeht, der im Rahmen einer Code-Sharing-Vereinbarung von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen durchgeführt wurde, eine Klage auf Ausgleichszahlung gegen das Luftfahrtunternehmen der Union erheben kann, das den zweiten Flug durchgeführt hat (27).
Wurde ein Anschlussflug aus der EU in ein Drittland vollständig von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen durchgeführt und wurde die Buchung bei einem EU-Luftfahrtunternehmen vorgenommen, hat ein Fluggast Anspruch auf Ausgleichsleistungen von dem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen, das die Flüge im Namen jenes Luftfahrtunternehmens durchgeführt hat, wenn dieser Fluggast sein Endziel mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden, die auf dem zweiten Teil des Fluges verursacht wurde, erreicht hat (28).
Während es sich bei den genannten Beispielen um Anschlussflüge handelte, die von Luftfahrtunternehmen im Rahmen von Code-Sharing-Vereinbarungen durchgeführt wurden, hat der Gerichtshof klargestellt, dass keine Bestimmung der Verordnung die Einstufung als Anschlussflug davon abhängig macht, dass zwischen den Luftfahrtunternehmen, die die Flüge durchführen, aus denen sich der Anschlussflug zusammensetzt, ein besonderes Rechtsverhältnis besteht (29).
Daher gilt die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auch für Fluggäste eines Anschlussflugs, der sich aus mehreren Flügen zusammensetzt, die von verschiedenen, rechtlich nicht miteinander verbundenen Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden, wenn diese Flüge von einem Reisebüro kombiniert wurden, das für diesen Vorgang einen Gesamtpreis in Rechnung stellt und einen einzigen Flugschein ausgestellt hat (30).
2.1.4. Flüge außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt nicht für Fluggäste auf Anschlussflügen, die von einem EU-Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden und die Gegenstand einer einzigen Buchung waren, wenn sich sowohl der Abflugflughafen des ersten Teilflugs als auch der Ankunftsflughafen des zweiten Teilflugs in einem Drittland befinden und nur der Flughafen, auf dem die Zwischenlandung stattfindet, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt (31). Der Gerichtshof stellte daher klar, dass die Anwendbarkeit der Verordnung im Falle eines Anschlussflugs ausschließlich auf der Grundlage der geografischen Lage des ersten Abflugflughafens und des Flughafens des Endziels des Fluggastes festgestellt werden sollte. Befinden sich beide außerhalb des Hoheitsgebiets der EU, so fallen Fluggäste solcher Flüge nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 261/2004, selbst wenn sie eine oder mehrere Zwischenlandungen in der EU hatten.
2.1.5. Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in Bezug auf in einem Drittland erhaltene Ausgleichs- oder Unterstützungsleistungen und die Auswirkungen auf die Rechte der Empfänger im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt die Verordnung für Fluggäste, die von einem außerhalb der EU (d. h. in einem Drittland) gelegenen Flughafen einen Flug in die EU antreten, sofern der Flug von einem in einem EU-Mitgliedstaat zugelassenen Luftfahrtunternehmen (einem „EU-Luftfahrtunternehmen“) ausgeführt wird, es sei denn, sie haben in diesem Drittland Gegen- oder Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen erhalten.
Es kann sich die Frage stellen, ob Fluggäste, die von einem Drittlandsflughafen in die EU fliegen, die Rechte nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 beanspruchen können, wenn nach dem Fluggastrecht eines Drittlands die folgenden Ansprüche bereits erfüllt wurden:
|
1. |
Gegenleistungen (z. B. ein Reisegutschein) oder Ausgleichsleistung (deren Betrag von der in der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehenen Höhe abweichen kann) und |
|
2. |
Unterstützungsleistungen (z. B. Erstattung oder anderweitige Beförderung gemäß Artikel 8 sowie Mahlzeiten, Getränke, Hotelunterkünfte und Kommunikationseinrichtungen gemäß Artikel 9 der Verordnung). |
Hier ist das Wort „und“ wichtig. Wurde den Fluggästen beispielsweise nur einer der beiden Ansprüche erfüllt (z. B. Gegenleistungen und Ausgleich gemäß Nummer 1), so können sie noch immer einen Anspruch geltend machen (in diesem Fall die Betreuungsleistungen gemäß Nummer 2).
Wurden beide Ansprüche am Abflugort aufgrund der lokalen Rechtsvorschriften oder freiwillig geleistet, können die Fluggäste keine weiteren Ansprüche im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 geltend machen, da diese Verordnung keine Anwendung findet (32).
Der Gerichtshof (33) kam jedoch zu dem Urteil, dass es nicht zugelassen werden kann, dass ein Fluggast den durch die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gewährten Schutz schon dann verlieren kann, wenn der Fluggast eine bestimmte Ausgleichsleistung in einem Drittland erhalten kann. In dieser Hinsicht sollte das Luftfahrtunternehmen den Nachweis erbringen, dass die in dem Drittland gewährte Ausgleichsleistung dem Zweck der durch die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 garantierten Ausgleichsleistung entspricht oder dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Ausgleichs- und Unterstützungsleistung sowie die verschiedenen Modalitäten ihrer Durchführung denen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gleichkommen.
2.2. Sachlicher Anwendungsbereich
2.2.1. Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf Fluggäste von Hubschraubern
Gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt die Verordnung nur für Motorluftfahrzeuge mit festen Tragflächen, die von einem zugelassenen Luftfahrtunternehmen betrieben werden. Sie gilt daher nicht für Hubschrauberdienste.
2.2.2. Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf Fluggäste, die kostenlos oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar verfügbar ist
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt die Verordnung nicht für Fluggäste, die kostenlos oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar verfügbar ist.
„Kostenlose Beförderung“ bedeutet, dass ein Fluggast von einem Luftfahrtunternehmen befördert wird, ohne dass der Fluggast eine finanzielle Verpflichtung eingeht. Fälle, in denen der Flugpreis auf Null gesenkt wird, die Fluggäste aber noch Steuern und andere Gebühren zahlen müssen, um ihre Flugscheine zu erhalten, würden nicht unter diesen Begriff fallen.
Wurde ein Flugschein zu einem reduzierten Tarif erworben, so kommt es darauf an, ob diese Ermäßigung einer bestimmten Personengruppe vorbehalten ist oder ob sie jedem offensteht, der buchen möchte, auch wenn er möglicherweise bestimmte Bedingungen oder Anforderungen erfüllen muss. Solche Flugscheine würden nach wie vor als „öffentlich zugänglich“ gelten, und ihre Inhaber würden unter die Verordnung fallen.
Unter diese Bestimmung fallen jedoch Sondertarife, die die Luftfahrtunternehmen ihrem Personal anbieten. Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt auch nicht für Fluggäste, die mit einem Flugschein zu einem Vorzugstarif reisen, der von einem Luftfahrtunternehmen im Rahmen eines Event-Sponsorings ausgestellt wurde, das nur bestimmten Personen zugute kommt und für dessen Ausstellung eine vorherige und individuelle Genehmigung des Luftfahrtunternehmens erforderlich ist (34).
Dagegen sieht Artikel 3 Absatz 3 vor, dass die Verordnung für Fluggäste gilt, deren Flugscheine im Rahmen eines Vielfliegerprogramms oder eines anderen kommerziellen Programms eines Luftfahrt- oder Reiseunternehmens ausgestellt wurden.
In Bezug auf Säuglinge hat der Gerichtshof entschieden, dass Fluggäste, die aufgrund ihres jungen Alters kostenlos reisen, aber nicht über einen zugewiesenen Sitzplatz oder eine Bordkarte verfügen und deren Namen nicht in der von ihren Eltern gebuchten Buchung erscheinen, vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ausgeschlossen sind (35).
2.2.3. Anwesenheitspflicht der Fluggäste bei der Abfertigung
Aus Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ergibt sich, dass Fluggäste, um unter die Verordnung zu fallen, i) über eine bestätigte Buchung verfügen und ii) sich rechtzeitig zur Abfertigung einfinden müssen. Die zweite Voraussetzung gilt nicht für den Fall der Annullierung eines Fluges.
Diese beiden Voraussetzungen sind kumulativ. die Anwesenheit des Fluggastes bei der Abfertigung kann nicht aufgrund der Tatsache vermutet werden, dass der Fluggast über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug verfügt (36). Die Wirksamkeit von Artikel 3 Absatz 2 verlangt, dass sich die Fluggäste rechtzeitig am Flughafen, genauer gesagt bei einem Vertreter des ausführenden Luftfahrtunternehmens zur Beförderung zum vorgesehenen Zielort einfinden, auch wenn sie sich vor ihrer Anreise zum Flughafen bereits online registriert haben (37).
Hinsichtlich des Nachweises, dass die Fluggäste tatsächlich zur Abfertigung erschienen sind, hat der Gerichtshof bestätigt, dass bei Fluggästen, die über eine bestätigte Buchung für einen Flug verfügen und diesen Flug angetreten haben, davon auszugehen ist, dass sie der Verpflichtung, sich vor dem Flug zur Abfertigung einzufinden, ordnungsgemäß nachgekommen sind, ohne dass sie zu diesem Zweck die Bordkarte oder ein anderes Dokument vorlegen müssen, das ihre Anwesenheit bei der Abfertigung für den verspäteten Flug innerhalb der vorgesehenen Fristen bestätigt. Es wäre Sache des Luftfahrtunternehmens, nachzuweisen, dass diese Fluggäste auf diesem Flug nicht befördert wurden (38).
Der Gerichtshof hat bestätigt, dass das Erfordernis, sich zur Abfertigung einzufinden, von wesentlicher Bedeutung ist, wenn Fluggäste Ausgleichszahlungen für große Verspätungen bei der Ankunft verlangen wollen (39). Dies ist wichtig zu beachten, wenn Fluggäste im Voraus über die Verspätung ihres Fluges informiert werden und beschließen, nicht am Flughafen zu erscheinen, sei es, weil sie beschlossen haben, nicht mehr zu reisen, oder weil sie selbst für eine alternative Beförderung gesorgt haben.
2.2.4. Anwendung auf ausführende Luftfahrtunternehmen
Gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist stets das ausführende Luftfahrtunternehmen für die Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung verantwortlich und nicht beispielsweise ein anderes Luftfahrtunternehmen, das den Flugschein möglicherweise verkauft hat. Der Begriff „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ wird in Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 als Luftfahrtunternehmen beschrieben, „das einen Flug durchführt oder durchzuführen beabsichtigt, und zwar unabhängig davon, ob der Flug mit einem eigenen Luftfahrzeug oder mit einem mit oder ohne Besatzung gemieteten Luftfahrzeug oder in sonstiger Form durchgeführt wird“ (40).
Der Gerichtshof hat klargestellt, dass im Fall einer Vermietung eines Flugzeugs mit Besatzung („wet lease“), bei der eine Fluggesellschaft (der Vermieter) einem anderen Luftfahrtunternehmen (dem Mieter) ein Flugzeug und eine Besatzung zur Verfügung stellt, der Vermieter nicht als ausführendes Luftfahrtunternehmen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 angesehen werden kann. Denn der Mieter trägt weiterhin die operationelle Verantwortung für den Flug und nicht das Luftfahrtunternehmen, das sein Flugzeug und seine Besatzung vermietet hat (41).
In Bezug auf die Betriebsgenehmigung eines Luftfahrtunternehmens hat der Gerichtshof klargestellt, dass ein Unternehmen, das einen Antrag auf Erteilung einer Betriebsgenehmigung gestellt hat, die zum Zeitpunkt der Durchführung eines Linienflugs noch nicht erteilt wurde, nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 fallen kann. Damit Fluggäste einen Ausgleichsanspruch nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 haben, muss das Luftfahrtunternehmen über eine gültige Betriebsgenehmigung verfügen (42).
2.2.5. Vorkommnisse, für die die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 bietet Fluggästen Schutz bei Nichtbeförderung, Annullierung, Verspätung, Höherstufung und Herabstufung. Diese Vorkommnisse, sowie die Ansprüche, die Fluggästen bei ihrem Eintreten zuerkannt werden, sind weiter unten beschrieben.
2.2.6. Nichtanwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf multimodale Reisen
Multimodale Reisen mit mehr als einem Verkehrsträger im Rahmen eines einzigen Beförderungsvertrags fallen als solche nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 261/2004. Nähere Angaben hierzu sind in Abschnitt 6 enthalten.
2.2.7. Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in Bezug auf die Richtlinie (EU) 2015/2302 (Richtlinie über Pauschalreisen)
Artikel 3 Absatz 6 und Erwägungsgrund 16 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sehen vor, dass diese Verordnung auch für Flüge im Rahmen einer Pauschalreise gilt, es sei denn, eine Pauschalreise wird aus anderen Gründen als der Annullierung des Fluges annulliert (z. B. im Fall einer Hotelstornierung). Ferner wird darauf hingewiesen, dass die nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gewährten Rechte nicht die Rechte berühren, die Reisenden gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates gewährt werden (43). Grundsätzlich stehen den Reisenden somit Rechte sowohl gegenüber dem Reiseveranstalter im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/2302 als auch gegenüber dem ausführenden Luftfahrtunternehmen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu. Gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/2302 lässt außerdem das Recht auf Schadenersatz oder Preisminderung nach dieser Richtlinie die Rechte von Reisenden nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 unberührt, wobei jedoch spezifiziert wird, dass die nach den Verordnungen über die Rechte von Reisenden und nach dieser Richtlinie gewährten Schadenersatzzahlungen oder Preisminderungen voneinander in Abzug gebracht werden müssen, um eine Überkompensation zu verhindern.
Weder die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 noch die Richtlinie (EU) 2015/2302 befasst sich jedoch mit der Frage, ob die Kosten der sich überschneidenden Verpflichtungen letztendlich vom Reiseveranstalter oder vom ausführenden Luftfahrtunternehmen zu übernehmen sind (44). Die Lösung eines solchen Problems hängt somit von den Bestimmungen der zwischen Reiseveranstaltern und Luftfahrtunternehmen geschlossenen Verträge und dem geltenden nationalen Recht ab. Diesbezügliche Vereinbarungen (einschließlich praktischer Regelungen zur Vermeidung von Überkompensation) dürfen die Möglichkeit der Fluggäste, ihr Recht entweder beim Reiseveranstalter oder beim Luftfahrtunternehmen geltend zu machen und die entsprechenden Ansprüche im Rahmen der Rechte erfüllt zu sehen, die sich nicht aus der Richtlinie (EU) 2015/2302 ergeben, nicht beeinträchtigen.
In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof entschieden, dass Fluggäste, die nach der Richtlinie über Pauschalreisen das Recht haben, den Reiseveranstalter für die Erstattung ihrer Flugscheinkosten haftbar zu machen, gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vom Luftfahrtunternehmen keine Erstattung der Flugscheinkosten nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 mehr verlangen können, selbst wenn der Reiseveranstalter finanziell nicht in der Lage ist, die Kosten des Flugscheins zu erstatten, und keine Maßnahmen ergriffen hat, um eine solche Erstattung zu gewährleisten (45). Mit anderen Worten können Fluggäste, die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 Anspruch auf Erstattung von ihrem Reiseveranstalter haben, vom Luftfahrtunternehmen keine Erstattung nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 verlangen.
Ein Reisender kann jedoch bei Flügen, die um drei Stunden oder mehr verspätet sind oder annulliert werden, direkt vom Luftfahrtunternehmen eine Ausgleichsleistung verlangen, auch wenn zwischen ihm und dem betreffenden Luftfahrtunternehmen kein Vertrag besteht und der Flug Teil einer Pauschalreise ist (46).
3. VORKOMMNISSE, DIE ANSPRÜCHE IM RAHMEN DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 BEGRÜNDEN
3.1. Nichtbeförderung
3.1.1. Begriff „Nichtbeförderung“
Der Begriff „Nichtbeförderung“ bezieht sich nicht nur auf Fälle der Überbuchung, sondern auch auf die Fälle, in denen die Beförderung aus anderen, beispielsweise betrieblichen Gründen verweigert wird (47). Im Einklang mit Artikel 2 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 schließt „Nichtbeförderung“ keine Situation ein, bei der vertretbare Gründe (z. B. im Zusammenhang mit der Gesundheit oder der allgemeinen oder betrieblichen Sicherheit oder unzureichenden Reisedokumenten) für die Weigerung gegeben sind, Fluggäste zu befördern, obwohl diese sich rechtzeitig für den Flug eingefunden haben.
Verspätet sich der ursprüngliche Flug eines Fluggastes, der über eine bestätigte Buchung verfügt, und wird der Fluggast mit einem anderen Flug befördert, stellt dies keine Nichtbeförderung im Sinne von Artikel 2 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dar.
Wird ein Fluggast auf dem Rückflug nicht befördert, weil das ausführende Luftfahrtunternehmen den Hinflug annulliert und den Fluggast mit einem anderen Flug befördert hat, stellt dies eine Nichtbeförderung dar, aus der ein Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichsleistung erwächst.
Der Gerichtshof hat bestätigt, dass der Begriff „Nichtbeförderung“ auch die vorweggenommene Beförderungsverweigerung umfasst, die sich auf Situationen bezieht, in denen ein ausführendes Luftfahrtunternehmen die Fluggäste vorab davon in Kenntnis setzt, dass es ihnen die Beförderung auf einem Flug, für den sie eine bestätigte Buchung hatten, gegen ihren Willen verweigern wird (48).
Darüber hinaus hat der Gerichtshof klargestellt, dass das Luftfahrtunternehmen im Falle einer vorweggenommenen Beförderungsverweigerung den Fluggästen eine Ausgleichszahlung nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 leisten muss, auch wenn sich die Fluggäste nicht unter den in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 genannten Bedingungen zur Beförderung eingefunden haben (49).
Wenn Fluggäste, die über eine Buchung für einen Hin- und Rückflug verfügen, den Rückflug nicht antreten dürfen, weil sie den Hinflug nicht angetreten haben („No-Show“), könnte dies als Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen des Luftfahrtunternehmens angesehen werden. Gleiches gilt, wenn Fluggästen mit einer Buchung, die aufeinanderfolgende Flüge umfasst, die Beförderung verweigert wird, weil sie den vorangehenden Flug/die vorangehenden Flüge nicht angetreten haben. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Luftfahrtunternehmen müssen den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Bestimmungen des EU-Verbraucherschutzrechts, wie der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, entsprechen (50). Der Gerichtshof hat sich noch nicht zu der Frage geäußert, ob dies eine Nichtbeförderung im Sinne von Artikel 2 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 darstellt. Darüber hinaus sind solche Praktiken möglicherweise nach nationalem Recht verboten.
Wird Fluggästen, die mit einem Haustier reisen, die Beförderung verweigert, weil sie nicht über die erforderlichen Dokumente für das Tier verfügen oder die Beförderung des Tieres nicht den Bedingungen des Luftfahrtunternehmens entspricht, handelt es sich nicht um Nichtbeförderung.
Werden Fluggäste jedoch wegen eines Irrtums nicht befördert, der dem Bodenpersonal bei der Kontrolle der Reisedokumente (einschließlich Visa) unterlaufen ist, so stellt dies eine Nichtbeförderung im Sinne von Artikel 2 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dar.
In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof entschieden, dass die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dem betreffenden Luftfahrtunternehmen nicht die Befugnis verleiht, einseitig und endgültig zu beurteilen und zu entscheiden, ob die Nichtbeförderung angemessen gerechtfertigt ist, und folglich den betroffenen Fluggästen den Schutz zu entziehen, der ihnen nach dieser Verordnung zusteht (51).
Die allgemeinen Beförderungsbedingungen können keine Klausel enthalten, die die Verpflichtungen des Luftfahrtunternehmens nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dem Fluggast bei Nichtbeförderung wegen angeblich unzureichender Reiseunterlagen eine Ausgleichsleistung zu erbringen, einschränkt oder es davon entbindet (52).
Anders verhält es sich, wenn das Luftfahrtunternehmen und seine Besatzung einem Fluggast das Anbordgehen aus vertretbaren Gründen gemäß Artikel 2 Buchstabe j verweigern. Die Luftfahrtunternehmen sollten umfassend in der IATA-Datenbank Timatic oder durch Anfrage bei den öffentlichen Behörden (Botschaften und Außenministerien) der betreffenden Länder die Vorschriften der Bestimmungsländer für Reisedokumente und (Einreise-)Visa überprüfen und entsprechende Aufzeichnungen führen, um zu verhindern, dass Fluggästen zu Unrecht die Beförderung verweigert wird. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass sie IATA/Timatic umfassende, aktuelle Informationen zu den Reiseunterlagen und vor allem zur Visapflicht oder Visabefreiung übermitteln.
In Bezug auf Reisen von Menschen mit Behinderungen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität wird auf Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (53) und die entsprechenden Auslegungsleitlinien (54) verwiesen.
3.1.2. Ansprüche wegen Nichtbeförderung
Die Verweigerung der Beförderung gegen den Willen des Fluggastes begründet: i) einen „Ausgleichsanspruch“ im Sinne des Artikels 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, ii) das Recht des Fluggasts, gemäß Artikel 8 zwischen Erstattung, anderweitiger Beförderung oder Umbuchung zu einem späteren Zeitpunkt zu wählen, und iii) einen „Anspruch auf Betreuungsleistungen“ gemäß Artikel 9.
3.2. Annullierung
3.2.1. Definition der Annullierung
Artikel 2 Buchstabe l der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 definiert eine „Annullierung“ als „die Nichtdurchführung eines geplanten Fluges, für den zumindest ein Platz reserviert war“.
Eine Annullierung liegt grundsätzlich dann vor, wenn die Planung des ursprünglichen Flugs aufgegeben wird und die Fluggäste dieses Flugs zu den Fluggästen eines anderen, ebenfalls — aber unabhängig vom ursprünglichen Flug — geplanten Flugs hinzukommen. Artikel 2 Buchstabe l erfordert keine ausdrückliche Entscheidung des Luftfahrtunternehmens, den Flug zu annullieren (55).
Ein Flug, der zwischen Abflug- und Ankunftsort planmäßig durchgeführt wurde, bei dem jedoch eine außerplanmäßige Zwischenlandung erfolgte, kann nicht als annulliert angesehen werden (56).
Dagegen ist der Gerichtshof (57) der Auffassung, dass auf der Grundlage der Anzeige einer „Verspätung“ oder einer „Annullierung“ auf der Anzeigetafel des Flughafens oder entsprechender Angaben des Personals des Luftfahrtunternehmens grundsätzlich nicht auf das Vorliegen einer Verspätung oder einer Annullierung eines Fluges geschlossen werden kann. Ausschlaggebend ist grundsätzlich auch nicht, dass den Fluggästen ihr Gepäck wieder ausgehändigt wird oder dass sie neue Bordkarten erhalten. Diese Umstände stehen nämlich in keinem Zusammenhang mit den objektiven Merkmalen des Fluges als solchen und können anderen Faktoren zuzuschreiben sein. Der Gerichtshof betonte insbesondere, dass diese Umstände (d. h. die angekündigte „Verspätung“ oder „Annullierung“ eines Flugs) „Fehlbeurteilungen oder Faktoren zuzuschreiben sein [können], die auf dem entsprechenden Flughafen vorherrschen, oder angesichts der Wartezeit und der Notwendigkeit, dass die betroffenen Fluggäste eine Nacht im Hotel verbringen, geboten sein [können]“.
3.2.2. Änderung der Abflugzeit
Um eine Situation zu verhindern, in der Luftfahrtunternehmen einen Flug kontinuierlich als „verspätet“ anstatt als „annulliert“ bezeichnen, wurde es unbeschadet Abschnitt 3.3.1 für sinnvoll erachtet, den Unterschied zwischen „Annullierung“ und „Verspätung“ deutlich zu machen. Ein Flug kann zwar generell als annulliert betrachtet werden, wenn sich in der Praxis die Flugnummer ändert, doch ist dies möglicherweise nicht immer ein maßgebliches Kriterium. Tatsächlich kann ein Flug so stark verspätet sein, dass er einen Tag nach dem geplanten Abflugtag abgeht und deswegen möglicherweise eine annotierte Flugnummer (z. B. XX 1234a statt XX 1234) erhält, um ihn an diesem Folgetag von dem Flug mit derselben Nummer zu unterscheiden. In diesem Fall könnte dies jedoch noch immer als Verspätung und nicht als annullierter Flug betrachtet werden. Dies sollte von Fall zu Fall geprüft werden.
Beispielsweise gilt ein Flug nicht als „annulliert“, wenn das ausführende Luftfahrtunternehmen die Abflugzeit um weniger als drei Stunden ohne weitere Änderung an diesem Flug verschiebt (58).
Ein Flug ist jedoch als „annulliert“ anzusehen, wenn das ausführende Luftfahrtunternehmen die Abflugzeit des Fluges um mehr als eine Stunde vorverlegt (59).
3.2.3. Fall eines Luftfahrzeugs, das zum Abflugort zurückkehrt
Der Begriff „Annullierung“ gemäß Artikel 2 Buchstabe l der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 schließt auch den Fall ein, dass ein Flugzeug startet, aber anschließend, aus welchen Gründen auch immer, zum Abflughafen zurückkehren muss, wo die Fluggäste dieses Flugzeugs auf andere Flüge umgebucht werden. Die Tatsache, dass der Start stattfand, das Flugzeug dann aber zum Ausgangsflughafen zurückkehrte, ohne den nach der Flugroute vorgesehenen Zielort erreicht zu haben, bedeutet nämlich, dass der ursprünglich geplante Flug nicht als ausgeführt gelten kann (60).
3.2.4. Umgeleiteter Flug
Wird ein Flug zu einem Flughafen umgeleitet, der nicht dem gemäß dem ursprünglichen Reiseplan als Endziel angegebenen Flughafen entspricht, so ist er einer Annullierung gleichzustellen, es sei denn, der Ankunftsflughafen und der Flughafen des ursprünglichen Endziels bedienen denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region; in diesem Fall kann die anderweitige Beförderung als Verspätung behandelt werden (61). Wenn also ein umgeleiteter Flug auf einem anderen als dem ursprünglich geplanten Flughafen landet, der nicht denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedient, haben die Fluggäste Anspruch auf Ausgleichszahlungen wegen Annullierung eines Fluges (62).
3.2.5. Beweislast im Falle einer Annullierung
Gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 trägt das Luftfahrtunternehmen die Beweislast dafür, ob und wann jeder Fluggast von der Annullierung in Kenntnis gesetzt wurde.
Zur Verpflichtung, Fluggäste über eine Annullierung zu unterrichten, siehe auch Abschnitt 4.4.6.
3.2.6. Ansprüche wegen Annullierung
Die Annullierung eines Fluges begründet: i) einen Anspruch auf eine Erstattung, eine anderweitige Beförderung oder einen Rückflug gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, ii) einen „Anspruch auf Betreuungsleistungen“ im Sinne des Artikels 9, und iii) gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c einen Anspruch auf „Ausgleichsleistungen“ gemäß Artikel 7. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c liegt das Prinzip zugrunde, dass ein Ausgleich zu zahlen ist, wenn der Fluggast nicht hinreichend früh über die Annullierung unterrichtet wurde.
Allerdings muss das Luftfahrtunternehmen Ausgleichszahlungen nicht leisten, wenn es im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 nachweisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären (63).
3.3. Verspätung
3.3.1. Verspätung beim Abflug
Verzögert sich der Abflug, so haben die Fluggäste gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 Anspruch auf „Betreuungsleistungen“ gemäß Artikel 9 sowie auf Erstattung und einen Rückflug gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a. Artikel 6 Absatz 1 liegt das Prinzip zugrunde, dass die Ansprüche von der Dauer der Verspätung und der Entfernung des Flugs abhängen. Diesbezüglich sei erwähnt, dass der Anspruch auf anderweitige Beförderung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b nicht unter Artikel 6 Absatz 1 fällt, da davon ausgegangen werden kann, dass das Luftfahrtunternehmen sich erst bemüht, die Ursache der Verzögerung zu beseitigen, um die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste zu minimieren.
3.3.2. „Große Verspätung“ bei Ankunft
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs erwachsen aus einem Zeitverlust von mindestens 3 Stunden bei der Ankunft dieselben Ausgleichsansprüche wie bei einer Annullierung (64) (Einzelheiten siehe Abschnitt 4.4.5 über Ausgleichsleistungen).
3.3.3. Ausmaß der Verspätung bei der Ankunft und Begriff der Ankunftszeit
Der Gerichtshof urteilte, dass der Begriff „Ankunftszeit“, der verwendet wird, um das Ausmaß der Fluggästen entstandenen Verspätung zu bestimmen, für den Zeitpunkt steht, zu dem mindestens eine der Flugzeugtüren geöffnet wird, insofern den Fluggästen in diesem Moment das Verlassen des Flugzeugs gestattet ist (65). Nach Auffassung der Kommission sollte das ausführende Luftfahrtunternehmen die Ankunftszeit auf Grundlage beispielsweise einer unterzeichneten Erklärung der Flugbesatzung oder des Abfertigers festhalten. Die Ankunftszeit sollte der nationalen Durchsetzungsstelle und den Fluggästen auf Anfrage kostenlos als Nachweis für die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 mitgeteilt werden.
Die „planmäßige Ankunftszeit“, die als Ausgangspunkt für die Berechnung einer Verspätung verwendet wird, ist die Zeit, die im Flugplan festgelegt und auf der Buchung (Flugschein oder anderer Nachweis (66)) des betreffenden Fluggastes angegeben ist (67).
Für die Ermittlung des Ausmaßes der Ankunftsverspätung, die ein Fluggast erleidet, dessen Flug umgeleitet wurde und der auf einem Flughafen gelandet ist, der zwar nicht dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen entspricht, aber denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedient, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem der Fluggast – nach Beendigung seiner Anschlussbeförderung – an dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen bzw. gegebenenfalls einem sonstigen nahe gelegenen, mit dem ausführenden Luftfahrtunternehmen vereinbarten Zielort tatsächlich ankommt (68).
War ein Flug bei der Ankunft um mindestens 3 Stunden verspätet und war diese Verspätung teilweise auf ein Vorkommnis zurückzuführen, das als außergewöhnlicher Umstand einzustufen ist, und teilweise auf eine andere Ursache, so ist die auf den außergewöhnlichen Umstand zurückzuführende Verspätung von der Gesamtverspätung des betreffenden Fluges abzuziehen, um zu beurteilen, ob eine Ausgleichszahlung für die Verspätung bei der Ankunft dieses Fluges zu zahlen ist (69).
3.4. Höherstufung und Herabstufung
3.4.1. Definition von Höherstufung und Herabstufung
Höherstufung und Herabstufung sind in Artikel 10 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 geregelt.
Das entsprechende Fluggastrecht ist mit einem Wechsel der Kabinenklasse oder der Buchungsklasse verbunden, d. h. „Economy“, „Business“ und „First“. Sie gilt nicht für Vorteile, die durch einen höheren Tarif innerhalb derselben Klasse angeboten werden (z. B. in Bezug auf bestimmte Sitzplätze oder Verpflegung). Der Erwerb eines anderen Tarifs innerhalb derselben Fluggastklasse gilt daher nicht als Höherstufung oder Herabstufung im Sinne dieses Artikels. Ebenso werden Fluggäste, die nicht die ihrer Buchung entsprechenden Kabinendienstleistungen erhalten (z. B. in Bezug auf Sitzplätze oder Verpflegung), aber immer noch in derselben Klasse reisen, nicht herabgestuft. Sie haben jedoch nach den Geschäftsbedingungen des Luftfahrtunternehmens und/oder nach nationalem Recht möglicherweise Anspruch auf Erstattung des Betrages, der für eine Dienstleistung bezahlt wurde, die nicht erbracht wurde.
Die Definition von Herabstufung (bzw. Höherstufung) bezieht sich auf die Buchungsklasse, für die der Flugschein erworben wurde, und nicht auf etwaige Vorteile, die im Rahmen eines Kundenbindungsprogramms oder eines anderen Werbeprogramms von einem Luftfahrtunternehmen oder Reiseunternehmen angeboten werden.
3.4.2. Ansprüche bei Höherstufung oder Herabstufung
Im Falle einer Höherstufung darf ein Luftfahrtunternehmen keinerlei Aufschlag oder Zuzahlung erheben. Für den Fall einer Herabstufung sieht Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 einen Ausgleich in Form der Erstattung eines Prozentsatzes des Flugscheinpreises vor.
Der bei der Festsetzung der Erstattung für die betroffenen Fluggäste zu berücksichtigende Preis ist der Preis des Fluges, von dem sie herabgestuft wurden, es sei denn, dieser Preis ist nicht auf dem Flugschein angegeben, der den Fluggast zur Beförderung auf diesem Flug berechtigt. In diesem Fall muss die Festsetzung auf dem Teil des Preises des Flugscheins beruhen, der dem Quotienten aus der Länge der betroffenen Flugstrecke und der der Gesamtstrecke der Beförderung entspricht, auf die der Fluggast Anspruch hat. In diesem Preis sind die auf dem Flugschein angegebenen Steuern und Abgaben nicht enthalten, solange weder die Verpflichtung zur Zahlung dieser Steuern und Abgaben noch deren Höhe von der Klasse abhängen, für die der Flugschein erworben wurde (70).
4. FLUGGASTRECHTE
4.1. Recht auf Information
4.1.1. Allgemeines Recht auf Information
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 legt den Wortlaut des Hinweises fest, der bei der Abfertigung für die Fluggäste lesbar und deutlich sichtbar angebracht sein muss. Dieser Hinweis sollte in gedruckter oder elektronischer Form in so vielen relevanten Sprachen wie möglich angezeigt werden. Dies muss nicht nur am Abfertigungsschalter des Flughafens, sondern auch an Kiosken am Flughafen, online und idealerweise auch am Flugsteig erfolgen.
Erteilt ein Luftfahrtunternehmen den einzelnen Fluggästen oder allgemein durch Anzeigen in den Medien oder Veröffentlichungen auf seiner Website unvollständige, irreführende oder falsche Auskünfte über ihre Rechte, so sollte dies als Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gemäß Artikel 15 Absatz 2 zusammen mit dem Erwägungsgrund 20 betrachtet werden. Außerdem kann dies als unlautere oder irreführende Geschäftspraxis im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betrachtet werden (71).
Bei Verspätung, Nichtbeförderung oder Annullierung ist das ausführende Luftfahrtunternehmen verpflichtet, den Fluggästen den genauen Namen und die Anschrift des Unternehmens mitzuteilen, bei dem diese Fluggäste Ausgleichsleistungen verlangen können, und gegebenenfalls die Unterlagen anzugeben, die ihrem Antrag auf Ausgleichsleistung beizufügen sind. Dagegen ist das ausführende Luftfahrtunternehmen nicht verpflichtet, die Fluggäste über die genaue Höhe der Ausgleichszahlungen zu informieren, die sie möglicherweise erhalten können (72).
4.1.2. Bei Verspätung, Nichtbeförderung oder Annullierung zu erteilende Informationen
Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 muss ein ausführendes Luftfahrtunternehmen, das Fluggästen die Beförderung verweigert oder einen Flug annulliert, jedem betroffenen Fluggast einen schriftlichen Hinweis aushändigen, in dem die Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen dargelegt werden. Die Bestimmung sieht außerdem vor, dass das Luftfahrtunternehmen allen von einer Verspätung um mindestens zwei Stunden betroffenen Fluggästen einen entsprechenden Hinweis aushändigen muss. Die Vorschrift, betroffenen Fluggästen eine ausführliche schriftliche Erklärung ihrer Rechte auszuhändigen, gilt somit ausdrücklich für Fälle der Nichtbeförderung, Annullierung und Verspätung. Da sich eine Verspätung beim Abflug, aber auch am Endziel ergeben kann, sollten die ausführenden Luftfahrtunternehmen sich auch bemühen, die Fluggäste zu informieren, die von einer Verspätung von mindestens 3 Stunden am Endziel betroffen sind. Nur dann kann jeder Fluggast im Einklang mit den ausdrücklichen Vorschriften von Artikel 14 Absatz 2 ordnungsgemäß informiert werden (73). Ein solches Vorgehen steht voll und ganz mit dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Sturgeon (74) im Einklang, demzufolge Fluggäste, die einen Zeitverlust von 3 Stunden oder mehr erleiden, im Hinblick auf die Anwendung des Ausgleichsanspruchs gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 den Fluggästen annullierter Flüge gleichzustellen sind.
Die Informationspflicht nach Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 hat keinen Einfluss auf die Informationspflichten gemäß anderen unionsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (75) und des Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 2005/29/EG. Das Weglassen wesentlicher Informationen und die Bereitstellung irreführender Informationen über die Fluggastrechte können auch eine unlautere Geschäftspraxis zwischen Unternehmen und Verbrauchern im Sinne der Richtlinie 2005/29/EG darstellen.
4.2. Anspruch auf Erstattung, anderweitige Beförderung oder Umbuchung bei Nichtbeförderung oder Annullierung
Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 müssen Luftfahrtunternehmen die folgenden drei Möglichkeiten zur Wahl stellen:
|
— |
Erstattung der Flugscheinkosten (76) (77) und, im Fall von Umsteigeverbindungen, ein Rückflug zum ersten Abflugort zum frühestmöglichen Zeitpunkt, |
|
— |
anderweitige Beförderung zum Endziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder |
|
— |
anderweitige Beförderung zum Endziel zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes, vorbehaltlich verfügbarer Plätze. |
Wenn ein ausführendes Luftfahrtunternehmen die Wahl zwischen Erstattung und anderweitiger Beförderung anbieten muss, muss es die betroffenen Fluggäste umfassend über alle Möglichkeiten der Erstattung und anderweitigen Beförderung unterrichten. Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 müssen Fluggäste bei der Unterrichtung über die Annullierung Informationen über die anderweitige Beförderung von dem ausführenden Luftfahrtunternehmen erhalten. Die betroffenen Fluggäste sind nicht verpflichtet, selbst aktiv an der Suche nach den entsprechenden Informationen mitzuwirken (78).
Grundsätzlich gilt, dass sich der Fluggast, wenn ihm die Beförderung verweigert wird oder wenn er über die Annullierung unterrichtet und ordnungsgemäß über seine Wahlmöglichkeiten informiert wird, für eine der gemäß Artikel 8 Absatz 1 gebotenen Wahlmöglichkeiten nur einmal entscheiden muss. Sobald sich der Fluggast in solchen Fällen für eine der drei Optionen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a, b oder c entschieden hat, ist das Luftfahrtunternehmen von den Verpflichtungen im Zusammenhang mit den anderen beiden Optionen entbunden. Die Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c zusammen mit Artikel 7 kann jedoch weiterhin gegeben sein.
Das Luftfahrtunternehmen sollte gleichzeitig die Erstattung oder eine anderweitige Beförderung zur Wahl stellen. Im Falle von Umsteigeverbindungen sollte das Luftfahrtunternehmen die Erstattung, einen Rückflug zum Ausgangsflughafen oder eine anderweitige Beförderung zur Wahl stellen. Das Luftfahrtunternehmen hat die Kosten für die anderweitige Beförderung oder einen Rückflug zu tragen. Kommt das Luftfahrtunternehmen seiner Verpflichtung, eine anderweitige Beförderung oder einen Rückflug unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzubieten, nicht nach, so hat es die dem Fluggast entstandenen Kosten für einen Alternativflug zum Endziel des Fluggastes oder einen Rückflug zu erstatten. Die Beweislast dafür, dass die anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgt ist, liegt beim ausführenden Luftfahrtunternehmen (79). Gleiches gilt für den Rückflug zum ersten Abflugort. Bietet das Luftfahrtunternehmen keine Wahl zwischen Erstattung oder anderweitiger Beförderung oder, im Falle von Umsteigeverbindungen, Erstattung, Rückflug zum Ausgangsflughafen oder anderweitiger Beförderung, sondern einseitig beschließt, dem Fluggast die Kosten zu erstatten, hat der Fluggast Anspruch auf eine weitere Erstattung der Differenz zum Preis des neuen Flugscheins unter vergleichbaren Reisebedingungen.
Wurde die Buchung über einen Dritten, wie z. B. eine Buchungsplattform, vorgenommen, hat das Luftfahrtunternehmen bei Annullierung eines Fluges den betroffenen Fluggästen Unterstützung anzubieten, indem es ihnen die Erstattung des Flugscheins zu dem Preis, zu dem der Flugschein erworben wurde, und gegebenenfalls einen Rückflug zum ersten Abflugort anbietet (80).
Wenn ein Luftfahrtunternehmen jedoch nachweisen kann, dass es sich mit den Fluggästen, die sich bereit erklärt haben, ihre persönlichen Kontaktdaten anzugeben, in Verbindung gesetzt und versucht hat, die in Artikel 8 geforderte Hilfe zu leisten, die Fluggäste aber dennoch eigene Vorkehrungen für die Hilfe oder die anderweitige Beförderung getroffen haben, kann das Luftfahrtunternehmen zu dem Schluss kommen, dass es nicht für die zusätzlichen Kosten verantwortlich ist, die den Fluggästen entstanden sind, und kann beschließen, ihnen keine Erstattung zu leisten.
Was die Form der Erstattung betrifft, so ergibt sich aus der Systematik von Artikel 7 Absatz 3, dass die Erstattung der Flugscheinkosten in erster Linie durch einen Geldbetrag erfolgt. Dagegen wird die Erstattung in Reisegutscheinen und/oder anderen Leistungen als ergänzendes Mittel der Erstattung dargestellt, da sie der zusätzlichen Bedingung des „schriftlichen Einverständnisses des Fluggastes“ unterliegt (81).
In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof klargestellt, dass der Begriff „Einverständnis“ entsprechend seiner üblichen Bedeutung als freiwillige und in Kenntnis der Sachlage erteilte Einwilligung zu verstehen ist. Im Zusammenhang mit Artikel 7 Absatz 3 erfordert dieses Konzept daher die freie und in Kenntnis der Sachlage erteilte Zustimmung der Fluggäste, die Erstattung der Flugscheinkosten in Form eines Reisegutscheins zu erhalten (82).
In Bezug auf den Begriff „schriftliches Einverständnis“ hat der Gerichtshof auch klargestellt, dass es nicht unbedingt eine handschriftliche oder digitale Unterschrift des Fluggastes geben muss, wenn die betreffenden Fluggäste die klaren und vollständigen Informationen erhalten haben, die es ihnen ermöglichen, eine wirksame und informierte Entscheidung zu treffen und der Erstattung der Flugscheinkosten durch einen Reisegutschein statt durch einen Geldbetrag freiwillig und in Kenntnis der Sachlage zuzustimmen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann das „schriftliche Einverständnis“ als erteilt gelten, wenn der Fluggast den entsprechenden Teil eines Online-Formulars auf der Website des Luftfahrtunternehmens ausgefüllt hat (83).
Wird Fluggästen die Fortsetzung der Reise oder eine anderweitige Beförderung angeboten, so muss dies stets „unter vergleichbaren Reisebedingungen“ erfolgen. Die Vergleichbarkeit der Reisebedingungen hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss von Fall zu Fall entschieden werden. Je nach Situation werden folgende bewährte Praktiken empfohlen:
|
a) |
nach Möglichkeit keine Herabstufung in eine niedrigere Klasse als die der Buchung (im Falle der Herabstufung ist die in Artikel 10 genannte Ausgleichsleistung anwendbar); |
|
b) |
anderweitige Beförderung ohne Zusatzkosten, selbst wenn Fluggäste von einem anderen Luftfahrtunternehmen oder mit einem anderen Verkehrsträger oder in einer höheren Klasse oder zu einem höheren Preis, als für die ursprüngliche Leistung gezahlt wurde, befördert werden; |
|
c) |
es sind angemessene Bemühungen zu unternehmen, um zusätzliches Umsteigen zu vermeiden; |
|
d) |
bei Nutzung eines anderen Luftfahrtunternehmens oder Verkehrsträgers für den nicht planmäßig durchgeführten Reiseabschnitt sollte die Gesamtreisezeit in derselben oder in einer höheren Klasse möglichst in etwa der ursprünglichen planmäßigen Reisedauer entsprechen; |
|
e) |
sind mehrere Flüge mit vergleichbaren Zeitplänen verfügbar, sollten Fluggäste mit dem Anspruch auf anderweitige Beförderung das Beförderungsangebot des Luftfahrtunternehmens auch mit den Luftfahrtunternehmen annehmen, die mit dem ausführenden Unternehmen zusammenarbeiten; und |
|
f) |
wurden für die ursprüngliche Reise Hilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität gebucht, so sollten diese Leistungen auch auf der Alternativstrecke zur Verfügung stehen. |
Damit das ausführende Luftfahrtunternehmen von seiner Verpflichtung zur Zahlung von Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 befreit werden kann, muss es alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um eine zumutbare, zufriedenstellende und frühestmögliche anderweitige Beförderung sicherzustellen. Dazu gehört die Suche nach anderen direkten oder indirekten Flügen, die gegebenenfalls von anderen Luftfahrtunternehmen, die derselben Luftfahrtallianz angehören oder auch nicht, durchgeführt werden und mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden Luftfahrtunternehmens ankommen (84). Bei dem betreffenden Luftfahrtunternehmen ist nur dann, wenn kein Platz auf einem anderen direkten oder indirekten Flug verfügbar ist, der es dem betreffenden Fluggast ermöglicht, mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden Luftfahrtunternehmens an seinem Endziel anzukommen, oder wenn die Durchführung einer solchen anderweitigen Beförderung für das Luftfahrtunternehmen angesichts seiner Kapazitäten zum maßgeblichen Zeitpunkt ein nicht tragbares Opfer darstellt, davon auszugehen, dass es alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt hat, indem es den betreffenden Fluggast mit dem nächsten von ihm durchgeführten Flug anderweitig befördert hat (85).
Wird der nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b oder c akzeptierte anderweitige Flug ebenfalls annulliert oder ist bei der Ankunft um mindestens 3 Stunden verspätet, entsteht ein neuer Ausgleichsanspruch nach Artikel 7 (86). Die Kommission empfiehlt, den Fluggästen ihre Wahlmöglichkeit verständlich darzulegen, wenn Unterstützungsleistungen zu erbringen sind.
Hat ein Fluggast den Hin- und den Rückflug gesondert bei verschiedenen Luftfahrtunternehmen gebucht und wird der Hinflug annulliert, so ist die Erstattung nur für diesen Flug fällig. Im Falle von zwei Flügen, die Teil desselben Vertrags sind, aber dennoch von verschiedenen Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden, sollten den Fluggästen zusätzlich zu ihrem Anspruch auf Ausgleich durch das ausführende Luftfahrtunternehmen bei der Annullierung des Hinflugs zwei Optionen zur Wahl gestellt werden:
|
a) |
Erstattung der gesamten Flugreise (also Hin- und Rückflug) oder |
|
b) |
anderweitige Beförderung mit einem anderen Hinflug. |
Schließlich hat der Gerichtshof im sehr spezifischen Kontext der Rückführung gestrandeter Fluggäste während des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie entschieden, dass ein von einem Mitgliedstaat im Rahmen der konsularischen Unterstützung nach der Annullierung eines Fluges veranstalteter Rückholflug keine „anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 darstellt, die das ausführende Luftfahrtunternehmen dem Fluggast, dessen Flug annulliert wurde, anbieten muss. Ein Fluggast, der einen Pflichtbeitrag zu den dem betreffenden Mitgliedstaat entstandenen Kosten zu zahlen hat, hat somit keinen Anspruch auf Erstattung dieses Beitrags auf Kosten des ausführenden Luftfahrtunternehmens auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (87).
Dagegen kann sich ein solcher Fluggast, um von dem betreffenden ausführenden Luftfahrtunternehmen eine Ausgleichsleistung zu erhalten, vor einem nationalen Gericht darauf berufen, dass das ausführende Luftfahrtunternehmen seiner Verpflichtung, die vollen Kosten des Flugscheins zu dem Preis, zu dem der Flugschein erworben wurde, für den Teil oder die Teile der Reise, die im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Reiseplan des Fluggastes nicht durchgeführt wurden oder nicht mehr zweckdienlich sind, zu erstatten, und zum anderen seiner Verpflichtung zur Unterstützungsleistungen, einschließlich seiner Informationspflicht nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, nicht nachgekommen ist. Diese Ausgleichsleistung muss jedoch auf das begrenzt sein, was sich unter den Umständen jedes einzelnen Falls als notwendig, angemessen und zumutbar erweist, um das Versäumnis des ausführenden Luftfahrtunternehmens auszugleichen (88).
4.3. Anspruch auf Betreuungsleistungen bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung beim Abflug
4.3.1. Der Begriff „Anspruch auf Betreuungsleistungen“
Einigen sich Fluggäste nach einer Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Abflugs mit dem Luftfahrtunternehmen auf eine anderweitige Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch der Fluggäste (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c), so endet ihr Anspruch auf Betreuungsleistungen. Der Anspruch auf Betreuungsleistungen besteht nur so lange, wie die Fluggäste auf eine anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) oder auf einen Rückflug (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Spiegelstrich) warten.
4.3.2. Bereitstellung von Mahlzeiten, Erfrischungen und Unterbringung
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 soll sicherstellen, dass Fluggäste, die auf ihren Rückflug oder eine anderweitige Beförderung warten, angemessen betreut werden. Der Umfang angemessener Betreuung muss auf Einzelfallbasis unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Fluggäste unter den gegebenen Umständen und des Prinzips der Verhältnismäßigkeit (d. h. abhängig von der Wartezeit) geprüft werden. Der Preis des Flugscheins oder die vorübergehende Natur der Unannehmlichkeit sollte keinen Einfluss auf den Anspruch auf Betreuungsleistungen haben.
In Bezug auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a (Mahlzeiten und Erfrischungen) bedeutet nach Auffassung der Kommission der Ausdruck „in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit“, dass die ausführenden Luftfahrtunternehmen Fluggäste entsprechend der erwarteten Dauer der Verspätung und der Tages- oder Nachtzeit, zu der sie eintritt, betreuen und unter Beachtung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste so weit wie möglich reduzieren sollten. Dies gilt auch in Umsteigeflughäfen im Falle von Anschlussflügen. Auf die Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen oder mit eingeschränkter Mobilität und von Kindern ohne Begleitung ist dabei besonders zu achten.
Darüber hinaus sollten den Fluggästen kostenlose Betreuungsleistungen in klarer und zugänglicher Weise angeboten werden, und zwar nach Möglichkeit auch über elektronische Kommunikationsmittel. Das bedeutet, dass es nicht den Fluggästen überlassen werden sollte, selbst Vorkehrungen zu treffen (z. B. die Unterkunft oder Mahlzeiten selbst zu organisieren und zu bezahlen). Die ausführenden Luftfahrtunternehmen sind vielmehr verpflichtet, aktiv Betreuung anzubieten. Die ausführenden Luftfahrtunternehmen sollten auch sicherstellen, dass die Unterkunft nach Verfügbarkeit auch für Menschen mit Behinderungen und ihre Begleithunde zugänglich ist.
Wird keine Betreuung angeboten, obwohl die Verpflichtung dazu bestand, können Fluggäste die ihnen entstandenen Ausgaben für Mahlzeiten und Erfrischungen, Hotelunterbringung, die Beförderung zwischen dem Flughafen und dem Ort der Unterkunft und/oder für Telekommunikationsdienste vom Luftfahrtunternehmen erstattet bekommen, sofern diese notwendig, angemessen und zumutbar sind (89).
Lehnen Fluggäste das angemessene Betreuungsangebot des Luftfahrtunternehmens, das gemäß Artikel 9 angeboten werden muss, ab und treffen stattdessen ihre eigenen Vorkehrungen, ist das Luftfahrtunternehmen nicht verpflichtet, ihnen ihre Ausgaben zu erstatten, es sei denn, dies ist durch nationales Recht oder eine vorab getroffene Übereinkunft mit dem Luftfahrtunternehmen anders geregelt. Um die Gleichbehandlung der Fluggäste zu gewährleisten, darf eine solche Erstattung niemals den Wert des genannten „angemessenen Angebots“ des Luftfahrtunternehmens übersteigen. Die Fluggäste sollten zudem alle Quittungen für die getätigten Ausgaben aufbewahren.
Fluggäste, die meinen, Anspruch auf eine höhere Kostenerstattung oder auf Ersatz für durch die Verspätung verursachte Schäden, einschließlich Ausgaben, zu haben, sind weiterhin berechtigt, ihre Forderungen auf das Übereinkommen von Montreal und auf Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 zu stützen und in einem nationalen Gerichtsverfahren gegen das Luftfahrtunternehmen zu klagen oder sich an die nationale Durchsetzungsstelle zu wenden. In einigen Mitgliedstaaten müssen sich Fluggäste unter Umständen an Stellen wenden, die für die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten zuständig sind (siehe Abschnitt 7.3).
Hinsichtlich der Verpflichtung, eine kostenlose Hotelunterkunft anzubieten, hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Formulierung „unentgeltlich … Hotelunterbringung [anzubieten]“ den Willen des EU-Gesetzgebers widerspiegelt, zu verhindern, dass die betroffenen Fluggäste die Last tragen müssen, ein Hotelzimmer zu finden und die Kosten für dieses Zimmer selbst zu tragen, da diese Fluggäste vom Luftfahrtunternehmen betreut werden müssen, das zu diesem Zweck die erforderlichen Vorkehrungen treffen muss. Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich jedoch nicht ausdrücklich, dass der Unionsgesetzgeber über die Verpflichtung zur Betreuung der Fluggäste hinaus den Luftfahrtunternehmen die Verpflichtung auferlegen wollte, sich um die Unterbringung als solche zu kümmern (90), z. B. durch Buchung eines bestimmten Zimmers im Namen des Fluggastes.
In ähnlicher Weise hat der Gerichtshof festgestellt, dass das Luftfahrtunternehmen bei einem Zwischenfall im Hotel nicht allein auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 verpflichtet werden kann, einen Fluggast für Schäden zu entschädigen, die durch ein Verschulden der Mitarbeiter des Hotels, in dem die Unterbringung bereitgestellt wird, verursacht worden sind (91).
Es ist zu berücksichtigen, dass gemäß dem Erwägungsgrund 18 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 die Betreuung eingeschränkt oder abgelehnt werden kann, wenn sie ihrerseits für Fluggäste, die auf einen Alternativflug oder einen verspäteten Flug warten, zu einer weiteren Verzögerung führen würde. Wenn ein Flug am späten Abend Verspätung hat, der Abflug aber innerhalb weniger Stunden zu erwarten ist, und wenn die Abfertigung der Fluggäste in Hotels und ihre Rückführung zum Flughafen mitten in der Nacht zu einer viel größeren Verspätung führen könnte, sollte das Luftfahrtunternehmen die Möglichkeit haben, die Bereitstellung von Hotelunterbringungen und entsprechenden Transfers abzulehnen. Auch wenn ein Luftfahrtunternehmen im Begriff ist, Gutscheine für Mahlzeiten und Getränke auszugeben und dann erfährt, dass für den Flug an Bord gegangen werden kann, sollte es von dieser Betreuung absehen können. Von diesen Fällen abgesehen, vertritt die Kommission die Auffassung, dass diese Einschränkung nur in seltenen Sonderfällen angewandt werden sollte, da jede Anstrengung unternommen werden sollte, um die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste zu reduzieren.
Der Anspruch auf Betreuung nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 hat keinen Einfluss auf die Pflichten der Pauschalreiseveranstalter gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2302.
4.3.3. Betreuung unter außergewöhnlichen Umständen oder bei außergewöhnlichen Vorkommnissen
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist das Luftfahrtunternehmen zur Erbringung von Betreuungsleistungen verpflichtet, selbst wenn die Annullierung eines Flugs auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, also auf Umstände, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 enthält keinen Hinweis darauf, dass über die in Artikel 5 Absatz 3 genannten „außergewöhnlichen Umstände“ hinaus eine gesonderte Kategorie von „besonders außergewöhnlichen“ Vorkommnissen anerkannt würde, aufgrund deren die Luftfahrtunternehmen von allen ihren Verpflichtungen einschließlich derjenigen nach Artikel 9 dieser Verordnung freigestellt würden, auch im Fall von außergewöhnlichen Umständen, die einen längeren Zeitraum betreffen, da die Fluggäste unter solchen Umständen und bei solchen Vorkommnissen besonders schutzbedürftig sind (92).
Die Intention der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist es sicherzustellen, dass Fluggäste bei außergewöhnlichen Vorkommnissen angemessen betreut werden, insbesondere wenn sie auf anderweitige Beförderung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b warten. Luftfahrtunternehmen sollten jedoch keine Sanktionen auferlegt werden, wenn sie nachweisen können, dass sie angesichts der besonderen Umstände der Vorkommnisse und nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ihr Möglichstes getan haben, um ihren Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 nachzukommen.
4.4. Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung, Annullierung, Verspätung bei der Ankunft und anderweitiger Beförderung sowie auf Erstattung bei Herabstufung
A. Allgemeines
Das ausführende Luftfahrtunternehmen ist verpflichtet, den Fluggästen den genauen Namen und die Anschrift des Luftfahrtunternehmens mitzuteilen, von dem sie Ausgleichszahlungen verlangen können, und gegebenenfalls die Unterlagen anzugeben, die ihrem Antrag auf Ausgleichszahlung beizufügen sind. Das ausführende Luftfahrtunternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, die Fluggäste über die genaue Höhe der Ausgleichszahlungen zu informieren, die sie möglicherweise erhalten können (93).
Bei Nichtbeförderung gegen den Willen des Fluggastes sieht Artikel 4 Absatz 3 ausdrücklich vor, dass der Fluggast „unverzüglich“ entschädigt werden muss. Dies würde bedeuten, dass, wenn die Ausgleichszahlung nicht vor Ort geleistet wird, zumindest eine Zahlungsverpflichtung eingegangen werden muss, bevor der Fluggast den Flughafen verlässt.
Fluggäste, deren Flüge annulliert wurden oder bei denen eine große Verspätung eingetreten ist, können die Zahlung der Ausgleichsleistung in der Landeswährung ihres Wohnorts verlangen. Dies steht nationalen Vorschriften oder der gerichtlichen Praxis entgegen, die zur Abweisung einer zu diesem Zweck erhobenen Klage allein mit der Begründung führen, dass die Forderung in der Landeswährung des Wohnsitzes des Reisenden ausgedrückt wurde (94).
B. Ausgleich bei Nichtbeförderung
4.4.1. Ausgleich, Nichtbeförderung und außergewöhnliche Umstände
Artikel 2 Buchstabe j und Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sind dahin auszulegen, dass bei Nichtbeförderung stets ein Ausgleichsanspruch besteht und dass Luftfahrtunternehmen keinesfalls eine Nichtbeförderung schlüssig rechtfertigen und sich der Ausgleichszahlung für Fluggäste entziehen können, indem sie sich auf außergewöhnliche Umstände berufen (95).
4.4.2. Ausgleich, Nichtbeförderung und Anschlussflüge
Fluggäste mit Anschlussflügen müssen einen Ausgleich erhalten, wenn ihnen auf einer Reise im Rahmen eines einzigen Beförderungsvertrags mit einer Reiseroute, die direkte Anschlussflüge und eine einzige Abfertigung vorsieht, von einem Luftfahrtunternehmen die Beförderung mit der Begründung verweigert wird, dass der erste in ihrer Buchung enthaltene Flug eine Verspätung hatte, die diesem Luftfahrtunternehmen zuzuschreiben ist, das irrtümlich davon ausging, dass diese Fluggäste nicht rechtzeitig ankommen würden, um den zweiten Flug anzutreten (96). Haben Fluggäste hingegen zwei gesonderte Flugscheine für zwei aufeinanderfolgende Flüge, und bewirkt die Verspätung des ersten Flugs, dass sie nicht rechtzeitig für den Anschlussflug abgefertigt werden können, so ist das Luftfahrtunternehmen, das den Anschlussflug ausführt, nicht verpflichtet, eine Ausgleichszahlung zu leisten. Beträgt die Verspätung des ersten Fluges allerdings mehr als 3 Stunden, so haben die Fluggäste Anspruch auf einen Ausgleich von dem ersten Luftfahrtunternehmen, das diesen Flug ausführt.
4.4.3. Höhe der Ausgleichsleistung
Der Ausgleichsleistung wird gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 berechnet. Sie kann um 50 % gekürzt werden, wenn die Bedingungen von Artikel 7 Absatz 2 erfüllt sind.
C. Ausgleich bei Annullierung
4.4.4. Allgemeiner Fall
Ein Ausgleich bei Annullierung ist fällig,
|
— |
wenn die Fluggäste nicht rechtzeitig, d. h. mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abfahrt, unterrichtet werden, und |
|
— |
wenn sie nicht innerhalb der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 genannten Fristen anderweitig befördert werden (siehe Abschnitt E), |
|
— |
es sei denn, die Annullierung ist gemäß Artikel 5 Absatz 3 auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären (siehe Abschnitt 5 über außergewöhnliche Umstände). |
Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Ausgleich von der Ausgleichsleistung für große Ankunftsverspätung zu unterscheiden ist.
4.4.5. Höhe der Ausgleichsleistung
Der Ausgleichsleistung wird gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 berechnet. Sie kann um 50 % gekürzt werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 2 erfüllt sind, d. h. wenn Fluggäste nach Annullierung ihres ursprünglichen Fluges zu ihrem Endziel anderweitig befördert werden und je nach Entfernung mit einer Verspätung von höchstens 2, 3 oder 4 Stunden ankommen.
4.4.6. Verpflichtung zur Unterrichtung der Fluggäste
Das ausführende Luftfahrtunternehmen muss auch dann Ausgleichszahlungen leisten, wenn der Fluggast nicht mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit über eine Annullierung des Fluges unterrichtet wurde, weil der Vermittler (z. B. Reisebüro, Online-Reisebüro), mit dem der Fluggast den Beförderungsvertrag geschlossen hatte, diese Information nicht rechtzeitig vom Luftfahrtunternehmen an den Fluggast weitergegeben hat und der Fluggast dem Vermittler nicht ausdrücklich gestattet hat, die vom ausführenden Luftfahrtunternehmen übermittelten Informationen zu erhalten (97).
Ebenso hat das ausführende Luftfahrtunternehmen die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehene Ausgleichsleistung im Fall einer Annullierung eines Fluges zu erbringen, über die der Fluggast nicht mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet wurde, wenn das Luftfahrtunternehmen die Information rechtzeitig an die einzige ihm bei der Buchung mitgeteilte E-Mail-Adresse gesandt hat, ohne indes zu wissen, dass über diese Adresse nur der Reisevermittler, über den die Buchung vorgenommen worden war, und nicht unmittelbar der Fluggast erreicht werden konnte, und der Reisevermittler die Information dem Fluggast nicht rechtzeitig, d. h. mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit, übermittelt hat (98).
D. Ausgleichsleistung bei großer Verspätung bei der Ankunft
4.4.7. „Große Verspätung“ bei der Ankunft
Hinsichtlich „großer Verspätungen“ hat der Gerichtshof geurteilt, dass Fluggäste, die von einer Verspätung betroffen sind, einen ähnlichen Schaden in Form eines Zeitverlustes erleiden wie Fluggäste, deren Flug annulliert wurde (99). Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz haben Fluggäste, die ihr Endziel mit einer Verspätung von 3 oder mehr Stunden erreichen, Anspruch auf denselben Ausgleich (Artikel 7) wie Fluggäste, deren Flug annulliert wurde. Der Gerichtshof stützte sich in erster Linie auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, in dem der EU-Gesetzgeber Rechtsfolgen, einschließlich des Rechts auf Ausgleichsleistungen, an Situationen knüpft, in denen den von einer Flugannullierung betroffenen Fluggästen keine anderweitige Beförderung angeboten wird, die es ihnen ermöglicht, nicht mehr als 1 Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel weniger als 2 Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen. Der Gerichtshof schloss daraus, dass der Ausgleichsanspruch gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 darauf abzielt, einen Zeitverlust von mindestens 3 Stunden zu kompensieren. Eine solche Verspätung führt jedoch dann nicht zu einem Ausgleichsanspruch zugunsten der Fluggäste, wenn das Luftfahrtunternehmen nachweisen kann, dass die große Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären (100) (siehe Abschnitt 5 zu außergewöhnlichen Umständen).
4.4.8. Ausgleich bei großer Verspätung bei der Ankunft im Falle von Anschlussflügen
Der Gerichtshof (101) ist der Auffassung, dass für die Zwecke der in Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehenen Ausgleichsleistung eine Verspätung anhand der planmäßigen Ankunftszeit am Endziel des Fluggastes im Sinne von Artikel 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu beurteilen ist, was im Fall eines direkten Anschlussflugs als der Zielort des letzten vom Fluggast durchgeführten Fluges zu verstehen ist.
Im Einklang mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sollten Fluggäste, die einen Anschlussflug innerhalb der EU oder die mit einem Flug, der von einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats abging, einen Anschlussflug außerhalb der EU verpasst haben, Anspruch auf eine Ausgleichszahlung haben, wenn sie ihr Endziel mit einer Verspätung von mehr als 3 Stunden erreichen. Dabei ist nicht von Belang, ob es sich bei dem Luftfahrtunternehmen, das die Verbindungsflüge ausführt, um ein EU-Luftfahrtunternehmen handelt oder nicht.
Werden Anschlussflüge wegen beträchtlicher Verzögerungen bei Sicherheitskontrollen verpasst oder weil die Fluggäste die Einstiegszeit für ihren Flug am Umsteigeflughafen nicht beachtet haben, so entsteht daraus kein Ausgleichsanspruch.
Bei Anschlussflügen im Rahmen einer einzigen Buchung ist keine Ausgleichszahlung zu leisten, wenn das Luftfahrtunternehmen die Fluggäste auf einen späteren Flug für die erste Teilstrecke umbucht und es ihnen dennoch ermöglicht, den zweiten ihrer reservierten Flüge rechtzeitig anzutreten (102).
4.4.9. Ausgleich für große Verspätung bei Ankunft, wenn ein Fluggast einen Flug zu einem anderen Flughafen als den seiner Buchung akzeptiert
Nimmt ein Fluggast einen Flug zu einem anderen als dem gebuchten Flughafen an, ist eine Ausgleichszahlung für die große Verspätung bei der Ankunft zu zahlen. Die für die Berechnung der Verspätung herangezogene Ankunftszeit ist die tatsächliche Zeit der Ankunft am Flughafen, der in der ursprünglichen Buchung vorgesehen war, oder an einem sonstigen nahe gelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Zielort gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (103). Die Kosten für die Beförderung vom alternativen Flughafen zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Flughafen oder zu einem sonstigen nahe gelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Zielort sind vom ausführenden Luftfahrtunternehmen aus eigener Initiative zu tragen (104). Wenn das Luftfahrtunternehmen diese Beförderung nicht bereitstellt oder anbietet und die Fluggäste selbst Vorkehrungen treffen müssen, haben die Fluggäste Anspruch auf Erstattung der von ihnen aufgewendeten Beträge, die sich in Anbetracht der dem jeweiligen Fall eigenen Umstände als notwendig, angemessen und zumutbar erweisen (105).
4.4.10. Höhe der Ausgleichsleistung
Es ist darauf hinzuweisen, dass die einem Fluggast nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 geschuldete Ausgleichszahlung um 50 % gekürzt werden kann, wenn die Voraussetzungen des Artikel 7 Absatz 2 dieser Verordnung vorliegen. Obwohl sich Artikel 7 Absatz 2 nur auf die anderweitige Beförderung von Fluggästen bezieht, hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Reduzierung der Ausgleichsleistung entsprechend für Fluggäste gelten sollte, die bei der Ankunft eine große Verspätung von 3 Stunden oder mehr haben (106).
Daraus folgt, dass die Ausgleichszahlung an einen Fluggast, dessen Flug sich um 3 Stunden oder mehr verspätet und der sein Endziel 3 Stunden oder mehr nach der ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreicht, um 50 % gekürzt werden kann, wenn die Verspätung weniger als 4 Stunden beträgt (107).
Mit anderen Worten, wenn die Verspätung bei der Ankunft bei einer Reise von mehr als 3 500 km mehr als 3 und weniger als 4 Stunden beträgt, kann die Ausgleichszahlung um 50 % gekürzt werden und sich somit auf 300 EUR gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 belaufen.
Wurde jedoch ein Flug vorverlegt, der einen Ausgleichsanspruch nach Artikel 7 begründet, so ist das ausführende Luftfahrtunternehmen weiterhin verpflichtet, den vollen Betrag zu zahlen. Es hat keine Möglichkeit, die zu zahlende Ausgleichsleistung um 50 % mit der Begründung zu kürzen, dass es den Fluggästen eine anderweitige Beförderung angeboten hat, die es ihnen ermöglicht, ohne Verspätung an ihrem Endziel anzukommen (108).
4.4.11. Berechnung der Entfernung auf Basis der „Reise“ zwecks Festlegung des Ausgleichs bei großer Verspätung am Endziel
In der Rechtssache Folkerts (109) wurde ausdrücklich auf den Begriff „Reise“ als mehrere Anschlussflüge umfassend Bezug genommen. In Artikel 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 wird der Begriff „Endziel“ definiert als Zielort auf dem am Abfertigungsschalter vorgelegten Flugschein bzw. bei direkten Anschlussflügen Zielort des letzten Fluges. Gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sollte die Entfernung, die bei großer Verspätung bei der Ankunft für den zu leistenden Ausgleich maßgeblich ist, nach der Methode der Großkreisentfernung zwischen dem Abflugort und dem Endziel, also für die „Reise“, ermittelt werden und nicht durch Addition der Großkreisentfernungen der einzelnen relevanten Anschlussflüge, die die „Reise“ bilden (110).
Diese Bestimmung für die Berechnung der Entfernung gilt auch dann, wenn nur auf dem zweiten Teilflug eine Verspätung eingetreten ist oder wenn die große Verspätung bei der Ankunft auf eine Annullierung des zweiten Teilfluges zurückzuführen ist, die von einem anderen Luftfahrtunternehmen als dem, mit dem der betreffende Fluggast den Beförderungsvertrag geschlossen hat, durchgeführt werden sollte (111). Dieselbe Argumentation würde auch für Flüge gelten, die aus mehr als zwei Teilflügen bestehen.
E. Ausgleich bei anderweitiger Beförderung
4.4.12. Verpflichtung zur rechtzeitigen anderweitigen Beförderung von Fluggästen
Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c sind ausführende Luftfahrtunternehmen nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen nach Artikel 7 zu leisten, wenn sie Fluggäste wie folgt anders befördern:
|
— |
wenn Fluggäste zwischen zwei Wochen und 7 Tagen vor der planmäßigen Abfahrt unterrichtet werden, muss die anderweitige Beförderung es ihnen ermöglichen, spätestens zwei Stunden vor der ursprünglichen planmäßigen Abflugzeit zu starten und ihr Endziel weniger als 4 Stunden nach der ursprünglichen planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen; |
|
— |
werden die Fluggäste weniger als 7 Tage vor der planmäßigen Abfahrt unterrichtet, so muss die anderweitige Beförderung es ihnen ermöglichen, spätestens eine Stunde vor der ursprünglichen planmäßigen Abflugzeit zu starten und ihr Endziel weniger als 2 Stunden nach der ursprünglichen planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen (112). |
4.4.13. Anderweitige Beförderung und Ankunft mehr als 2 Stunden, aber weniger als 3 Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit
Der Gerichtshof hat bestätigt, dass Fluggäste, die über die Annullierung ihres Fluges weniger als 7 Tage vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet werden, Anspruch auf die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c genannte Ausgleichsleistung haben, wenn die vom Luftfahrtunternehmen angebotene anderweitige Beförderung es ihnen ermöglicht, das Endziel mehr als 2 Stunden, aber weniger als 3 Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit des annullierten Fluges zu erreichen (113).
Wenn Fluggäste jedoch selbst eine anderweitige Beförderung vornehmen, weil sie darüber unterrichtet wurden oder über ausreichende Nachweise darüber verfügen, dass ihr Flug mit großer Verspätung an seinem Zielort ankommt, haben sie keinen Anspruch auf Ausgleichszahlung, wenn sie ihr Endziel (mit dem neuen Flug) mit einer Verspätung von weniger als 3 Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit ihres ursprünglich gebuchten Fluges erreichen (114).
F. Erstattung bei Herabstufung
4.4.14. Berechnung des Betrags
Im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist eine Erstattung nur für den Flug zu leisten, für den der Fluggast herabgestuft wurde, und nicht für die gesamte in einem einzigen Flugschein enthaltene Reise, die zwei oder mehr Anschlussflüge umfassen kann. Die genannte Erstattung sollte innerhalb von sieben Tagen geleistet werden.
G. Weiter gehender Schadensersatz
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sieht eine standardisierte pauschale Ausgleichszahlung vor. In Artikel 12 wird betont, dass die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 den Anspruch eines Fluggastes auf zusätzliche Ausgleichsleistungen nicht ausschließen. Der Gerichtshof hat entschieden, dass der Begriff „weiter gehender Schadensersatz“ es einem nationalen Gericht erlaubt, unter den im Übereinkommen von Montreal oder im nationalen Recht vorgesehenen Voraussetzungen Ersatz für Schäden, einschließlich immaterieller Schäden, zuzusprechen, die sich aus der Verletzung eines Luftbeförderungsvertrags ergeben (115). Ein nationales Gericht kann die nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gewährte Ausgleichsleistung von weiter gehenden Ausgleichszahlungen abziehen, ist dazu aber nicht verpflichtet (116).
„Weiter gehender Schadensersatz“ im Sinne von Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 kann auch Ausgleichszahlungen eines Reiseveranstalters aufgrund eines Anspruchs auf Preisminderung nach nationalem Recht umfassen (117).
5. AUẞERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE
5.1. Grundsatz
Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist ein Luftfahrtunternehmen bei Annullierung oder großer Verspätung bei der Ankunft nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen zu leisten, wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung oder Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.
Um von der Ausgleichszahlung befreit zu werden, muss das Luftfahrtunternehmen gleichzeitig nachweisen, dass
|
a) |
außergewöhnlicher Umstände vorgelegen haben und zwischen diesen Umständen und der Verspätung oder Annullierung ein Zusammenhang besteht, und |
|
b) |
diese Verspätung oder Annullierung nicht hätte vermieden werden können, obwohl das Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat (siehe Abschnitt 5.3). |
Bestimmte außergewöhnliche Umstände können mehr als eine Annullierung oder Verspätung am Endziel bewirken, wie beispielsweise eine Entscheidung des Flugverkehrsmanagements gemäß dem Erwägungsgrund 15 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004.
Als Ausnahme von einer Hauptbestimmung, d. h. Zahlung eines Ausgleichs, die das Ziel des Verbraucherschutzes widerspiegelt, muss die Ausnahme in Artikel 5 Absatz 3 eng ausgelegt werden (118). Daher sind alle außergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit Vorkommnissen, wie sie in Erwägungsgrund 14 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 aufgeführt sind, d. h. politische Instabilität, mit der Durchführung des betreffenden Fluges unvereinbare meteorologische Bedingungen, Sicherheitsrisiken, unerwartete Flugsicherheitsmängel und Streiks, die den Betrieb eines ausführenden Luftfahrtunternehmens beeinträchtigen, nicht notwendigerweise ein Grund für eine Befreiung von der Verpflichtung zu Ausgleichsleistungen, sondern erfordern eine Einzelfallprüfung (119).
Der Gerichtshof hat zwei kumulative Voraussetzungen für die Einstufung von Vorkommnissen als außergewöhnliche Umstände entwickelt, die in ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs angewandt wurden:
|
a) |
das Vorkommnis darf aufgrund seiner Art oder Ursache nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens sein, und |
|
b) |
das Vorkommnis muss aufgrund seiner Art oder Ursache außerhalb der tatsächlichen Kontrolle des Luftfahrtunternehmens liegen (120). |
Luftfahrtunternehmen können interne Nachweise (Auszüge aus Logbüchern oder Meldungen von Vorfällen) und/oder externe Unterlagen und Erklärungen beibringen. Ein Luftfahrtunternehmen sollte in seiner Antwort auf die Forderung eines Fluggastes oder in seiner Antwort an die nationale Durchsetzungsstelle auf einen solchen Nachweis verweisen. Will ein Luftfahrtunternehmen außergewöhnliche Umstände geltend machen, sollte es der nationalen Durchsetzungsstelle und den Fluggästen den entsprechenden Nachweis im Einklang mit nationalen Vorschriften für den Zugang zu Dokumenten kostenlos zur Verfügung stellen.
5.2. „Interne“ und „externe“ Vorkommnisse
5.2.1. Begriff
Der Gerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung zum Begriff „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 entschieden, dass Vorkommnisse mit im Hinblick auf das ausführende Luftfahrtunternehmen „interner“ Ursache von solchen mit „externer“ Ursache zu unterscheiden sind (121).
„Externe“ Vorkommnisse ergeben sich aus externen Umständen, die in der Praxis mehr oder weniger häufig auftreten, die aber vom Luftfahrtunternehmen nicht kontrolliert werden, weil sie auf ein natürliches Vorkommnis oder eine Handlung eines Dritten zurückzuführen sind, wie etwa eines anderen Luftfahrtunternehmens oder eines öffentlichen oder privaten Betreibers, der in die Flug- oder Flughafentätigkeit eingreift (122). „Externe“ Vorkommnisse gelten im Allgemeinen als außergewöhnliche Umstände.
Vorkommnisse, die nicht „extern“ sind, sollten als „intern“ für das ausführende Luftfahrtunternehmen eingestuft werden und stellen somit keine außergewöhnlichen Umstände dar.
5.2.2. „Interne“ Vorkommnisse
— Technische Mängel des Luftfahrzeugs
Der Gerichtshof (123) hat weiter ausgeführt, dass technische Probleme, die sich bei der Wartung von Flugzeugen zeigen oder infolge einer unterbliebenen Wartung auftreten, nicht als „außergewöhnliche Umstände“ angesehen werden können. Nach Auffassung des Gerichtshofs fällt sogar ein technisches Problem, das spontan auftrat und weder auf eine fehlerhafte Wartung zurückzuführen ist noch während einer regulären Wartung festgestellt worden ist, nicht unter die Definition „außergewöhnliche Umstände“, wenn es Teil der Ausübung der Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens ist.
So kann ein Ausfall, der durch das vorzeitige Auftreten von Mängeln an bestimmten Teilen eines Flugzeugs hervorgerufen wurde, zwar ein unerwartetes Vorkommnis darstellen. Dennoch bleibt ein solcher Ausfall untrennbar mit dem sehr komplexen System zum Betrieb des Flugzeugs verbunden, das vom Luftfahrtunternehmen oft unter schwierigen oder gar extremen Bedingungen, insbesondere Wetterbedingungen, betrieben wird, wobei kein Teil eines Flugzeugs eine unbegrenzte Lebensdauer hat. Daher ist davon auszugehen, dass ein solches unerwartetes Vorkommnis im Rahmen der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens Teil der normalen Ausübung seiner Tätigkeit ist (124).
Das Gleiche gilt grundsätzlich für den Ausfall eines Teils, das nur dann durch ein neues Teil ersetzt wird, wenn es schadhaft wird (ein „On condition“-Teil) (125).
Ein versteckter Fabrikationsfehler, der vom Hersteller des Luftfahrzeugs oder einer zuständigen Behörde bekannt gemacht wird, oder durch Sabotageakte oder terroristische Handlungen verursachte Schäden an den Flugzeugen würden hingegen als außergewöhnliche Umstände gelten. Dies gilt auch dann, wenn der Hersteller dem Luftfahrtunternehmen das Vorliegen des Mangels mehrere Monate vor dem Flug mitgeteilt hat (126).
— Treppenfahrzeuge
Der Gerichtshof (127) hat klargestellt, dass die Kollision eines Treppenfahrzeugs mit einem Flugzeug nicht als „außergewöhnliche Umstände“ qualifiziert werden kann, die das Luftfahrtunternehmen von seiner Zahlungspflicht gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 befreien. Treppenfahrzeuge oder Gangways können bei der Beförderung von Fluggästen als unverzichtbar betrachtet werden, so dass Luftfahrtunternehmen regelmäßig mit Situationen konfrontiert sind, die sich aus dem Einsatz solcher Ausrüstung ergeben. Ein Zusammenstoß zwischen einem Flugzeug und einem Treppenfahrzeug ist daher als ein internes Vorkommnis anzusehen, das Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens ist. Außergewöhnliche Umstände lägen beispielsweise vor, wenn der Schaden an dem Flugzeug durch einen außerhalb der normalen Flughafendienstleistungen liegenden Akt wie einen Sabotageakt oder eine terroristische Handlung verursacht worden wäre.
— Unerwartete Abwesenheit von Besatzungsmitgliedern
Wenn ein Besatzungsmitglied, dessen Anwesenheit für die Durchführung eines Fluges unerlässlich ist, kurz vor dem planmäßigen Abflug dieses Fluges aufgrund von Krankheit oder gar Tod unerwartet abwesend ist, fällt dies nicht unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (128).
— Streiks des Personals des Luftfahrtunternehmens
Der Gerichtshof hat entschieden, dass Streiks des Personals eines ausführenden Luftfahrtunternehmens nicht als außergewöhnlicher Umstand eingestuft werden können, wenn dieser Streik mit Forderungen im Zusammenhang steht, die sich auf das Arbeitsverhältnis zwischen dem Luftfahrtunternehmen und seinem Personal beziehen, wie z. B. bei Lohnverhandlungen (129).
Diese Feststellung gilt auch für gewerkschaftliche Streiks (130) und „wilde Streiks“, die von Mitarbeitern des Luftfahrtunternehmens nach der überraschenden Ankündigung einer Umstrukturierung eines Luftfahrtunternehmens einberufen werden (131). Ein Streik des Personals eines ausführenden Luftfahrtunternehmens in Solidarität mit Streikmaßnahmen gegen die Muttergesellschaft dieses Luftfahrtunternehmens fällt ebenfalls nicht unter den Begriff der außergewöhnlichen Umstände (132).
Streikmaßnahmen zur Durchsetzung der Ansprüche dieser Arbeitnehmer bei der Muttergesellschaft fallen nicht unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004. Die Frage, ob es vorherige Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern gab, ist insoweit unerheblich (133).
Geht ein solcher Streik jedoch auf Forderungen zurück, die nur die Behörden erfüllen können und die daher von dem betreffenden Luftfahrtunternehmen tatsächlich nicht zu beherrschen sind, kann er einen außergewöhnlichen Umstand darstellen (134).
5.2.3. Externe Vorkommnisse
In verschiedenen Rechtssachen hat der Gerichtshof Sachverhalte beurteilt, die sich aus Naturereignissen oder Handlungen Dritter ergeben. Diese Vorkommnisse können in der Regel als außergewöhnliche Umstände eingestuft werden.
Nachstehend sind einige Beispiele aufgeführt.
a) Vogelschlag
Ein Zusammenstoß zwischen einem Flugzeug und einem Vogel sowie Schäden, die durch einen solchen Zusammenstoß verursacht werden, sind nicht untrennbar mit dem Betrieb des Luftfahrzeugs verbunden. Sie sind ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens und sind daher von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen. Ein solcher Zusammenstoß kann daher als außergewöhnlicher Umstand eingestuft werden (135).
Der Gerichtshof hat ferner klargestellt, dass es unerheblich ist, ob die Kollision tatsächlich Schäden an dem betreffenden Luftfahrzeug verursacht hat. Das in Erwägungsgrund 1 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 genannte Ziel der Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für Fluggäste bedeutet, dass Luftfahrtunternehmen nicht dazu angehalten werden dürfen, die aufgrund eines solchen Vorfalls erforderlichen Maßnahmen zu unterlassen, indem sie der Aufrechterhaltung und Pünktlichkeit ihrer Flüge Vorrang vor dem Ziel der Sicherheit einräumen (136).
In einem anderen Fall hat der Gerichtshof festgestellt, dass die durch einen Vogelschlag verursachte Unterbrechung der Startphase eines Luftfahrzeugs, die zu einem Notbremsmanöver führt, das zur Beschädigung der Reifen des Luftfahrzeugs führt, unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 fällt (137).
b) Zusammenstoß mit anderen Luftfahrzeugen oder Flughafenfahrzeugen
Ein Zusammenstoß eines Luftfahrzeugs in einer Parkposition mit einem Luftfahrzeug einer anderen Fluggesellschaft, die durch die Bewegung des Luftfahrzeugs der anderen Fluggesellschaft verursacht wird, fällt unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ (138).
Ein technischer Ausfall eines auf dem Flughafen abgestellten Flugzeugs, der durch den Zusammenstoß eines Catering-Fahrzeugs eines Dritten mit dem Flugzeug verursacht wird, kann ebenfalls unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ fallen (139).
c) Schäden an dem Luftfahrzeug durch einen Fremdkörper
Schäden an einem Luftfahrzeug, die durch einen auf einer Start- und Landebahn liegenden Fremdkörper, wie z. B. lose Abfälle, verursacht werden, fallen unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ (140).
d) Treibstoff auf der Start- und Landebahn
Das Vorhandensein von Treibstoff auf einer Start- und Landebahn, das zur Schließung des Flughafens führt, und folglich die erhebliche Verspätung eines Fluges zu oder von diesem Flughafen fällt unter den Begriff der außergewöhnlichen Umstände, wenn der betreffende Treibstoff nicht von einem Luftfahrzeug des Luftfahrtunternehmens stammt, das den Flug durchführt (141).
e) Ausfall der Treibstoffversorgung
Wenn der Herkunftsflughafen des betreffenden Fluges oder Luftfahrzeugs für das Betankungssystem des Luftfahrzeugs verantwortlich ist, kann ein genereller Ausfall der Treibstoffversorgung als außergewöhnlicher Umstand angesehen werden (142).
f) Störendes Verhalten von Fluggästen, notfallmedizinische Betreuung
Führt das störende Verhalten eines Fluggastes dazu, dass der verantwortliche Pilot des Luftfahrzeugs den betreffenden Flug zu einem anderen Flughafen als dem Ankunftsflughafen umleitet, um diesen Fluggast bzw. diese Fluggäste und ihr Gepäck von Bord zu bringen, so fällt dies unter den Begriff „außergewöhnlicher Umstand“, es sei denn, das ausführende Luftfahrtunternehmen hat zu diesem Verhalten beigetragen oder es versäumt, angesichts der Warnsignale eines solchen Verhaltens geeignete Maßnahmen zu ergreifen (143).
Darüber hinaus würde die Entfernung eines Fluggastes aus dem Luftfahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls unter den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ fallen.
g) Vulkanausbruch
Umstände wie die Schließung eines Teils des europäischen Luftraums infolge des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajökull stellen außergewöhnliche Umstände im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dar (144).
h) Flughafenüberlastung wegen schlechter Wetterbedingungen
Gemäß dem Erwägungsgrund 14 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 lägen in dem Fall, dass ein ausführendes Luftfahrtunternehmen einen Flug an einem wegen schlechter Wetterbedingungen und der dadurch verursachten Kapazitätsengpässe überlasteten Flughafen verschieben oder annullieren muss, außergewöhnliche Umstände vor.
i) Externe Streiks
Streiks, die außerhalb der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens stattfinden, wie z. B. Streiks der Fluglotsen oder des Flughafenpersonals, können einen außergewöhnlichen Umstand darstellen, da solche externen Streiks nicht in den Tätigkeitsbereich des Luftfahrtunternehmens fallen und somit außerhalb seiner tatsächlichen Kontrolle liegen (145).
j) Mangel an Personal bei der Gepäckverladung
Eine Situation, in der nicht genügend Personal des Flughafenbetreibers für die Verladung des Gepäcks in die Flugzeuge zur Verfügung steht, kann einen außergewöhnlichen Umstand darstellen (146).
5.3. Zumutbare Maßnahmen, die von einem Luftfahrtunternehmen im Falle von außergewöhnlichen Umständen erwartet werden können
Um von seiner Ausgleichspflicht befreit zu werden, muss ein Luftfahrtunternehmen jedes Mal, wenn außergewöhnliche Umstände eintreten, nachweisen, dass es diese nicht hätte vermeiden können, auch wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.
Mit anderen Worten: Wenn solche Umstände eintreten, obliegt es dem ausführenden Luftfahrtunternehmen, nachzuweisen, dass es der Situation angemessene Maßnahmen ergriffen und alle ihm zur Verfügung stehenden personellen, materiellen und finanziellen Mittel eingesetzt hat, um die Verspätung oder Annullierung des betreffenden Fluges zu vermeiden. Es kann jedoch nicht von ihm verlangt werden, Opfer zu bringen, die im Hinblick auf seine Kapazitäten zum gegebenen Zeitpunkt untragbar sind (147).
Darüber hinaus kam der Gerichtshof (148) zu dem Schluss, dass nach Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 von einem Luftfahrtunternehmen verlangt werden kann, seine Mittel rechtzeitig zu planen, um in der Lage zu sein, den vorgesehenen Flug nach dem Wegfall der außergewöhnlichen Umstände durchzuführen, d. h. innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach der planmäßigen Abflugzeit. Das Luftfahrtunternehmen sollte insbesondere über einen gewissen Zeitpuffer verfügen, um den Flug möglichst bald nach dem Wegfall der außergewöhnlichen Umstände durchführen zu können. Eine solcher Zeitpuffer wird auf Einzelfallbasis beurteilt.
Artikel 5 Absatz 3 kann jedoch nicht dahin ausgelegt werden, dass im Rahmen der „zumutbaren Maßnahmen“ eine Pflicht besteht, allgemein und undifferenziert einen Mindest-Zeitpuffer einzuplanen, die für sämtliche Luftfahrtunternehmen unterschiedslos in allen Situationen des Eintritts außergewöhnlicher Umstände gilt. In dieser Hinsicht verfügen die Luftfahrtunternehmen in der Regel über mehr Ressourcen an ihrer Heimatbasis als am Zielort, so dass sie mehr Möglichkeiten haben, die Auswirkungen von außergewöhnlichen Umständen zu begrenzen. Bei der Beurteilung der Fähigkeit des Luftfahrtunternehmens, den geplanten Flug insgesamt unter den sich aus dem Eintritt außergewöhnlicher Umstände ergebenden durchzuführen, ist darauf zu achten, dass der Umfang des geforderten Zeitpuffers dem Luftfahrtunternehmen keine Opfer abverlangt, die angesichts seiner Kapazitäten zum jeweiligen Zeitpunkt nicht tragbar sind (149).
Was technische Defekte anbelangt, so reicht allein der Umstand, dass ein Luftfahrtunternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindesterfordernisse an Wartungsarbeiten an einem Flugzeug durchgeführt hat, nicht für den Nachweis, dass dieses Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, und somit für seine Befreiung von der Ausgleichspflicht (150).
5.4. Außergewöhnliche Umstände bei einem früheren Flug mit demselben Luftfahrzeug
Um von seiner Verpflichtung zu Ausgleichsleistungen an Fluggäste im Falle einer großen Verspätung oder Annullierung eines Fluges befreit zu werden, kann sich ein ausführendes Luftfahrtunternehmen auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen, der einen früheren Flug betraf, den es mit demselben Luftfahrzeug durchgeführt hat, wenn ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang zwischen dem Eintritt dieses Umstands und der Verspätung oder Annullierung des nachfolgenden Fluges besteht (151).
In einem anderen Fall hat der Gerichtshof klargestellt, dass sich ein ausführendes Luftfahrtunternehmen im Falle einer großen Verspätung bei der Ankunft auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen kann, der nicht den verspäteten Flug, sondern einen vorangegangenen Flug betroffen hat, den es selbst mit demselben Flugzeug im Rahmen von dessen Vorvorvorrotation durchgeführt hat, sofern ein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der erheblich verspäteten Ankunft des späteren Fluges besteht (152).
6. FLUGGASTRECHTE BEI MASSIVEN REISEUNTERBRECHUNGEN
6.1. Allgemeines
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 enthält keine besonderen Bestimmungen für den Fall großer Reiseunterbrechungen wie den Vulkanausbruch in Island im Jahr 2010 oder den Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Der Anspruch auf Ausgleichsleistungen im Falle einer Annullierung ergibt sich aus der nicht ausreichenden Unterrichtung des Fluggastes über die Annullierung. Auf diesen Aspekt gehen daher die Erwägungen in Abschnitt 4.4 zu den Ansprüchen auf Ausgleichsleistungen ein.
6.2. Recht auf anderweitige Beförderung oder Erstattung
In Bezug auf die anderweitige Beförderung kann sich eine massive Reiseunterbrechung auf das Recht auswirken, die anderweitige Beförderung zum „frühestmöglichen Zeitpunkt“ bzw. „bei nächster Gelegenheit“ zu wählen. Den Luftfahrtunternehmen könnte es unmöglich sein, den Fluggast innerhalb eines kurzen Zeitraums anderweitig an den vorgesehenen Zielort zu befördern. Darüber hinaus könnte es eine Zeit lang unklar sein, wann eine anderweitige Beförderung möglich sein wird. Dies kann beispielsweise eintreten, wenn ein Mitgliedstaat Flüge in bestimmte Länder oder aus bestimmten Ländern aussetzt. Daher könnte sich, je nach Fall, der „frühestmögliche Zeitpunkt“ für eine anderweitige Beförderung erheblich verzögern oder mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sein. In der Folge könnten Fluggäste eine Erstattung des Flugpreises oder eine anderweitige Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt „nach Wunsch des Fluggastes“ präferieren.
Hat ein Fluggast den Hin- und Rückflug getrennt gebucht und der Hinflug wird annulliert, hat er nur Anspruch auf Erstattung des annullierten Flugs, das heißt in diesem Fall des Hinflugs.
Sind Hin- und Rückflug jedoch Teil derselben Buchung, sollten Fluggästen, auch wenn die Flüge von unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden, bei einer Annullierung des Hinflugs zwei Möglichkeiten angeboten werden: Erstattung der gesamten Flugreise (also Hin- und Rückflug) oder anderweitige Beförderung mit einem anderen Hinflug.
6.3. Anspruch auf Betreuungsleistungen
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 enthält keine Bestimmungen, die eine gesonderte Kategorie von „besonders außergewöhnlichen“ Vorkommnissen anerkennen, die über die in Artikel 5 Absatz 3 genannten außergewöhnlichen Umstände hinausgehen. Daher muss das Luftfahrtunternehmen seinen Verpflichtungen, einschließlich der Verpflichtungen nach Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, auch dann nachkommen, wenn die Situation, die zu diesen Verpflichtungen führt, über einen längeren Zeitraum andauert. Unter solchen Umständen und Vorkommnissen sind die Fluggäste besonders schutzbedürftig (153). Die Intention der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ist es sicherzustellen, dass bei Auftreten außergewöhnlicher Vorkommnisse insbesondere Fluggäste, die auf anderweitige Beförderung im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 warten, angemessen betreut werden.
6.4. Ausgleichsanspruch
Der Anspruch auf Ausgleichsleistung bei Annullierung nach Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gilt nicht für Annullierungen, die mehr als 14 Tage im Voraus erfolgen oder wenn die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn das Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hätte.
Die Kommission ist der Auffassung, dass, wenn Behörden Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen einer Krisensituation, die zu massiven Reiseunterbrechungen führt, einzudämmen, diese Maßnahmen ihrer Art und ihrem Ursprung nach nicht mit der normalen Ausübung der Tätigkeit der Luftfahrtunternehmen zusammenhängen und sich deren tatsächlichen Kontrolle entziehen.
Nach Artikel 5 Absatz 3 besteht kein Anspruch auf Ausgleichsleistungen, wenn die betreffende Annullierung auf außergewöhnliche Umstände „zurückgeht“, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.
Diese Bedingung sollte als erfüllt gelten, wenn die Behörden entweder bestimmte Flüge verbieten oder den Personenverkehr in einer Weise einschränken, die die Durchführung des betreffenden Fluges de facto ausschließt.
Diese Bedingung kann auch erfüllt sein, wenn die Annullierung des Fluges unter Umständen erfolgt, unter denen der entsprechende Personenverkehr nicht vollständig verboten ist, sondern auf Personen beschränkt ist, für die Ausnahmeregelungen gelten (z. B. Staatsangehörige oder Einwohner des betreffenden Staates).
Wenn keine solche Person einen bestimmten Flug nimmt, bleibt der Flug leer oder wird gestrichen. In solchen Fällen kann es legitim sein, dass ein Luftfahrtunternehmen nicht bis zur letzten Minute wartet, sondern den Flug rechtzeitig annulliert, damit geeignete organisatorische Maßnahmen ergriffen werden können, auch im Hinblick auf die Betreuung der Fluggäste durch die Luftfahrtunternehmen. In solchen Fällen und abhängig von den jeweiligen Umständen kann immer noch davon ausgegangen werden, dass eine Annullierung auf die behördliche Maßnahme „zurückgeht“. Je nach den Umständen kann dies auch für Flüge in der entgegengesetzten Richtung zu den Flügen gelten, die unmittelbar von den behördlichen Reisebeschränkungen betroffen sind.
Beschließt ein Luftfahrtunternehmen, einen Flug zu annullieren, und weist es nach, dass diese Entscheidung aus Gründen der allgemeinen oder betrieblichen Sicherheit der Besatzung gerechtfertigt ist, sollte diese Annullierung ebenfalls als auf außergewöhnliche Umstände „zurückgehend“ betrachtet werden.
Die vorstehenden Erwägungen sind nicht erschöpfend und können nicht abschließend sein, da auch andere besondere Umstände, die sich aus einer bestimmten Krisensituation ergeben, in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 fallen können.
7. AUSGLEICH, ERSTATTUNG, ANDERWEITIGE BEFÖRDERUNG UND BETREUUNG BEI MULTIMODALEN REISEN
Multimodale Reisen mit mehr als einem Verkehrsträger im Rahmen eines einheitlichen Beförderungsvertrags (z. B. kombinierte Bahn-/Flugreisen, die als eine Reise verkauft werden), fallen als solche weder unter die Verordnung (EG) Nr. 261/2004, noch unter andere EU-Rechtsvorschriften über Fluggastrechte bei anderen Verkehrsträgern (154). Verpasst ein Fluggast wegen einer Zugverspätung einen Flug, hätte er nur Anspruch auf die Unterstützungsleistungen im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates (155) in Bezug auf die Bahnreise und auch nur dann, wenn er mit einer Verspätung von mehr als 60 Minuten am Zielort ankommt (156). In gleicher Weise wären im Falle eines wegen einer verspäteten Schiffs- oder Busfahrt im Rahmen eines einzigen Beförderungsvertrags verpassten Flugs andere Bestimmungen anwendbar (157). Wenn die multimodale Reise jedoch Teil einer Kombination mit anderen Reiseleistungen (z. B. Unterbringung) ist, kann der betreffende Pauschalreiseveranstalter gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2302 auch für die verpassten Flüge und die Auswirkungen auf die Pauschalreise insgesamt haftbar gemacht werden.
8. BESCHWERDEN BEI NATIONALEN DURCHSETZUNGSSTELLEN, STELLEN FÜR ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ IM RAHMEN DER VERORDNUNG ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT IM VERBRAUCHERSCHUTZ
8.1. Beschwerden bei nationalen Durchsetzungsstellen
Fluggäste können sich bei jeder von einem Mitgliedstaat benannten nationalen Durchsetzungsstelle über einen angeblichen Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf einem EU-Flughafen oder bei einem Flug von einem Drittland zu einem solchen Flughafen beschweren (158).
Um eine effiziente Bearbeitung der Beschwerdeverfahren zu gewährleisten und ein sicheres rechtliches Umfeld für Luftfahrtunternehmen und andere potenziell beteiligte Unternehmen zu schaffen, empfiehlt die Kommission, den Fluggästen zu empfehlen, Beschwerden an folgende Stellen zu richten:
|
— |
die nationale Durchsetzungsstelle des Abfluglandes bei EU-Flügen und Flügen aus der EU in ein Drittland, und |
|
— |
die nationale Durchsetzungsstelle des Ankunftslandes bei Flügen von außerhalb der EU. |
Fluggäste, die der Auffassung sind, dass ein Luftfahrtunternehmen ihre Rechte verletzt hat, sollten ihre Beschwerden innerhalb einer angemessenen Frist und gemäß den im nationalen Recht festgelegten Fristen einreichen (159).
Fluggäste sollten sich zunächst an das Luftfahrtunternehmen wenden. Nur wenn sie mit der Antwort des Luftfahrtunternehmens nicht einverstanden sind oder keine zufrieden stellende Antwort des Luftfahrtunternehmens erhalten, sollten Fluggäste eine Beschwerde bei einer nationalen Durchsetzungsstelle einreichen. Die Kommission empfiehlt, dass das Luftfahrtunternehmen innerhalb von zwei Monaten antwortet und dass es keine Beschränkung in Bezug auf die Verwendung einer der EU-Amtssprachen gibt.
Es sei darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof (160) die Auffassung vertreten hat, dass zur Gewährleistung individueller Fluggastrechte die nationalen Durchsetzungsstellen nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 nicht verpflichtet sind, auf solche Beschwerden einzugehen. Dies bedeutet, dass eine nationale Durchsetzungsstelle nicht verpflichtet ist, Durchsetzungsmaßnahmen gegen Luftfahrtunternehmen zu erlassen, um sie in Einzelfällen dazu anzuhalten, die in der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehene Ausgleichsleistung zu erbringen. Ihre sanktionierende Rolle gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 besteht in Maßnahmen, die als Reaktion auf Verstöße zu treffen sind, die die Stelle in Ausübung ihrer allgemeinen Aufsicht nach Artikel 16 Absatz 1 aufdeckt.
Dem Gerichtshof zufolge hindert die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran, Rechtsvorschriften zu erlassen, die die nationale Durchsetzungsstelle verpflichten, auf individuelle Beschwerden hin Maßnahmen zu ergreifen (161). Die Mitgliedstaaten verfügen über einen Ermessensspielraum hinsichtlich der Befugnisse, die sie ihren nationalen Stellen zum Schutz der Fluggastrechte übertragen wollen.
Diese Urteile haben keinen Einfluss auf die Verpflichtung der nationalen Durchsetzungsstellen, den Beschwerdeführern – im Einklang mit den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis – eine fundierte Antwort auf ihre Beschwerden zu geben. Zu einer vorbildlichen Praxis würde nach Auffassung der Kommission auch gehören, dass die Fluggäste über Rechtsbehelfe und sonstige Maßnahmen unterrichtet werden, falls sie mit der Bewertung ihres Falls nicht einverstanden sind. Ein Fluggast sollte das Recht haben zu entscheiden, ob er von einer anderen Person oder Einrichtung vertreten werden will.
8.2. Alternative Streitbeilegung (AS)
Der EU-Rechtsrahmen für alternative Streitbeilegung soll es den Verbrauchern ermöglichen, ihre Rechte bei Streitigkeiten mit Unternehmern über den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung wirksam geltend zu machen. Während die Kosten und der Zeitaufwand für ein Gerichtsverfahren abschreckend wirken können und informelle Instrumente unzureichend sein können, sollten die qualitätszertifizierten AS-Stellen gemäß der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (162) eine Streitigkeit innerhalb von 90 Tagen beilegen, und zwar ohne oder nur mit geringen Kosten für den Verbraucher.
Verbraucher haben Zugang zu qualitätszertifizierten AS-Stellen, wenn sie in der EU ansässig sind und der Unternehmer in der EU niedergelassen ist. Sind Luftfahrtunternehmen nach nationalem Recht nicht verpflichtet, an Verfahren vor AS-Stellen teilzunehmen, so ist es doch wünschenswert, dass sie sich freiwillig zur Teilnahme an solchen Verfahren verpflichten und ihre Kunden dies wissen lassen.
Der Zugang der Verbraucher zu AS-Stellen kommt zu der Möglichkeit für Fluggäste hinzu, sich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 an die nationalen Durchsetzungsstellen zu wenden.
8.3. Weitere Mittel zur Unterstützung der Beteiligten bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Beteiligten bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu unterstützen.
Die erste betrifft die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz gemäß der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates (163), mit der ein Koordinierungs- und Kooperationsmechanismus zwischen den nationalen Verbraucherschutzbehörden eingerichtet wird. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden ist von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Verbraucherschutzrecht im Binnenmarkt in gleicher Weise angewandt wird, und um gleiche Ausgangsbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Die Verordnung (EU) 2017/2394 findet auf Situationen Anwendung, in denen die Kollektivinteressen der Verbraucher auf dem Spiel stehen, und überträgt den nationalen Behörden zusätzliche Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse, um Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften in grenzüberschreitenden Fällen zu unterbinden.
In der Verordnung (EU) 2017/2394 ist die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über Fluggastrechte als eines der Rechtsinstrumente zum Schutz der Verbraucherinteressen aufgeführt. Dies bedeutet, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 festgelegten Fluggastrechte im Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2017/2394 eingeführten Koordinierungs- und Kooperationsmechanismus durchgesetzt werden können, wenn die kollektiven Interessen der Verbraucher in einem grenzüberschreitenden Kontext auf dem Spiel stehen.
In der Richtlinie (EU) 2020/1828 (164) ist ein weiteres Instrument zur Durchsetzung der Fluggastrechte in größerem Umfang vorgesehen. Aus dieser Richtlinie geht hervor, dass es sich bei Sammelklagen um Klagen handelt, die von qualifizierten Einrichtungen im Namen von Verbrauchergruppen vor nationalen Gerichten oder Verwaltungsbehörden erhoben werden, um Unterlassungsmaßnahmen (d. h. die Unterbindung rechtswidriger Praktiken von Gewerbetreibenden), Abhilfemaßnahmen (wie Erstattung oder Entschädigung) oder sowohl Unterlassungs- als auch Abhilfemaßnahmen zu erwirken. Die Richtlinie zielt darauf ab, die Kollektivinteressen der Verbraucher in vielen Bereichen, insbesondere im Reise- und Tourismusbereich, zu schützen. Sie gilt für Klagen gegen Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 261/2004, die unter den in ihren Anwendungsbereich fallenden Rechtsakten der Union aufgeführt sind. Schließlich können sich Fluggäste, die in einem grenzüberschreitenden Kontext auf Probleme gestoßen sind, an das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (165) (ECC-NET) wenden. Das ECC-NET klärt Verbraucher über ihre Rechte nach europäischem und nationalem Verbraucherrecht auf, berät unentgeltlich über Möglichkeiten für den Umgang mit Verbraucherbeschwerden, bietet direkte Unterstützung bei der einvernehmlichen Beilegung von Beschwerden mit Händlern und lenkt Verbraucher zu einer geeigneten Stelle, wenn das ECC-NET keine Hilfe bieten kann. Fluggäste können sich auch an nationale Verbraucherorganisationen wenden, um Informationen und direkte Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Rechte aus der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu erhalten.
9. EINREICHUNG VON KLAGEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004
9.1. Zuständigkeit für die Klageerhebung nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 keine Vorschriften über die internationale Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten enthält, so dass die Frage der Zuständigkeit anhand der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 zu prüfen ist (166).
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 kann bei Flügen von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat auf der Grundlage eines mit einem einzigen ausführenden Luftfahrtunternehmen geschlossenen Vertrags entsprechend dem Vertragswortlaut (167) für eine auf die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gestützte Klage auf Ausgleichszahlungen nach Wahl des Klägers das Gericht des Ortes des Abflugs oder das des Ortes der Ankunft des Flugzeugs angerufen werden. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 haben Fluggäste auch die Möglichkeit, vor den Gerichten des Sitzlandes des Beklagten (d. h. des Luftfahrtunternehmens) zu klagen.
In mehreren Urteilen hat der Gerichtshof bestätigt, dass Fluggäste auch bei Anschlussflügen, die aus einer bestätigten einzigen Buchung für die gesamte Reise bestehen und in mehrere Teilflüge unterteilt sind, entweder am Abflug- oder am Ankunftsort Klage erheben können. Konkret hat der Gerichtshof entschieden, dass nach der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 Klage beim nationalen Gericht am Ankunftsort des zweiten Teilflugs erhoben werden kann, wenn die Beförderung auf beiden Flügen von zwei verschiedenen Luftfahrtunternehmen durchgeführt wurde und die Ausgleichsklage auf eine Unregelmäßigkeit gestützt wird, die auf dem ersten dieser Flüge aufgetreten ist, der von dem Luftfahrtunternehmen durchgeführt wurde, mit dem die betroffenen Fluggäste keine vertraglichen Beziehungen unterhalten (168).
Ebenso kann eine Klage vor dem nationalen Gericht des Abflugorts des ersten Teilfluges erhoben werden, wenn sich der Ausgleichsanspruch aus der Annullierung des letzten Teilfluges ergibt und gegen das für diesen letzten Teilflug zuständige Luftfahrtunternehmen erhoben wird (169).
Bei Anschlussflügen, die aus zwei oder mehr Teilflügen bestehen und auf denen die Beförderung durch verschiedene Luftfahrtunternehmen erfolgt, kann jedoch das nationale Gericht des Ankunftsorts des ersten Teilfluges nicht angerufen werden, wenn der Ausgleichsanspruch ausschließlich auf einer Verspätung des ersten Teilfluges beruht, die durch einen verspäteten Abflug verursacht wurde und gegen das Luftfahrtunternehmen erhoben wird, das diesen ersten Teilflug durchführt (170).
Zur Frage des richtigen Adressaten eines Gerichtsverfahrens hat der Gerichtshof entschieden, dass das Gericht eines Mitgliedstaats über einen Rechtsstreit über eine gegen ein Luftfahrtunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat gerichtete Klage auf Ausgleichszahlung nicht deshalb zuständig ist, weil dieses Unternehmen im Gerichtsbezirk des angerufenen Gerichts über eine Zweigniederlassung verfügt, ohne dass dieses an dem Rechtsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem betreffenden Fluggast beteiligt ist (171).
Zu der Frage, ob ein Luftfahrtunternehmen in seinen Geschäftsbedingungen verbieten kann, dass Fluggäste einem Dritten die Geltendmachung von Ansprüchen in ihrem Namen übertragen, hat der Gerichtshof klargestellt, dass Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 der Aufnahme einer Klausel in einen Beförderungsvertrag entgegensteht, die die Abtretung von Ansprüchen verbietet, die den Fluggästen gegenüber dem ausführenden Luftfahrtunternehmen nach den Bestimmungen der Verordnung zustehen (172).
War ein Flug Teil eines Pauschalreisevertrags, so kann ein Fluggast nach der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 eine Klage auf Ausgleichsleistungen gegen ein ausführendes Luftfahrtunternehmen erheben, auch wenn zwischen dem Fluggast und dem Luftfahrtunternehmen kein Vertrag geschlossen wurde (173).
In Bezug auf die Zuständigkeit für Ansprüche nach dem Übereinkommen von Montreal hat der Gerichtshof Folgendes klargestellt: Während die örtliche Zuständigkeit für einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 261/2004 nach der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 beurteilt werden sollte, sollte die Zuständigkeit für einen Anspruch auf ergänzenden Schadensersatz, der in den Anwendungsbereich des Übereinkommens von Montreal fällt, nach diesem Übereinkommen beurteilt werden (174).
9.2. Frist für die Erhebung einer Klage nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 legt keine Fristen für die Erhebung einer Klage vor den nationalen Gerichten fest. Das Thema unterliegt dem nationalen Recht jedes Mitgliedstaats in Bezug auf die Klageverjährung. Die im Übereinkommen von Montreal festgelegte zweijährige Verjährungsfrist gilt nicht für nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 erhobene Klagen und berührt nicht die nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, weil die in der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen nicht in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallen, da sie Fluggästen entstandene Unannehmlichkeiten mindern und die mit dem Übereinkommen geschaffene Regelung für Schadensfälle ergänzen sollen. Die Fristen können daher je nach Mitgliedstaat unterschiedlich sein (175).
10. HAFTUNG DES LUFTFAHRTUNTERNEHMENS NACH DEM ÜBEREINKOMMEN VON MONTREAL
Das Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr, gemeinhin als das „Übereinkommen von Montreal“ bekannt, wurde am 28. Mai 1999 in Montreal unterzeichnet. Die EU ist Vertragspartei dieses Übereinkommens, und einige Bestimmungen des Übereinkommens wurden durch die Verordnung (EG) Nr. 2027/97, die zusammen mit der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 den Schutz der Fluggastrechte in der EU zum Ziel hat, in das EU-Recht übernommen.
|
a) |
Vereinbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 mit dem Übereinkommen von Montreal: Der Gerichtshof (176) hat bestätigt, dass die Vorschrift, Ausgleich für Verspätung bei der Ankunft und Bereitstellung von Unterstützung bei Verspätung beim Abflug zu leisten, mit dem Übereinkommen von Montreal vereinbar ist. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof die Auffassung vertreten, dass der mit einer Flugverspätung einhergehende Zeitverlust eine „Unannehmlichkeit“ darstellt und keinen „Schaden“, auf dessen Minderung das Übereinkommen von Montreal abzielt. Eine solche Argumentation stützt sich auf die Feststellung, dass eine erhebliche Verspätung zunächst eine Unannehmlichkeit darstellt, die für alle Fluggäste praktisch identisch ist, und dass die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 einen standardisierten, sofortigen Ausgleich vorsieht. Das Übereinkommen von Montreal hingegen sieht eine Wiedergutmachung vor, die eine Prüfung des Umfangs des entstandenen Schadens im Einzelfall erforderlich macht und deshalb nur Gegenstand eines nachträglichen und individualisierten Ausgleichs sein kann. Die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 greift somit zu einem früheren Zeitpunkt als das Übereinkommen von Montreal. Die aus der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 erwachsende Verpflichtung, Fluggästen, deren Flug sich verspätet, einen Ausgleich zu gewähren, fällt somit nicht in den Anwendungsbereich des Übereinkommens von Montreal, sondern ergänzt die dort vorgesehene Schadensregelung. |
|
b) |
Die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 gilt nur für Fluggäste, die mit einem Luftfahrtunternehmen fliegen, d. h. mit einem Luftfahrtunternehmen mit einer gültigen Betriebsgenehmigung (177) im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung. |
|
c) |
Für die Zwecke von Artikel 17 des Übereinkommens von Montreal ist ein Fluggast eine Person, die aufgrund eines „Beförderungsvertrags“ im Sinne von Artikel 3 des Übereinkommens befördert wurde, selbst wenn der Einzel- oder Sammelbeförderungsschein nicht ausgehändigt wurde (178). |
|
d) |
Der Begriff „Unfall“ im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 des Übereinkommens von Montreal, der die Haftung eines Luftfahrtunternehmens für Schäden begründet, die durch Tod oder Körperverletzung eines Fluggastes entstanden sind, wurde vom Gerichtshof in mehreren Urteilen ausgelegt, z. B. in den vorliegenden Rechtssachen:
|
|
e) |
Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal sollte zusammen mit Artikel 3 Absatz 3 des Übereinkommens gelesen und dahin ausgelegt werden, dass der Anspruch auf Entschädigung und die Haftungsbegrenzung des Luftfahrtunternehmens bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung von Reisegepäck auf 1 288 Sonderziehungsrechte (SZR) auch für einen Fluggast gelten, der diese Entschädigung für den Verlust, die Zerstörung, die Beschädigung oder die Verspätung eines Gepäckstücks fordert, das von einem Mitreisenden aufgegeben wurde, wenn dieses Gepäckstück tatsächlich Gegenstände des Fluggastes enthielt. Daher muss jeder von der Zerstörung, dem Verlust, der Beschädigung oder der Verspätung eines Gepäckstücks, das von einem Mitreisenden aufgegeben wurde, betroffene Fluggast Anspruch auf eine Entschädigung innerhalb der Haftungsbegrenzung von 1 288 SZR haben, wenn er nachweisen kann, dass seine Gegenstände sich tatsächlich in dem aufgegebenen Gepäckstück befanden. Es ist Sache jedes Fluggastes, dies zur Zufriedenheit eines nationalen Gerichts nachzuweisen, das berücksichtigen kann, dass die Fluggäste Familienmitglieder sind, ihre Flugscheine zusammen gekauft haben oder zusammen gereist sind (184). |
|
f) |
Der in Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal festgelegte Betrag, der die Haftung des Luftfahrtunternehmens bei Zerstörung, Verlust, Verspätung oder Beschädigung von aufgegebenem Reisegepäck, für das kein Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort angegeben wurde, begrenzt ist, stellt einen Höchstbetrag der Entschädigung dar. Es handelt sich nicht um einen festen Tarif, und der Fluggast hat keinen automatischen Anspruch auf diesen Betrag (185). |
|
g) |
Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal, mit dem der von Luftfahrtunternehmen für Schäden, die unter anderem durch den Verlust von Reisegepäck eintreten, zu zahlende Haftungshöchstbetrag festgelegt wird, umfasst sowohl materielle als auch immaterielle Schäden (186). Dieser Artikel gilt auch im Falle der Zerstörung, des Verlusts, der Beschädigung oder der Verspätung bei der Beförderung von aufgegebenen Rollstühlen oder anderen Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten gemäß der Definition in Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006. In diesem Fall ist die Haftung des Luftfahrtunternehmens auf den im vorstehenden Absatz genannten Betrag beschränkt, es sei denn, der Fluggast hat bei der Übergabe des aufgegebenen Reisegepäcks an das Luftfahrtunternehmen das Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort betragsmäßig angegeben und einen eventuell verlangten Zuschlag entrichtet. |
|
h) |
Zur Auslegung der Artikel 19, 22 und 29 des Übereinkommens von Montreal hat der Gerichtshof (187) die Auffassung vertreten, dass nach dem Übereinkommen ein Luftfahrtunternehmen im Fall eines durch die Verspätung von Flügen entstandenen Schadens gegenüber einem Arbeitgeber haftbar ist, dessen Arbeitnehmer diese Flüge in Anspruch genommen haben. Daher sollte das Übereinkommen dahin ausgelegt werden, dass es nicht nur für die den Fluggästen selbst entstandenen Schäden, sondern auch für den Schaden gilt, der einem Arbeitgeber entstanden ist, mit dem ein Vertrag über die internationale Beförderung von Fluggästen geschlossen wurde. In seinem Urteil fügte der Gerichtshof hinzu, dass Luftfahrtunternehmen allerdings die Gewähr haben, dass ihre Haftung sich auf die im Übereinkommen festgelegte Höchstgrenze beschränkt, die mit der Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer/Fluggäste multipliziert wird. |
|
i) |
Eine Beschwerde muss innerhalb der in Artikel 31 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal genannten Fristen schriftlich eingereicht werden, andernfalls kann das Luftfahrtunternehmen nicht belangt werden. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die Beschwerde von einem Vertreter des Luftfahrtunternehmens in das Informationssystem eingegeben wird und der Fluggast die Möglichkeit hat, die Richtigkeit des schriftlich niedergelegten und in das System eingegebenen Textes der Beschwerde zu überprüfen und ihn gegebenenfalls vor Ablauf der in Artikel 31 Absatz 2 des Übereinkommens vorgesehenen Frist zu ändern, zu ergänzen oder sogar zu ersetzen. Schließlich ist die Einreichung einer Beschwerde nicht von weiteren inhaltlichen Anforderungen abhängig, die über die Unterrichtung des Luftfahrtunternehmens über den erlittenen Schaden hinausgehen (188). |
|
j) |
Im Falle einer Klage auf Ersatz eines unter Artikel 19 des Übereinkommens von Montreal fallenden Schadens hat der Fluggast die Wahl zwischen mehreren Gerichten, auf die in Artikel 33 des Übereinkommens eingegangen wird: das Gericht des Ortes, an dem sich der Wohnsitz des Luftfahrtunternehmens, das Gericht an dem sich seine Hauptniederlassung oder seine Geschäftsstelle befindet, durch die der Vertrag geschlossen worden ist, oder das Gericht des Bestimmungsorts. In diesem Fall ist es nicht von Belang, ob dieser Ort in der EU gelegen ist, da die Zuständigkeit auf dem Übereinkommen beruht, dessen Vertragspartei die EU ist. |
(1) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj).
(2) Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum — Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem (KOM(2011) 144 endg., S. 23) (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF).
(3) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen, (KOM(2011) 174 endg.) (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0174:FIN:DE:PDF).
(4) Entschließung des Europäischen Parlaments zur Funktionsweise und Anwendung der geltenden Fluggastrechte (2011/2150/INI) (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2012-99).
(5) Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (ABl. L 285 vom 17.10.1997, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2027/oj).
(6) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von Fluggästen und deren Gepäck im Luftverkehr (COM(2013) 130 final vom 13.3.2013).
(8) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine Luftfahrtstrategie für Europa (COM(2015) 598 final vom 7.12.2015).
(9) Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (ABl. L 285 vom 17.10.1997, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2027/oj).
(10) Steer Davies Gleave, Evaluation of Regulation 261/2004 – Final report – Main report, Februar 2010.
(11) Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Impact Assessment accompanying the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delays of flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air (SWD(2013) 62 final vom 13.3.2013) und Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (COM(2013) 130 final).
(12) Im Text wird systematisch und eindeutig auf die einschlägigen Rechtssachen des Gerichtshofs verwiesen; fehlt ein solcher Verweis, so wird die Auslegung der Verordnung durch die Kommission wiedergegeben.
(13) Siehe Artikel 19 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union.
(14) Beschluss 2001/539/EG des Rates vom 5. April 2001 über den Abschluss des Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Übereinkommen von Montreal) durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 194 vom 18.7.2001, S. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/539/oj).
(15) Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj).
(16) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen (COM(2020) 789 final vom 9.12.2020).
(17) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 261/2004, (EG) Nr. 1107/2006, (EU) Nr. 1177/2010, (EU) Nr. 181/2011 und (EU) 2021/782 in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union (COM(2023) 753 final vom 29.11.2023).
(18) Siehe Anhang II AEUV (http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_de.htm).
(19) Artikel 355 Absatz 5 Buchstabe a AEUV.
(20) Die Verordnung gilt im Einklang mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum für Island und Norwegen und im Einklang mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr (1999) für die Schweiz.
(21) Rechtssache C-173/07, Emirates Airlines, ECLI:EU:C:2008:400, Rn. 40.
(22) Rechtssache C-173/07, Emirates Airlines, ECLI:EU:C:2008:400, Rn. 53.
(23) Rechtssache C-537/17, Wegener; ECLI:EU:C:2018:361, Rn. 18, Rechtssache C-191/19, Air Nostrum, ECLI:EU:C:2020:339, Rn. 26, Rechtssache C-451/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2022:123, Rn. 25, Rechtssache C-436/21, flightright, ECLI:EU:C:2022:762, Rn. 20.
(24) Rechtssache C-537/17, Wegener, ECLI:EU:C:2018:361, Rn. 25.
(25) Rechtssache C-502/18, České aerolinie, ECLI:EU:C:2019:604, Rn. 20 bis 26.
(26) Rechtssache C-502/18, České aerolinie, ECLI:EU:C:2019:604, Rn. 33.
(27) Rechtssache C-367/20, KLM Royal Dutch Airlines, ECLI:EU:C:2020:909, Rn. 33.
(28) Rechtssache C-561/20, United Airlines, ECLI:EU:C:2022:266, Rn. 44.
(29) Rechtssache C-436/21, flightright, ECLI:EU:C:2022:762, Rn. 28.
(30) Rechtssache C-436/21, flightright, ECLI:EU:C:2022:762, Rn. 31.
(31) Rechtssache C-451/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2022:123, Rn. 41.
(32) Rechtssache C-367/20, KLM Royal Dutch Airlines, ECLI:EU:C:2020:909, Rn. 18 und 25.
(33) Rechtssache C-257/14, van der Lans, ECLI:EU:C:2015:618, Rn. 28.
(34) Rechtssache C-316/20, SATA International – Azores Airlines, ECLI:EU:C:2020:966, Rn. 19.
(35) Rechtssache C-686/20, Vueling Airlines, ECLI:EU:C:2021:859, Rn. 31.
(36) Rechtssache C-756/18, easyJet Airline, ECLI:EU:C:2019:902, Rn. 25.
(37) Rechtssache C-474/22, Laudamotion GmbH, ECLI:EU:C:2024:73, Rn. 21.
(38) Rechtssache C-756/18, easyJet Airline, ECLI:EU:C:2019:902, Rn. 28, 29, 30 und 33.
(39) Rechtssache C-474/22, Laudamotion GmbH, ECLI:EU:C:2024:73, Rn. 34.
(40) Siehe auch die Definition des Begriffs „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ in Artikel 2 Buchstabe b.
(41) Rechtssache C-532/17, Wirth, ECLI:EU:C:2018:527, Rn. 26.
(42) Rechtssache C-292/18, Breyer, ECLI:EU:C:2018:99, Rn. 28.
(43) Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj). Gemäß Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2015/2302 sind Bezugnahmen auf die Richtlinie 90/314/EWG in der Verordnung als Bezugnahmen auf die Richtlinie (EU) 2015/2302 zu verstehen.
(44) Siehe allerdings zum Thema „Regressansprüche“ Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 und Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2015/2302.
(45) Rechtssache C-163/18, Aegean Airlines, ECLI:EU:C:2019:585, Rn. 44.
(46) Rechtssache C-215/18, Primera Air Scandinavia, ECLI:EU:C:2020:235, Rn. 38.
(47) Rechtssache C-22/11, Finnair, ECLI:EU:C:2012:604, Rn. 26.
(48) Rechtssache C-238/22, LATAM Airlines Group, ECLI:EU:C:2023:815, Rn. 28.
(49) Rechtssache C-238/22, LATAM Airlines Group, ECLI:EU:C:2023:815, Rn. 39.
(50) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29 (ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj);
siehe auch Rechtssache C-290/16, Air Berlin/VZBV, ECLI:EU:C:2017:523, Rn. 46 bis 49.
(51) Rechtssache C-584/18, Blue Air – Airline Management Solutions, ECLI:EU:C:2020:324, Rn. 92 und 94.
(52) Rechtssache C-584/18, Blue Air – Airline Management Solutions, ECLI:EU:C:2020:324, Rn. 103.
(53) Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1107/oj).
(54) Auslegungsleitlinien zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, SWD(2012) 171 final vom 11.6.2012 [nach Annahme der überarbeiteten Leitlinien zu aktualisieren].
(55) Rechtssache C-83/10, Sousa Rodríguez u. a., ECLI:EU:C:2011:652, Rn. 29.
(56) Rechtssache C-32/16, Wunderlich, ECLI:EU:C:2016:753, Rn. 27.
(57) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 37 und 38.
(58) Verbundene Rechtssachen C-146/20, C-188/20, C-196/20 und C-270/20, Azurair u. a., ECLI:EU:C:2021:1038, Rn. 87.
(59) Rechtssache C-263/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:1039, Rn. 35, Rechtssache C-395/20, Corendon Airlines, ECLI:EU:C:2021:1041, Rn. 23.
(60) Rechtssache C-83/10, Sousa Rodríguez u. a., ECLI:EU:C:2011:652, Rn. 28.
(61) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 44.
(62) Rechtssache C-253/21, TUIfly GmbH, ECLI:EU:C:2021:840, Rn. 27.
(63) Siehe Abschnitt 5 über außergewöhnliche Umstände.
(64) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 69. Siehe auch verbundene Rechtssachen C-581/10 und C-629/10, Nelson u. a., ECLI:EU:C:2012:657, Rn. 40, und Rechtssache C-413/11, Germanwings, ECLI:EU:C:2013:246, Rn. 19.
(65) Rechtssache C-452/13, Germanwings, ECLI:EU:C:2014:2141, Rn. 27.
(66) Verbundene Rechtssachen C-146/20, C-188/20, C-196/20 und C-270/20, Azurair u. a., ECLI:EU:C:2021:1038, Rn. 68.
(67) Rechtssache C-654/19, FP Passenger Service, ECLI:EU:C:2020:770, Rn. 25.
(68) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 49.
(69) Rechtssache C-315/15, Pešková und Peška, ECLI:EU:C:2017:342, Rn 54.
(70) Rechtssache C-255/15, Mennens, ECLI:EU:C:2016:472, Rn. 32 und 43.
(71) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).
(72) Verbundene Rechtssachen C-146/20, C-188/20, C-196/20 und C-270/20, Azurair u. a., ECLI:EU:C:2021:1038, Rn. 108.
(73) Die den Fluggästen zur Verfügung gestellten Informationen zur Liste der nationalen Durchsetzungsstellen in der EU können einen Verweis auf die Website der Kommission enthalten, auf der alle Kontaktangaben der nationalen Durchsetzungsstellen zu finden sind.
(74) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 69.
(75) Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).
(76) Der Flugpreis wird insgesamt oder für den nicht angetretenen Teil der Reise und, falls die Reise angesichts der ursprünglichen Reisepläne des Fluggastes keinen Sinn mehr hat, für den oder die bereits absolvierten Teil(e) erstattet. Entscheiden sich die Fluggäste für den Rückflug zum Ausgangsflughafen, so hat der bereits absolvierte Teil der Reise angesichts der ursprünglichen Reisepläne grundsätzlich keinen Sinn mehr.
(77) Der Preis des Flugscheins, der bei der Bestimmung der Erstattung, die das Luftfahrtunternehmen einem Fluggast im Fall der Annullierung eines Fluges schuldet, zu berücksichtigen ist, umfasst die Differenz zwischen dem von diesem Fluggast gezahlten Betrag und dem vom Luftfahrtunternehmen erhaltenen Betrag, der einer Provision entspricht, die von einer Person erhoben wurde, die als Vermittler zwischen diesen beiden Parteien handelt, es sei denn, diese Provision wurde ohne Wissen des Luftfahrtunternehmens festgesetzt (Rechtssache C-601/17, Harms, ECLI:EU:C:2018:702, Rn. 20).
(78) Rechtssache C-354/18, Rusu, ECLI:EU:C:2019:637, Rn. 56.
(79) Rechtssache C-354/18, Rusu, ECLI:EU:C:2019:637, Rn. 62.
(80) Rechtssache C-601/17, Harms, ECLI:EU:C:2018:702, Rn. 12.
(81) Rechtssache C-76/23, Cobult, ECLI:EU:C:2024:253, Rn. 20.
(82) Rechtssache C-76/23, Cobult, ECLI:EU:C:2024:253, Rn. 22.
(83) Rechtssache C-76/23, Cobult, ECLI:EU:C:2024:253, Rn. 29, 34 und 37.
(84) Rechtssache C-74/19, Transportes Aéros Portugueses., ECLI:EU:C:2020:460, Rn. 59.
(85) Rechtssache C-74/19, Transportes Aéros Portugueses., ECLI:EU:C:2020:460, Rn. 61.
(86) Rechtssache C-832/18, Finnair, ECLI:EU:C:2020:204, Rn. 31 und 33.
(87) Rechtssache C-49/22, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2023:454, Rn. 33.
(88) Rechtssache C-49/22, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2023:454, Rn. 50.
(89) Rechtssache C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43, Rn. 66.
(90) Rechtssache C-530/19, Niki Luftfahrt, ECLI:EU:C:2020:635, Rn. 24.
(91) Rechtssache C-530/19, Niki Luftfahrt, ECLI:EU:C:2020:635, Rn. 40.
(92) Rechtssache C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43, Rn. 30.
(93) Verbundene Rechtssachen C-146/20, C-188/20, C-196/20 und C-270/20, Azurair u. a., ECLI:EU:C:2021:1038, Rn. 108.
(94) Rechtssache C-356/19, Delfly, ECLI:EU:C:2020:633, Rn. 34.
(95) Rechtssache C-22/11, Finnair, ECLI:EU:C:2012:604, Rn. 40.
(96) Rechtssache C-321/11, Rodríguez Cachafeiro und Martínez-Reboredo Varela Villamor, ECLI:EU:C:2012:609, Rn. 36.
(97) Rechtssache C-302/16, Krijgsman, ECLI:EU:C:2017:359, Rn. 31. Rechtssache C-263/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:1039, Rn. 56.
(98) Rechtssache C-307/21, Ryanair DAC, ECLI:EU:C:2022:729, Rn. 30.
(99) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 54.
(100) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 69.
(101) Rechtssache C-11/11, Folkerts, ECLI:EU:C:2013:106, Rn. 47.
(102) Rechtssache C-191/19, Air Nostrum, ECLI:EU:C:2020:339, Rn. 34.
(103) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 49.
(104) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 66.
(105) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 73.
(106) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 63.
(107) Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 63.
(108) Verbundene Rechtssachen C-146/20, C-188/20, C-196/20 und C-270/20, Azurair u. a., ECLI:EU:C:2021:1038, Rn. 94.
(109) Rechtssache C-11/11, Folkerts, ECLI:EU:C:2013:106, Rn. 18.
(110) Rechtssache C-559/16, Bossen, ECLI:EU:C:2017:644, Rn. 33.
(111) Rechtssache C-939/19, flightright, ECLI:EU:C:2020:316, Rn. 22, Rechtssache C-592/20, British Airways, ECLI:EU:C:2021:312, Rn. 36.
(112) Rechtssache C-130/18, flightright GmbH, ECLI:EU:C:2018:496, Rn. 23.
(113) Rechtssache C-130/18, flightright GmbH, ECLI:EU:C:2018:496, Rn. 23.
(114) Rechtssache C-54/23, WY/Laudamotion GmbH und Ryanair DAC, ECLI:EU:C:2024:74, Rn 24.
(115) Rechtssache C-83/10, Sousa Rodríguez u. a., ECLI:EU:C:2011:652, Rn. 46.
(116) Rechtssache C-354/18, Rusu, ECLI:EU:C:2019:637, Rn. 47.
(117) Rechtssache C-153/19, DER Touristik GmbH, ECLI:EU:C:2020:412, Rn. 36.
(118) Rechtssache C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, Rn. 17 und zitierte Rechtsprechung.
(119) Rechtssache C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, Rn. 22.
(120) Rechtssache C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, Rn. 23, Rechtssache C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43, Rn. 29. Rechtssache C-257/14, van der Lans, ECLI:EU:C:2015:618, Rn. 36, und spätere Fälle.
(121) Der Gerichtshof hat diese Unterscheidung erstmals in der Rechtssache C-28/20, Airhelp Ltd, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 39, getroffen.
(122) Rechtssache C-28/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 41.
(123) Rechtssache C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, Rn. 25.
(124) Rechtssache C-257/14, van der Lans, ECLI:EU:C:2015:618, Rn. 40, 41 und 42.
(125) Rechtssache C-832/18, Finnair, ECLI:EU:C:2020:204, Rn. 43.
(126) Rechtssache C-411/23, D., ECLI:EU:C:2024:498, Rn. 42, siehe auch Rechtssache C-385/23, Finnair, ECLI:EU:C:2024:497, Rn. 37 und 39.
(127) Rechtssache C-394/14, Siewert, ECLI:EU:C:2014:2377, Rn. 19 und 20.
(128) Verbundene Rechtssachen C-156/22, C-157/22 und C-158/22, TAP Portugal, ECLI:EU:C:2023:393, Rn. 26.
(129) Rechtssache C-28/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 37.
(130) Rechtssache C-28/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 44.
(131) Rechtssache C-195/17, Krüsemann u. a., ECLI:EU:C:2018:258, Rn 48.
(132) Rechtssache C-613/20, Eurowings, ECLI:EU:C:2021:820, Rn. 34.
(133) Rechtssache C-287/20, Ryanair DAC, ECLI:EU:C:2022:1, Rn. 33.
(134) Rechtssache C-28/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 45.
(135) Rechtssache C-315/15, Pešková und Peška, ECLI:EU:C:2017:342, Rn 24.
(136) Rechtssache C-315/15, Pešková und Peška, ECLI:EU:C:2017:342, Rn 25.
(137) Rechtssache C-302/22, Freebird Airlines Europe Ltd, ECLI:EU:C:2022:748, Rn. 23.
(138) Rechtssache C-264/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:26, Rn. 26.
(139) Rechtssache C-659/21, Orbest, ECLI:EU:C:2022:254, Rn. 27.
(140) Rechtssache C-501/17, Germanwings, ECLI:EU:C:2019:288, Rn. 34.
(141) Rechtssache C-159/18, Moens, ECLI:EU:C:2019:535, Rn. 22.
(142) Rechtssache C-308/21, SATA International – Azores Airlines, ECLI:EU:C:2022:533, Rn. 28.
(143) Rechtssache C-74/19, Transportes Aéros Portugueses., ECLI:EU:C:2020:460, Rn. 48.
(144) Rechtssache C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43, Rn. 34.
(145) Rechtssache C-28/20, Airhelp Ltd, ECLI:EU:C:2021:226, Rn. 42 und 43.
(146) Rechtssache C-405/23, Touristic Aviation Services Limited, ECLI:EU:C:2024:408, Rn 30.
(147) Rechtssache C-74/19, Transportes Aéreos Portugueses, ECLI:EU:C:2020:460, Rn. 36 und zitierte Rechtsprechung.
(148) Rechtssache C-294/10, Eglītis und Ratnieks, ECLI:EU:C:2011:303, Rn. 37.
(149) Rechtssache C-264/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2021:26, Rn. 33.
(150) Rechtssache C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, Rn. 43.
(151) Rechtssache C-74/19, Transportes Aéros Portugueses., EU:C:2020:460, Rn. 55.
(152) Rechtssache C-826/19, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2021:318, Rn. 57.
(153) Rechtssache C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43‚ Rn. 30 und Nummer 4.3.3 der Auslegungsleitlinien.
(154) Solche Vorschriften werden vorgeschlagen, siehe den Vorschlag COM(2013) 130 final und den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Fahrgastrechte im multimodalen Kontext (COM(2023) XXX vom 29.11.2023).
(155) Verordnung (EU) Nr. 2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/782/oj).
(156) Artikel 20 der Verordnung (EU) 2021/782.
(157) Siehe diesbezüglich die Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg//2010/1177/oj) und Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/181/oj).
(158) Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004.
(159) Rechtssache C-139/11, Cuadrench Moré, ECLI:EU:C:2012:741, Rn. 33.
(160) Verbundene Rechtssachen C-145/15 und C-146/15, Ruijssenaars u. a., ECLI:EU:C:2016:187, Rn. 32, 36 und 38.
(161) Rechtssache C-597/20, LOT, ECLI:EU:C:2022:735, Rn. 26.
(162) Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj).
(163) Verordnung (EU) Nr. 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).
(164) Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/oj).
(165) https://www.eccnet.eu.
(166) Rechtssache C-204/08, Rehder, ECLI:EU:C:2009:439, Rn. 28.
(167) Rechtssache C-204/08, Rehder, ECLI:EU:C:2009:439, Rn. 47.
(168) Verbundene Rechtssachen C-274/16, C-447/16 und C-448/16, flightright, ECLI:EU:C:2018:160, Rn. 78.
(169) Rechtssache C-606/19, flightright, ECLI:EU:C:2020:101, Rn. 36.
(170) Rechtssache C-20/21, LOT Polish Airlines, ECLI:EU:C:2022:71, Rn. 27.
(171) Rechtssache C-464/18, Ryanair, ECLI:EU:C:2019:311, Rn. 36.
(172) Rechtssache C-11/23, Eventmedia Soluciones SL, ECLI:EU:C:2024:194, Rn. 26.
(173) Rechtssache C-215/18, Primera Air Scandinavia, ECLI:EU:C:2020:235, Rn. 38.
(174) Rechtssache C-213/18, Guaitoli u. a., ECLI:EU:C:2019:927, Rn 44.
(175) Rechtssache C-139/11, Cuadrench Moré, ECLI:EU:C:2012:741, Rn. 33.
(176) Rechtssache C-344/04, IATA und ELFAA, ECLI:EU:C:2006:10, Rn. 43, 45, 46 und 47, Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07, Sturgeon u. a., ECLI:EU:C:2009:716, Rn. 51.
(177) Rechtssache C-240/14, Prüller-Frey, ECLI:EU:C:2015:567, Rn. 29.
(178) Rechtssache C-6/14, Wucher Helicopter, ECLI:EU:C:2015:122, Rn. 36, 37 und 38.
(179) Rechtssache C-532/18, Niki Luftfahrt, ECLI:EU:C:2019:1127, Rn. 43.
(180) Rechtssache C-589/20, Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2022:424, Rn. 24.
(181) Urteil des Gerichtshofs, Hofmann, C-70/20, ECLI:EU:C:2021:379, Rn. 43.
(182) Rechtssache C-111/21, Laudamotion, ECLI:EU:C:2022:808, Rn. 33.
(183) Rechtssache C-510/21, DB/Austrian Airlines, ECLI:EU:C:2023:550, Rn. 28.
(184) Rechtssache C-410/11, Espada Sanchez, ECLI:EU:C:2012:747, Rn. 35.
(185) Rechtssache C-86/19, Vueling Airlines, ECLI:EU:C:2020:538, Rn. 35.
(186) Rechtssache C-63/09, Walz, ECLI:EU:C:2010:251, Rn. 39.
(187) Rechtssache C-429/14, Air Baltic Corporation, ECLI:EU:C:2016:88, Rn. 29 und 49.
(188) Rechtssache C-258/16, Finnair, ECLI:EU:C:2018:252, Rn. 31, 37, 47 und 54.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5687/oj
ISSN 1977-088X (electronic edition)